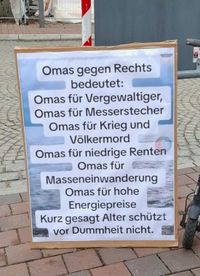AKTUELLES & HISTORISCHES:
NS-Widerstand
- Erinnern, Gedenken, Ehren
- Lehren für Gegenwart und Zukunft
- NSDAP-Verbotsverfahren und AFD- Verbotsverfahren
- zum NS-WIDERSTAND und zum Widerstand gegen Bestrebungen in und aus der Neuen Rechten
- Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen antifaschistisch orientierte NGOs und Aktivisten
- Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen staatliche Institutionen, Politiker*innen, Grundgesetz und Demokratie
- u.a. in juristischen Aufarbeitungen
ausgehend vom Amtsgericht Mosbach
unter Führung und Verantwortung
des Direktors Dr. Lars Niesler,
Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)
der CDU Baden-Württemberg
Zuletzt AKTUALISIERT am 06.02.2026 !
SIEHE AUCH: Relativierung, Verharmlosung und Leugnung von NS-Verbrechen - u.a. aus der Neuen Rechten, wie in und aus der AFD - u.a. in juristischen Aufarbeitungen ausgehend vom Amtsgericht Mosbach >>> SIEHE AUCH: Rechtsextremismus nach 1945 als Folge bzw. Konsequenz des Nationalsozialismus vor 1945 - u.a. aus der Neuen Rechten, wie in und aus der AFD - u.a. in juristischen Aufarbeitungen ausgehend vom Amtsgericht Mosbach >>> SIEHE AUCH: AKTUELLES & HISTORISCHES: NS-Widerstand - Erinnern, Gedenken, Ehren - Lehren für Gegenwart und Zukunft -- - Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen antifaschistisch orientierte NGOs und Aktivisten -- - Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen staatliche Institutionen, Politiker*innen, Grundgesetz und Demokratie >>> SIEHE AUCH: Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) im Kontext juristischer Aufarbeitung von NS-Verbrechen und NS-Unrecht, Rechtsextremismus und Rassismus sowie von der in Teilen rechtsextremistischen AFD - u.a. in Mosbach, im Neckar-Odenwaldkreis, Baden-Württemberg - historische und aktuelle politische Kontextualisierung juristischen Handelns >>>
SIEHE AUCH: HISTORISCHES & AKTUELLES: NS-Widerstand - Erinnern, Gedenken, Ehren - Lehren für Gegenwart und Zukunft - Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen antifaschistisch orientierte NGOs und Aktivisten - Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen staatliche Institutionen, Grundgesetz und Demokratie >>> SIEHE AUCH: Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU)
im Kontext juristischer Aufarbeitung von NS-Verbrechen und NS-Unrecht, Rechtsextremismus und Rassismus sowie von der in Teilen rechtsextremistischen AFD >>>
SIEHE AUCH: AKTUELLES: Relativierung, Verharmlosung und Leugnung von NS-Verbrechen >>> SIEHE AUCH: HISTORISCHES & AKTUELLES: NS-Widerstand - Erinnern, Gedenken, Ehren - Lehren für Gegenwart und Zukunft >>> SIEHE AUCH: HISTORISCHES & AKTUELLES: Judenverfolgung und Anti-Semitismus seit 1945 >>>SIEHE AUCH: Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) im Kontext juristischer Aufarbeitung von NS-Verbrechen und NS-Unrecht, Rechtsextremismus und Rassismus sowie von der in Teilen rechtsextremistischen AFD >>>
Seiteninhalt:
- NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach unter Einbeziehung der forensischen familienpsychologischen sachverständigen Gutachterin aus Kitzingen Antje Wieck
1.1 Expertise der forensischen familienpsychologischen sachverständigen Gutachterin MA Antje C. Wieck aus Kitzingen zur Aufarbeitung von NS-Verbrechen und NS-Unrecht in der NS-Vergangenheitsbewältigung - Online Artikel zum NS-WIDERSTAND und zum Widerstand gegen Bestrebungen in und aus der Neuen Rechten
2.1 Widerstandsleistungen gegen Bestrebungen in und aus der Neuen Rechten, wie u.a. in und aus der AFD
2.2 Widerstandsleistungen gegen das Nationalsozialistische Terror-Verfolgungs- und Vernichtungsregime
2.3 Online Artikel zum NS-WIDERSTAND in Baden-Württemberg
2.4 Online-Artikel zu Angriffen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen antifaschistisch orientierte NGOs und Aktivisten
2.4.1 Online-Artikel zu Angriffen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, mit Beleidigungen und Diffamierungen der "Omas gegen Rechts"
2.4.2 Online-Artikel zu Angriffen gegen die Kirchen und kirchliche Organisationen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD
2.5 Online-Artikel zu Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen staatliche Institutionen, Grundgesetz und Demokratie
2.5.1 Online-Artikel zu Angriffen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen die Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht im Juli 2025
2.5.2 Online-Artikel zu Angriffen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, mit geschichtsrevisitionistischen, volksverhetzenden und herabwürdigenden Diffamierungen der Befürworter einer Prüfung zum AFD-Parteiverbotsverfahren als Nazis
2.5.3 Online Artikel zu offensivem aggressiven Agieren der rechtsextremen Szene in Spremberg
2.5.4 Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, wie u.a. aus der AFD, gegen die politischen, gesellschaftlichen und juristischen Aufarbeitungen des Deutschen Kolonialismus
2.5.5 Sicherheitsgefährdende Angriffe gegen die BRD ausgehend von der Neuen Rechten, wie u.a. aus der AFD
2.5.5.1 Strafanzeigen vom 30.11.2025 gegen die Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz wegen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung und Prozessbetrug, Begünstigung von Landesverrat- und Hochverrat-Bestrebungen, Unterschlagung und Unterdrückung von Beweismaterialien aus Verfahren beim Amtsgericht und in Verfahren beim Landgericht Mosbach der seit 2022 beantragten juristischen Aufarbeitungen (a =>) … von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933, (b =>) … von Reichsbürger- und AFD-Prozessen mit nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen nach 1945, (=> c) … zu Leugnung und Relativierung von deutschen Kolonialverbrechen, (=> d) …zu Leugnung und Relativierung von NS-Verbrechen, (=> e) … von sicherheitsgefährdenden Angriffen gegen die BRD ausgehend von der Neuen Rechten, wie u.a. aus der AFD, an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg
2.6 Online-Artikel zum angestrebten NSDAP-Verbotsverfahren in 1930
2.6.1 Online-Artikel zum Parteienverbot der NS-Regierung vom 14.07.1933
Siehe Inhalt dieser Kategorie "Aktuelles: NS-Gegenwart":
- NS-Konzentrationslager und NS-Gedenkstätten >>>
- Nazi-KZ-Überlebende >>>
- Nazi-Arbeitsämter und NS-Zwangsarbeit >>>
- NS-Widerstand >>>
- Holocaust-Relativierung und Leugnung >>>
- Relativierung und Leugnung von NS-Verbrechen >>>
- NS-Vergangenheitsbewältigung >>>
- Nazi-Vergangenheitsbewältigung und Nazi-Kontinuität in Baden und Württemberg >>>
- Schlussstrichdebatte in der NS-Vergangenheitsbewältigung >>>
- Nazi-Funktionseliten nach 1945 >>>
- Heimerziehung der Nachkriegszeit ab 1945 >>>
Siehe auch:
- HISTORISCHES: NS-Widerstand >>>
- HISTORISCHES: Nationalsozialismus in Mosbach - Baden >>>
- AKTUELLES: NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach >>>
- HISTORISCHES & AKTUELLES: Nazi-Terror-Verfolgungs- und Vernichtungsjustiz >>>
- NS-Verfahren und -Prozesse des 21. Jahrhunderts >>>
1. NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach unter Einbeziehung der forensischen familienpsychologischen sachverständigen Gutachterin aus Kitzingen Antje Wieck
Amtsgericht Mosbach | NS- und Rechtsextremismus-Verfahren bei der Mosbacher Justiz: |
Nach Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg mit Beschluss vom 15.12.2022 - 6 S 1420/22 - unterliegt der Nationalsozialismus nicht der grundrechtlich geschützten Weltanschauungsfreiheit gemäß Art. 4 Abs. 1 GG.
Das Amtsgericht Mosbach hat jedoch seit dem 03.06.2022 eine gemäß § 158 StPO ordnungsgemäße Eingangsbestätigung mit den Benennungen der Konkreten Eingabedaten, der Konkreten Sachverhaltsbenennungen mit einer kurzen Zusammenfassung der Angaben zu Tatzeit, Tatort und angezeigter Tat, insbesondere zu beantragten NS- und Rechtsextremismus-Strafverfahren, bisher ausdrücklich und EXPLIZIT versagt und NICHT ausgestellt.
Auch für die beim Amtsgericht Mosbach beantragten Wiederaufnahmeverfahren, amtsseitigen Verfügungen und gerichtlichen Prüfungen in NS- und Rechtsextremismus-Angelegenheiten verweigert das Amtsgericht Mosbach ordnungsgemäße Eingangs- und Weiterbearbeitungsbestätigungen mit konkreten Sachverhaltsbenennungen.
Siehe dazu auch Umgang des Amtsgerichts Mosbach mit NS- und Rechtsextremismusverfahren >>>
Das Amtsgericht Mosbach verweigert zudem bisher Stellungnahmen zu den historisch nachgewiesenen Kontinuitäten von NS-Funktionseliten in der BRD. Das AG MOS verweigert zudem bisher Stellungnahmen zur Kontinuität von NS-Richtern, NS-Staatsanwälten und NS-Juristen nach 1945 und in der BRD, die aber zuvor im Nationalsozialismus privat und beruflich sozialisiert wurden, u.a. auch in Mosbach, in Baden und Württemberg. Das AG MOS verweigert zudem bisher Stellungnahmen zu den NS-Justizverbrechen, sowohl zu den eigenen institutionellen NS-Verbrechen des Amtsgericht Mosbach als auch zu den NS-Massenmordverbrechen in der Mosbacher Region.
Das Amtsgericht Mosbach verweigert zudem bisher Stellungnahmen zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg (1966 bis 1978) Hans Filbinger, der historisch nachgewiesen vor 1945 als Nazi-Blutrichter und NS-Militär-Marinerichter Nazi-Justizmorde als Todesurteile mitbewirkt, veranlasst bzw. ausgesprochen hatte und dazu dann nach 1945 öffentlich zum Ausdruck brachte, dass "DAS", was damals Recht gewesen sei, heute nicht Unrecht sein könne.
Das Amtsgericht Mosbach verweigert bisher Stellungnahmen zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg (2005 bis 2010) und Juristen Günther Oettinger, der seinen Amtsvorgänger Hans Filbinger, während seiner eigenen Filbinger-Trauerrede im April 2007 öffentlich zum angeblichen Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus zu verklären und zu stilisieren versucht hatte. Und dies sowohl in der eigenen juristischen NS-Aufarbeitung nach 1945 als auch in den Thematisierungen dieser NS-Sachverhalte innerhalb der eigenen NS-Öffentlichkeitsarbeit des AG MOS.
1.1 Expertise der Expertise der forensischen familienpsychologischen sachverständigen Gutachterin MA Antje C. Wieck aus Kitzingen zur Aufarbeitung von NS-Verbrechen und NS-Unrecht in der NS-Vergangenheitsbewältigung
Die HIER fallverantwortliche Richterin beim Amtsgericht Mosbach Marina Hess verfügt HIER unter 6F 9/22 und 6F 202/21 am 17.08.2022 EXPLIZIT, dass die gerichtlich beauftragte familienpsychologische Forensische Sachverständige für Familienrecht MA Antje C. Wieck, Praxis für KINDER- UND JUGENDLICHENPSYCHOTHERAPIE, Moltkestr. 2, 97318 Kitzingen, eine INHALTLICHE Sachverständigen-Auseinandersetzung mit der Dokumentations-Website "nationalsozialismus-in-mosbach.de" des Kindsvaters, Beschwerdeführers und Nazi-Jägers Bernd Michael Uhl durchführen solle (Siehe im Folgenden!), die diese Sachverständige Gutachterin HIER ABER AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im anhängigen Verfahrenskomplex während ihren zwei gerichtlich bestellten Sachverständigengutachten von 2022 bis 2024 DANN ÜBERHAUPT NICHT durchführt.
UND DIES HIER EXPLIZIT AUCH NICHT bzgl. der DARIN KONKRET thematisierten nationalsozialistischen Verbrechen bis 1945 und deren juristischen, politischen und zivilgesellschaftlichen Aufarbeitungen in der NS-Vergangenheitsbewältigung seit 1945, insbesondere HIER auch in der lokalen-regionalen Fall- und Verfahrenszuständigkeit für Mosbach und für den Neckar-Odenwaldkreis.
Die HIER fallverantwortliche Richterin beim Amtsgericht Mosbach Marina Hess verfügt HIER unter 6F 9/22 und 6F 202/21 am 17.08.2022 EXPLIZIT bei der von ihr selbst gerichtlich beauftragten familienpsychologischen Forensischen Sachverständigen für Familienrecht MA Antje C. Wieck, Praxis für KINDER- UND JUGENDLICHENPSYCHOTHERAPIE, Moltkestr. 2, 97318 Kitzingen eine Sachverständigen-Begutachtung bezüglich "der Notwendigkeit einer psychiatrischen Begutachtung" des Kindsvaters, Beschwerdeführers und Nazi-Jägers Bernd Michael Uhl "zur Beurteilung seiner Erziehungsfähigkeit" (Siehe im Folgenden!). UND DIES NACHDEM UNMITTELBAR ZUVOR das erste gerichtlich beauftragte familienpsychologische Gutachten vom 07.04.2022 unter 6F 202/21 und 6F 9/22 sich für den perspektivischen Verbleib des damals anderthalb Jahre alten Kindes beim Kindsvater ausspricht. HIERBEI unterstellt die fallverantwortliche Mosbacher Amts-Familienrichterin Marina Hess im familienrechtlichen Zivilprozess dem Kindsvater, Beschwerdeführer und Bernd Michael Uhl eine mögliche angebliche psychische Erkrankung und eine damit einhergehende eingeschränkte Erziehungsfähigkeit auf Grund seiner konkreten Nazi-Jäger-Eingaben zu den seinerseits beim Amtsgericht Mosbach beantragten juristischen Aufarbeitungen von konkreten Tatbeteiligungen an NS-Verbrechen und NS-Unrecht 1933-1945 und deren mangelhaften juristischen Aufarbeitungen seitens der deutschen Nachkriegsjustiz seit 1945. UND DIES HIER insbesondere auch in der lokalen-regionalen Fall- und Verfahrenszuständigkeit bei NS-Verbrechen und NS-Unrecht in Mosbach und im Neckar-Odenwaldkreis sowie bezüglich dem Versagen der Mosbacher Nachkriegsjustiz seit 1945 bei deren juristischen Aufarbeitungen.
SIEHE DAZU AUCH:
- Rechtsanwaltlicher und gerichtlicher Umgang mit Sachverständigen-Gutachten in Fallbegleitungen - Verfahrensführungen - Verfahrensbearbeitungen- Verfahrensbegleitungen durch RECHTSANWALT Simon Sommer >>>
- Verfahrensinhaltliche und prozessuale Benachteiligungen des Mandanten von Rechtsanwalt Simon Sommer beim Amtsgericht Mosbach unter 6F 211/21, 6F 202/21, 6F 9/22, 6F 2/23, 6F 2/22, etc. sowie unter amtsseitigen KV-BS-Sonderbänden zu Nationalsozialismus, Rechtsextremismus, Rassismus >>>
Siehe auch:
- HISTORISCHES: NS-Widerstand >>>
- HISTORISCHES: Nationalsozialismus in Mosbach - Baden >>>
- AKTUELLES: NS- und Rechtsextremismus-Verfahren beim Amtsgericht Mosbach >>>
- AKTUELLES: NS-Widerstand >>>
- NS-Vergangenheitsbewältigung >>>
- Schlussstrichdebatte zum Nationalsozialismus >>>
- HISTORISCHES & AKTUELLES: Nazi-Terror-Verfolgungs- und Vernichtungsjustiz >>>
- NS-Verfahren und -Prozesse des 21. Jahrhunderts >>>
2. Online Artikel zum NS-WIDERSTAND und zum Widerstand gegen Bestrebungen in und aus der Neuen Rechten
Rede: Gedenken zum 70. Jahrestag des 20. Juli 1944
Berlin, 20. Juli 2014
Bundespräsident Joachim Gauck hat am 20. Juli an der Feierstunde der Bundesregierung und der Stiftung 20. Juli 1944 teilgenommen. Im Bendlerblock hielt er eine Rede zum Gedenken an die Opfer des Widerstands gegen die Nationalsozialisten: "Widerstand ist nicht, er wird. Er mag mit leisen Zweifeln beginnen an dem, was man einmal für wahr gehalten, was man einmal geglaubt hat. Von einem bestimmten Punkt an braucht Widerstand jedoch den Mut zum Handeln."
Bundespräsident Joachim Gauck hält eine Gedenkrede bei der Feierstunde der Bundesregierung und der Stiftung 20. Juli 1944 im Bendlerblock in Berlin
Heute blicken wir zurück auf einen bedeutenden Tag in der deutschen Geschichte. In der Zeit, als Deutschland Europa mit Krieg und Leid überzog, schien ein Licht der Hoffnung und des Anstands auf. Dieses Licht schien auf, als vor 70 Jahren Männer einen mutigen Schritt wagten, den sie selbst Jahre zuvor noch für undenkbar gehalten hätten: Sie richteten sich entschlossen gegen die eigenen Machthaber, gegen die Führung des nationalsozialistischen Staates. Sie handelten mit dem klaren Ziel, den Diktator zu töten und die Herrschaft von Gewalt und Willkür zu beenden.
Wir alle wissen, dass die Verschwörer dieses Ziel nicht erreichen konnten: Hitler überlebte den Bombenanschlag vom 20. Juli 1944 und konnte seine brutale Terrorherrschaft und auch den Krieg fortsetzen. Claus Graf Schenk von Stauffenberg, Friedrich Olbricht, Albrecht Ritter Merz von Quirnheim, Werner von Haeften und Ludwig Beck wurden am selben Tag erschossen. Ungezählte fielen in den folgenden Wochen und Monaten einer gnadenlosen Verfolgung zum Opfer.
War nun damit das Attentat gescheitert? War der mutige Einsatz der Männer und Frauen, derer wir heute gedenken, vergeblich? Wie bemessen wir überhaupt Erfolg und Scheitern in der Geschichte? Der zeitliche Abstand von 70 Jahren sollte uns Anlass sein, auch darüber nachzudenken.
Die Männer des 20. Juli wollten Hitler beseitigen und eine neue Ordnung errichten. Sie hatten ein Netzwerk geschaffen, das tatsächlich – wäre das Attentat gelungen – fähig gewesen wäre, militärisch, politisch und personell eine Alternative zum NS-Staat zu errichten. Zugleich aber waren sie sich auch bewusst, dass es darum ging, ein in die Welt hinaus und in die Zukunft hineinwirkendes Zeichen zu setzen. Niemand hat dies besser formuliert als Henning von Tresckow, als er von dem unter Einsatz des Lebens zu wagenden entscheidenden Wurf sprach – jenem Zeichen des deutschen Widerstands, neben dem in Tresckows Worten alles andere gleichgültig sei. Wenn schon das andere Deutschland nicht gestaltet werden konnte, so sollte doch aller Welt gezeigt werden, dass es existiere. Damit überzeugte er auch seinen Mitstreiter Claus Graf Schenk von Stauffenberg im Sommer 1944 von der absoluten Notwendigkeit des Handelns gegen Hitler.
Wenn aber das der Maßstab ist: das Wirken in die Welt hinaus und in die Zukunft hinein, dann sollten wir zumindest sehr vorsichtig sein mit Begriffen wie Scheitern oder Misserfolg. Denn der 20. Juli und all die anderen Versuche des Widerstands gegen Hitler und das NS-Regime, sie haben nicht nur eine faktische Bedeutung, sondern auch eine sehr klare moralische – und bei genauer Betrachtung natürlich auch eine eminent politische. Aus diesem Erbe konnte die neu gegründete Bundesrepublik, als sie – allerdings verspätet – die Bedeutung des militärischen Widerstands begriffen hatte, Legitimation schöpfen. Und es ist dieses Erbe, das mich heute auch befähigt zu sagen: Ich bin stolz auf eine Bundeswehr, die sich nicht auf obrigkeitsstaatliche Traditionen beruft, sondern auf Widerstand gegen das Unrecht. Ja, von diesem moralischen Erbe zehrt unser Land bis heute.
Und trotzdem hat es einige Zeit gedauert, bis dieses Erbe auch in der Mitte der Gesellschaft angenommen wurde: Noch in den 1950er Jahren gab es in der jungen Bundesrepublik viele, die die Männer um Stauffenberg weiterhin als Landesverräter diffamierten. Oder solche, die ihnen vorwarfen, sie hätten nur angesichts der sich abzeichnenden Katastrophe gehandelt. Wie ungeheuerlich: Früher Angepasste schwangen sich zu einem ungerechten und verleumderischen Urteil über jene Wenigen auf, die ihren Einsatz gegen die Diktatur mit dem Leben bezahlt haben. So wurden die Hinterbliebenen und Familien der Verschwörer noch lange ausgegrenzt und auch materiell benachteiligt. Zum antifaschistischen Mythos des zweiten deutschen Staates, der DDR, gehörte wiederum, dass fast ausschließlich der kommunistische Widerstand unter weitgehender Ausblendung anderer Widerstandsgruppen gegen das NS-Regime überliefert und in den Schulen gelehrt wurde.
Natürlich, es hatte lange gedauert, bis sich Teile der Eliten im nationalsozialistischen Deutschland entschlossen gegen Hitler gewendet hatten. Dabei zeigte das Dritte Reich doch sein wahres Gesicht bereits von Anbeginn an: Victor Klemperer, der später die nationalsozialistische Sprache so gründlich analysieren sollte, notierte am 10. März 1933 in sein Tagebuch: Was ich bis zum Wahlsonntag, 5. März, Terror nannte, war mildes Prélude.
Mit der nationalsozialistischen Herrschaft trat Gefolgschaft an die Stelle von Bürgerschaft, und Diktatur trat an die Stelle von Demokratie. Schon nach den ersten Mordserien an politischen Gegnern hätte es eigentlich keinen Zweifel mehr daran geben dürfen, dass dieser Staat ein Unrechtsregime war, in dem nur der Wille des Diktators galt. Und doch taten sich die konservativen und militärischen Eliten schwer, einen kritischeren Blick auf den nationalsozialistischen Staat zu entwickeln, und noch schwerer damit, zu handeln. Nur einige wenige – es gab sie – entschlossen sich zu frühem Widerstand.
Aber die Reichswehr hatte in den Jahren vor 1933 dazu beigetragen, die freiheitlich-demokratische Ordnung von Weimar zu untergraben oder gar auszuhöhlen. Der ihr zugedachten Rolle, nämlich die Verfassung zu schützen, dieser Rolle war sie als faktischer Staat im Staate nicht nachgekommen – oder jedenfalls nur sehr unzureichend. Zu viele ihrer Angehörigen sympathisierten mit den antidemokratischen Kräften. Und viele, auch Stauffenberg, verbanden anfänglich Hoffnungen mit dem Nationalsozialismus. Wie die konservativen Eliten waren viele Militärs in einer Weise staats- und deutschland-gläubig, die wir uns heute kaum mehr vorstellen können. Dass die Soldaten vom 2. August 1934 an einen persönlichen Eid auf den Diktator, und damit Hitler gegenüber unbedingten Gehorsam geschworen hatten, das machte militärischen Widerstand noch schwieriger. Die Männer und Frauen des 20. Juli fanden einen Ausweg aus ihrer eigenen Verstrickung, indem sie sich entschlossen, ihrem Gewissen zu folgen.
Eine Gewissensentscheidung mit einer ausgeprägt politischen Dimension. Gleich der erste Satz der im Umfeld Stauffenbergs entworfenen Regierungserklärung bekannte sich zum Rechtsstaat: Erste Aufgabe ist die Wiederherstellung der vollkommenen Majestät des Rechts. Der wohl leuchtendste Ausdruck der Überzeugungen aber findet sich weiter hinten in jenem Dokument. Dort heißt es: Die zerbrochene Freiheit des Geistes, des Gewissens, des Glaubens und der Meinung wird wiederhergestellt.
Widerstand ist nicht, Wiederstand wird. Er mag mit leisen Zweifeln beginnen an dem, was man einmal für wahr gehalten, was man einmal geglaubt hat. Von einem bestimmten Punkt an braucht Widerstand jedoch Mut zum Handeln. Stauffenberg, Tresckow und ihre Mitstreiter haben namentlich unter dem Eindruck der Verbrechen an der Zivilbevölkerung und des Massenmordes an den Juden in Europa letzte Bedenken und die vermeintlichen Bindungen an den Eid hinter sich gelassen und sie haben, um Würde, Recht und Zukunft zu gewinnen, ihr Leben eingesetzt und es verloren. Niemand von uns weiß, ob wir gewagt hätten, so zu handeln für jene universellen Werte, die weit über das Bekenntnis zur Nation hinausgehen: die Würde des Menschen und die Herrschaft des Rechts. Niemand weiß es.
In wenigen Tagen werde ich an der Eröffnung einer Ausstellung zum 70. Jahrestag des Warschauer Aufstandes teilnehmen, hier in Berlin. Damals erhoben sich Polen gegen die deutschen Besatzer, obwohl sie nicht wissen konnten, ob der Aufstand gelingen würde. Viele ahnten schon, dass er scheitern musste. Und doch wollten sie ein Zeichen setzen. Ein Zeichen, dass der Sieg über die Ohnmacht mehr zählt als der militärische Sieg. Der Aufstand wurde niedergeschlagen und 170.000 Warschauer starben. Ihnen ging es um jene Würde, die in diesem Versuch der Selbstbefreiung lag. Wir stehen heute staunend und voller Respekt davor, dass all diesen Menschen ihre Werte am Ende sogar mehr bedeuteten als ihr Leben – genau wie den Männern des 20. Juli.
In diesem Jahr erinnern wir uns in Deutschland und in ganz Europa auch an ein anderes Attentat – an die Schüsse eines jungen bosnischen Serben auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger vor 100 Jahren. Wenn wir über die Ereignisse des Jahres 1914 nachdenken, die auf das Attentat von Sarajevo folgten – an die vermeintliche Handlungslogik eines übersteigerten und von Bedrohungsobsessionen zusätzlich befeuerten Nationalismus, an die blinde Kriegseuphorie in den Hauptstädten des Kontinents – dann wird uns erneut bewusst, was wir nicht wollen. Der 20. Juli allerdings erinnert uns an das, was wir wollen, was wir können möchten und was wir leben sollten: mutig zu unseren Werten zu stehen. Dazu gehört, dass wir uns nicht mitschuldig machen, wenn anderen Unrecht geschieht.
Natürlich: Es ist leicht, aus bequemem Abstand zu den damaligen Ereignissen diesen Satz auszusprechen. Und doch kennt jeder und jede Einzelne von uns jene innere Frage, auf die es eine leichte und gleichzeitig wahrhaftige Antwort wohl nur schwer oder gar nicht geben kann - noch einmal: Wie würde ich mich verhalten, wenn ich wüsste, dass der Preis meines Handelns Gefängnis, Folter oder gar das Ende meines eigenen Lebens sein kann? Brächte ich diesen Mut auf, und besäße ich ihn auch noch in der entscheidenden Stunde?
Oft folgt aus dieser Selbstbefragung der Selbstzweifel und damit etwas enorm Gefährliches: Da man sich nicht vorstellen kann, das letzte Opfer zu bringen, verzichtet man darauf zu erkennen, welches Maß an Opposition oder Widerstand uns, dem Einzelnen, der Einzelnen möglich ist. Aber aus der Erkenntnis, dass man sich nicht geschaffen fühlt, sein Leben für das Fortleben von Werten zu opfern, darf man niemals folgern, dass man nichts tun kann.
Heute stehen wir nun nicht vor der größten aller Alternativen. Im demokratischen Deutschland müssen wir nicht die Fragen beantworten, die jene abzuwägen hatten, die im Widerstand gegen die Diktatur standen. Und so sollten wir uns durch die Lichtgestalten der Geschichte weder überfordern noch paralysieren lassen. Auch in der Demokratie gibt es Werte, für die wir eintreten und für die wir leben, für die wir Verantwortung übernehmen können – jeder auf seine Weise und jede an ihrer Stelle. Jede und jeder von uns kann zum Wesentlichen des eigenen Lebens vordringen und sich die Frage stellen: Wie werde ich zu dem Menschen, der ich sein kann? Tue ich, was ich kann? Lasse ich mein Gewissen mitentscheiden? Warte ich ab, ob das Humanum in Politik und Gesellschaft gewahrt wird, oder übernehme ich meinen Teil an Verantwortung, es zu bewahren für die Gegenwart und für unsere Zukunft?
Martin Niemöller stellte sich ein Jahr nach Kriegsende in einem Vortrag die Frage, was entscheidend sei, wenn man nicht die Freiheit hoffnungslos preisgeben will, die Freiheit, die keine Macht der Welt wieder herstellen kann. Seine Antwort war ein Wort: Verantwortung, im Sinne letzter persönlicher Verantwortung, die für Niemöller einen Weg ins Freie, wie er es nannte, erst möglich machte. Denn die wichtigste Mahnung an uns alle, die wir heute in einem freien und friedlichen Deutschland leben, ist: Rechtsstaat muss immer Rechtsstaat bleiben, Demokratie muss immer Demokratie, Menschenwürde muss immer Menschenwürde bleiben. Wir tragen Verantwortung für die Freiheit, die wir haben und unbedingt behalten wollen.
Eines lehrt uns die Erinnerung an den 20. Juli 1944 gewiss: Wir haben eine Wahl zwischen Handeln und Untätigkeit, auch zwischen Reden und Schweigen. Das zeigt uns der 20. Juli, und das zeigen auch der 17. Juni 1953 und die Ereignisse des Jahres 1989, an die wir in diesem Jahr nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa erinnern.
Und wir haben auch eine Wahl zwischen Erinnern und Vergessen. Deshalb möchte ich heute daran erinnern, dass es eine mutige Einzelne war – Eva Olbricht, die Witwe des hier erschossenen Generals – die 1952 den Grundstein für das Ehrenmal in diesem Ehrenhof legte. Es hat lange gedauert, bis zur Erinnerung an den 20. Juli auch der gebührende Respekt vor dem Mut seiner Protagonisten in der Breite der Gesellschaft hinzutrat. Und so spiegelt die Geschichte der Erinnerung an die mutige Tat auch den besonderen Weg, den guten Weg einer bundesdeutschen Gesellschaft wider, die Gewissheiten hinterfragt und sich auch der schmerzhaften Vergangenheit stellt.
In der Bundesrepublik Deutschland bewahren wir dem gesamten Widerstand ein ehrendes Gedenken, dem mutiger Einzelner wie auch dem kommunistischen Widerstand – aus tiefer Achtung und mit hohem Respekt vor der Leistung aller Mutigen, die zu widerstehen vermochten, als die Masse in Anpassung verharrte.
Das alles steht uns an diesem Tag besonders klar vor Augen. Und wir empfinden eine Verpflichtung, nämlich uns der Frage zu stellen, welche Brückenschläge ins Heute überhaupt möglich sind, um auch junge Leute für die mutigen Männer und Frauen des 20. Juli zu interessieren, obwohl sie ja selbst nie Diktatur kennenlernen mussten.
So gilt an dieser Stelle mein ganz besonderer Dank der Stiftung 20. Juli 1944 und all jenen, die sich bis heute engagiert haben. Sie haben nie nachgelassen in Ihrem Bemühen, die Botschaften und die Werte, für die die Frauen und Männer des 20. Juli stehen, in die Mitte der Gesellschaft hineinzutragen und dort immer fester zu verankern.
Der Gedenkstätte Deutscher Widerstand spreche ich meinen aufrichtigen Dank dafür aus, dass sie einen Begegnungs- und Lernort für diesen Abschnitt der deutschen Geschichte bietet. Sie macht das ganze Spektrum des Widerstands gegen Hitler und gegen ein menschenverachtendes System sichtbar. Und sie gibt zahlreichen Frauen und Männern, die zuvor vielen unbekannt geblieben waren, einen Namen und ein Gesicht.
Auch erstaunlich viele junge Menschen riskierten im Widerstand ihr Leben. Die neue Ausstellung in den Räumen dieser Gedenkstätte dokumentiert einen Satz, dessen Verbreitung durch Flugblätter für seinen Verfasser, den 17-jährigen Helmuth Hübner, das Todesurteil bedeutete. Der Satz lautet: Lasst euch euren freien Willen, das kostbarste, was ihr besitzt, nicht nehmen.
Der deutsche Widerstand gegen den NS-Staat und seine Verbrechen war vielfältig und speiste sich aus unterschiedlichen Quellen:
Es gab jene, die sich für den Frieden einsetzten,
es gab die, die sich für Verfolgte einsetzten, ihnen halfen oder sie versteckten,
jene, die sich mit Unterdrückung oder Unfreiheit nicht abfanden,
und jene, die sich schon über einen Neuanfang Gedanken machten.
Sie hatten für diese Haltung Gründe, die aus ihrem religiösen Glauben, aus tiefer politischer Überzeugung oder aus ihrem eigenen Gewissen kamen.
All die verschiedenen Formen des Widerstands – neben der aufopferungsvollen Auflehnung bis hin zum bewaffneten Kampf sind ja auch Abständigkeit, Dissidenz und Opposition Formen eines widerständigen Lebens. Und nicht vergessen wollen wir auch: Neben den großen gab es die kleinen Taten, die nicht minder wichtig waren. Wer einem Juden nur einen Tag Schutz und Zuflucht bot, wer ein verbotenes Buch weitergab, wer einem Zwangsarbeiter ein Stück Brot zusteckte, der wirkte gegen die Diktatur.
Ob jemand als Christ, als Sozialist oder als Angehöriger des Militärs handelte – es war die Opposition gegen Hitler und ein mörderisches Regime, die den Kreisauer Kreis, die Weiße Rose, die Rote Kapelle, die Bekennende Kirche, aber auch Einzelne, wie Georg Elser, und die unbekannt Gebliebenen miteinander verband. Wer Widerstand wagte, blieb damals allein in der Gesellschaft. Wer jedoch entdeckt wurde, zahlte den Preis des Widerstands nicht alleine: Die Familien litten mit, unter perfider Sippenhaft, auch unter späterer Verunglimpfung.
Stauffenberg, Tresckow und ihre Mitstreiter ehren wir heute auch stellvertretend für alle diese anderen, die widerständig waren oder die unter den Folgen des aufrechten Widerstands zu leiden hatten. Sie, die Männer und Frauen des 20. Juli, wagten das Letzte für ein Land, das sie liebten, für ein Land, das sie bis zum Letzten gegen seine Feinde im Inneren verteidigten. Wir, die heute Lebenden, sollten nicht beim Staunen über ihre mutige Tat stehenbleiben. Wir ehren sie und folgen ihnen nur, wenn wir uns fragen: Was kann ich tun, um fähig und bereit zu sein zu einem Leben in Verantwortung für dieses Land und seine Demokratie. Dafür zu leben und notfalls zu kämpfen, für seine humanen Werte, die es mit seinen Nachbarn verbindet, und immer wieder für das, was im Gründungsdokument unseres Landes so einfach, so groß und so stark beschrieben ist: die Würde des Menschen.
Zum Thema
Gedenken zum 70. Jahrestag des 20. Juli 1944
PDF, Datei ist nicht barrierefrei, 89KB
https://www.bundespraesident.de/
Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand
... ist ein Ort der Erinnerung, der politischen Bildungsarbeit, des aktiven Lernens, der Dokumentation und der Forschung. Mit einer umfangreichen Dauerausstellung, wechselnden Sonderausstellungen und einem vielfältigen Veranstaltungs- und Veröffentlichungsangebot informiert sie über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die Gedenkstätte will zeigen, wie sich einzelne Menschen und Gruppen in den Jahren 1933 bis 1945 gegen die nationalsozialistische Diktatur gewehrt und ihre Handlungsspielräume genutzt haben.
https://www.gdw-berlin.de/home/
+++
Politische Bücher:
Nicht nur der Warschauer Aufstand
Von René Schlott
04.11.2025, 09:27Lesezeit: 5 Min.
Niedergeschlagener Aufstand: Stoßtrupp der Waffen-SS im Warschauer Ghetto im April oder Mai 1943
Der jüdische Widerstand in Ghettos und Vernichtungslagern ist weitgehend vergessen. Stephan Lehnstaedt setzt ihm ein unheroisches Denkmal.
Im Februar 1942 berichtete ein Mann namens Szlamek Winer im Warschauer Ghetto über die massenhafte Ermordung westpolnischer Juden durch den Einsatz von speziell konstruierten Gaswagen, die von einem ehemaligen Gutshaus in Kulmhof in einen nahegelegenen Wald fuhren. Die auf der Ladefläche der Lastwagen eingepferchten Menschen wurden dabei durch die ins Wageninnere eingeleiteten Motorabgase qualvoll erstickt. Der jüdische Pole Winer war von den Deutschen gezwungen worden, die Leichen der Ermordeten in Massengräbern zu bestatten. Nachdem ihm die Flucht aus Kulmhof gelungen war, suchte Winer im Warschauer Ghetto das jüdische Untergrundarchiv Oneg Schabbat auf, um Zeugnis von dem Massenmord abzulegen und seine Glaubensgenossen zu warnen. Anfang April 1942 dann berichtete Winer aus dem ostpolnischen Zamość über Massenmorde im nahegelegenen Vernichtungslager Belzec nach Warschau. Kurz darauf verlieren sich seine Spuren und es wird angenommen, dass der mutige Zeitzeuge Winer selbst in Belzec ermordet wurde...
https://www.faz.net/
NS-Freiheitskämpferin wird mit Wandbild an Wohnhaus geehrt
Berlin & Brandenburg
09.10.2025, 14:43 Uhr
(Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa)
Maria Terwiel leistete Widerstand gegen die Nationalsozialisten und wurde von ihnen ermordet. Ein Wandbild soll nun an sie erinnern.
Berlin (dpa/bb) - An die NS-Widerstandskämpferin Maria Terwiel erinnert nun ein Wandbild in der Paul-Hertz-Siedlung in Berlin-Charlottenburg. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Helmut Himpel verteilte Terwiel Anfang der 1940er-Jahre Hunderte Flugblätter, die gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten Stellung bezogen, wie die Gedenkstätte Deutscher Widerstand mitteilte. Zudem unterstützte Terwiel verfolgte Juden mit Lebensmittelmarken und Ausweisen.
Im September 1942 wurde Maria Terwiel festgenommen und wenige Monate später zum Tode verurteilt. Sie wurde am 5. August 1943 im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee hingerichtet.
Maria Terwiel studierte Rechtswissenschaften und durfte wegen der jüdischen Abstammung ihrer Mutter das Examen nicht ablegen. Auch ihren Verlobten durfte sie aus "rassischen Gründen" nicht heiraten, wie die Gedenkstätte Deutscher Widerstand schreibt.
"Ich habe absolut keine Angst vor dem Tode"
Die NS-Widerstandskämpferin selbst war gläubige Katholikin, in einem Brief aus der Haft schrieb sie im Januar 1943 an ihre Geschwister: "Ich habe absolut keine Angst vor dem Tode und schon mal gar nicht vor der göttlichen Gerechtigkeit, denn die brauchen wir jedenfalls nicht zu fürchten."
Ihre Worte wurden nun in dem Wandgemälde verewigt, welches von einem Künstlerkollektiv in Zusammenarbeit mit Schülern der Anna-Freud-Schule gestaltet wurde. Es befindet sich an einem Wohnhaus in der Theodor-Hertz-Siedlung, diese liegt unweit der heutigen Gedenkstätte Plötzensee, dem Todesort von Maria Terwiel.
Das Wandbild befindet sich unweit von der Gedenkstätte Plötzensee
In den 1960er Jahren wurden in dieser Siedlung viele Straßen nach Menschen aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus benannt, wie die Gedenkstätte Deutscher Widerstand mitteilte.
Maria Terwiel war Teil eines Widerstandsnetzwerkes, das die Nationalsozialisten als "Rote Kapelle" bezeichneten. Das war ein "loses, eher informelles Netzwerk" aus Gegnern des Nationalsozialismus, wie es die Bundeszentrale für politische Bildung nennt. Im Jahr 1941 sollen führende Mitglieder den sowjetischen Nachrichtendienst vor den Angriffsplänen Hitlers auf die Sowjetunion gewarnt haben. Josef Stalin selbst soll dem nicht geglaubt haben.
In der Lietzenburger Straße 72, wo Maria Terwiel seit 1940 mit ihrem Verlobten lebte, erinnert ein Stolperstein an die mutige Frau. Stolpersteine sind kleine Gedenktafeln aus Messing im Boden, die an das Schicksal von Menschen erinnern, die während der NS-Zeit verfolgt, deportiert oder ermordet wurden.
https://www.n-tv.de
Im September 1943 wurde der Weimarer Bürger Kurt Nehrling wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt
Buchenwald Memorial | Gedenkstätte Buchenwald
03.09.2025
Im September 1943 wurde der Weimarer Bürger Kurt Nehrling wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt. Er hatte an seinem Arbeitsplatz Kritik am NS-Regime geübt. Gemeinsam mit seiner Frau Hedwig führte er ein Wäschegeschäft in Weimar am Zeppelinplatz, welches wärend der NS-Diktatur zum Treffpunkt für Sozialdemokraten wurde. Unser digitaler Stadführer "Weimar im Nationalsozialismus" macht (unter anderem) diese Orte des Widerstandes wieder sichtbar:
https://weimar-im-ns.pulse.ly/v3i6xlxlvn
#WeimarimNationalsozialismus #Widerstand #Zivilcourage #Erinnerungskultur #GegenVergessen #NieWieder
FACEBOOK : Buchenwald Memorial | Gedenkstätte Buchenwald >>>
Karl-Heinz Voigt hat heute seinen 100. Geburtstag
Thüringer Verband der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschisten
31.08.2025
Unser hochgeschätzter Kamerad Karl-Heinz Voigt hat heute seinen 100. Geburtstag gefeiert und wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, ihm neben vielen anderen persönlich zu gratulieren und mit ihm zu feiern.
Karl-Heinz ist ein wichtiger Zeitzeugen der NS-Zeit und als Sohn, des KPD-Landtagsabgeordneten, Verfolgten des Naziregimes und ehemaligen Buchenwald-Häftlings Arno Voigt, schon immer ein Kämpfer gegen Faschismus und Neonazismus.
Er kämpft bis heute dafür, die Verbrechen der Nazis nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Lieber Karl-Heinz,
anlässlich Deines 100. Geburtstags wünschen Dir die Mitglieder des Thüringer VVdN-BdA für die Zukunft alles erdenklich Gute, viel Glück und vor allem Gesundheit.
Wir danken Dir für Dein unermüdliches Engagement zur Erfüllung des Schwurs von Buchenwald.
Wir danken Dir für die unzähligen Stunden, in denen Du Dein Wissen und Deine Erfahrungen weitergegeben hast.
Wir danken Dir auch für die vielen Ideen, aus denen Projekte für unseren Verband entstanden sind.
Wir danken Dir für Deine uneingeschränkte Solidarität, vor allem auch mit dem Volk von Cuba.
Wir wünschen Dir noch eine schöne Zeit!
FACEBOOK: Thüringer Verband der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschisten >>>
In Luxemburg findet der Generalstreik aus Protest gegen die Zwangsrekrutierung in der Wehrmacht statt
Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert
31.08.2025
📅 Am 31. August reagierte die Luxemburger Bevölkerung auf die tags zuvor erfolgte Ankündigung der Zwangsrekrutierung junger Luxemburger in die deutsche Wehrmacht. In der Stadt Wiltz legten die Arbeiter der Lederfabrik „Ideal“ um 7 Uhr morgens ihre Arbeit nieder. Diesem Beispiel folgten binnen weniger Stunden zahlreiche Betriebe, Verwaltungen, Schulen und landwirtschaftliche Betriebe.
✊ Diese landesweiten Streiks waren eine der bedeutendsten Widerstandsaktionen im besetzten Westeuropa, was die NS-Besatzungsmacht mit äußerster Härte bestrafte. Gauleiter Gustav Simon verhängte den Ausnahmezustand und ließ zwischen dem 2. und dem 9. September 1942 insgesamt 21 Männer hinrichten, unter ihnen Lehrer, Arbeiter, Postbeamte und Eisenbahner.
📜 Viele der Verhafteten wurden zunächst in das KZ Hinzert überstellt. Dort erfolgten zahlreiche Erschießungen unmittelbar nach der Urteilsverkündung. Am 2. oder 3. September wurden die ersten beiden Verurteilten, Nicolas Müller und Michel Worré, erschossen. Auch vier Lehrer aus Wiltz sowie mehrere Stahlarbeiter wurden in Hinzert hingerichtet.
Der einzige deutsche Staatsbürger unter den Ermordeten, Hans Adam, wurde in Köln-Klingelpütz als „Verräter“ mit dem Fallbeil enthauptet.
🕯️ Der Generalstreik von 1942 steht für den Mut, sich einer totalitären Herrschaft offen zu widersetzen. Die 21 Ermordeten sind bis heute Symbole für selbstlosen Widerstand und die Verteidigung von Freiheit und Menschenwürde.
#Generalstreik1942 #Luxemburg #Widerstand #Erinnerungskultur #NSZeit #KZHinzert #Geschichte #Freiheit #Menschenwürde #NieWieder
FACEBOOK : Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert >>>
Das Reichskriegsgericht 1936 bis 1945
Nationalsozialistische Militärjustiz und die Bekämpfung des Widerstands in Europa
Gedenkstätte Deutscher Widerstand
28.08.2025
Die Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand und die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt laden herzlich zur Eröffnung der Wanderausstellung ein:
Das Reichskriegsgericht 1936 bis 1945
Nationalsozialistische Militärjustiz und die Bekämpfung des Widerstands in Europa
Eine Wanderausstellung der Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle (Saale) mit Partnereinrichtungen in Polen, Frankreich, Norwegen, Belgien und Tschechien
Montag, 1. September 2025, 16 Uhr
St. Matthäus-Kirche, Matthäikirchplatz, 10785 Berlin
Es sprechen:
Staatsminister Rainer Robra, Chef der Staatskanzlei und Minister für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt,
I.E. Laila Stenseng, Botschafterin des Königreichs Norwegen und
Dr. Lydia Arantes, Nachfahrin eines Verurteilten des Reichskriegsgerichts
Anschließend besteht die Möglichkeit zur Besichtigung der Ausstellung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Stauffenbergstraße 13-14 (Eingang über den Ehrenhof), 10785 Berlin.
Die Ausstellung wird vom 01.09.2025 – 10.01.2026 in der Sonderausstellungsfläche der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Erste Etage, gezeigt.
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Wir bitten um Anmeldung bis zum 24. August 2025 per E-Mail: veranstaltung@gdw-berlin.de.
#GedenkstätteDeutscherWiderstand #Reichskriegsgericht #NSMilitärjustiz Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle
FACEBOOK : Gedenkstätte Deutscher Widerstand >>>
Eröffnung der Wanderausstellung „Einige waren Nachbarn - Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ ist am 10. August 2025 um 14.00 Uhr mit geführtem Rundgang.
Gedenkstätte KZ Osthofen
04.08.2025
In dem Zeitraum vom 10. August 2025 bis zum 12. Oktober 2025 ist die Wanderausstellung „Einige waren Nachbarn – Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ in der Gedenkstätte KZ Osthofen zu sehen. Die Wanderausstellung des United States Holocaust Memorial Museum wird durch den Regionalenteil „Für alle sichtbar…“ der Gedenkstätte KZ Osthofen ergänzt. Die Ausstellung befasst sich mit der zentralen Frage, wie der Holocaust möglich war und beleuchtet dabei die Vielzahl von Motiven und Spannungen, die individuelle Handlungsoptionen beeinflussten. Alternativen zu Kollaboration und Täterschaft werden ebenfalls aufgezeigt.
Zur Wanderausstellung „Einige waren Nachbarn – Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ und der Regionalisierung „Für alle sichtbar…“ wird am 10. August 2025 eine öffentliche Führung angeboten. Treffpunkt ist das Foyer der Gedenkstätte um 14.00 Uhr. Für angemeldete Gruppen besteht die Möglichkeit Kombi-Führungen zu buchen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Mail: info@ns-dokuzentrum-rlp.de oder unter der T.:06242-910810.
Termine für Lehrkräfte- und Multiplikator*innen-Fortbildungen zur Wanderausstellung werden auf der Homepage der Gedenkstätte bekannt geben.
Für weitere Informationen zum Inhalt, wenden Sie sich gerne an Dominik.Hook@ns-dokuzentrum-rlp.de
#nsvergangenheit #rlp #rheinlandpfalz #politische_bildung #kzosthofen #ausstellung #fortbildung #demokratiebildung #education
Gedenkstätte KZ Osthofen >>>
https://www.facebook.com/GedenkstaetteKZOsthofen >>>
„Ich wusste, was ich tat” – Früher Widerstand gegen den Nationalsozialismus
Gedenkstätte Esterwegen
03.08.2025
Die Ausstellung „Ich wusste, was ich tat” des Studienkreises Deutscher Widerstand zeigt den frühen Widerstand gegen das NS-Regime bis Mitte der 1930er Jahre, aber auch den Kampf für Demokratie und gegen eine völkisch-nationalistische Rechte in der Weimarer Republik. Sie stellt multimedial dar, wie Menschen sich in der Weimarer Republik und später unter den Bedingungen der Diktatur der NS-Bewegung entgegenstellten. Thomas Altmeyer, Wissenschaftlicher Leiter des Studienkreises, hat die Ausstellung im Mai in der Gedenkstätte Esterwegen eröffnet.
Die neue Ausstellung aus dem Jahr 2024 beinhaltet 18 Ausstellungstafeln mit Kapiteln wie „Die Weimarer Republik – Eine umkämpfte Demokratie“, „Gemeinsam! Gegen Rechts“ oder „Geheim! Widerstand im Verborgenen“. Zwei Medienstationen sowie eine Vielzahl an Biografien von Gegnerinnen und Gegnern der NS-Bewegung dienen zur Vertiefung. Unter dem Titel „Was bewegt dich?“ können sich Besucherinnen und Besucher zudem mittels QR-Codes mit der Ausstellung und deren Bedeutung für sie selbst und die Gegenwart auseinandersetzen. Der Begleitband zur Ausstellung ist in der Gedenkstätte erhältlich.
Noch bis zum 20. August ist die Ausstellung in der Gedenkstätte Esterwegen zu sehen.
Der Eintritt ist frei.
#ichwusstewasichtat #studienkreisdeutscherwiderstand #sonderausstellung #gedenkstaetteesterwegen
Gedenkstätte Esterwegen >>>
„Hilfswerk 20. Juli 1944“
Lobbyisten für NS-Opfer
16.08.2025, 22:14 Uhr
Ehrenwache an der Gedenktafel für die Opfer des 20. Juli 1944. Nach dem gescheiterten Hitler-Attentat waren an dieser Stelle, auf dem Gelände des ehemaligen Oberkommandos der Wehrmacht, mehrere Offiziere standrechtlich erschossen worden.
(Foto: Wolfgang Kumm/dpa)
Gleich nach dem Krieg fand sich das Hilfswerk für die Hinterbliebenen des 20. Juli 1944 zusammen. Rainer Volk erzählt die Geschichte eines hartnäckigen Kampfs.
Rezension von Robert Probst
Renate von Hardenberg fasste ihr Anliegen in einem Brief an Kanzler Konrad Adenauer am 21. Mai 1951 präzise und eindringlich zusammen: „Bei sehr vielen unserer Schützlinge herrscht bittere Not. Die Witwen werden vielfach mit dem Leben nicht fertig und die Kinder sind z.T. durch das furchtbare Geschehen in der Vergangenheit aus der Bahn geworfen. All dies erfordert ebenso seelische wie materielle Hilfe.“ Renate von Hardenberg agierte als Geschäftsführerin des „Hilfswerks 20. Juli 1944“, das sich um die etwa 400 Hinterbliebenen der ermordeten Widerstandskämpfer um Claus Schenk Graf von Stauffenberg kümmerte. Der Historiker und SWR-Journalist Rainer Volk hat sich der wenig bekannten Geschichte dieses Hilfswerks gewidmet, der Titel des schmalen Bandes „Von der Missachtung zur Anerkennung des Widerstands“ zeigt bereits das Spannungsfeld auf, in dem sich die Beteiligten in der frühen Bundesrepublik bewegten.
Volk hat sich durch viele Archive gearbeitet und eine spannende Geschichte über ein Randphänomen der Widerstandsforschung geschrieben: wie sich nach dem Zweiten Weltkrieg rasch ein „winziges Häuflein“ zusammenfand, um sich um die Hinterbliebenen der NS-Mordorgie nach dem Aufstand vom 20. Juli zu kümmern; wie improvisiert und unter widrigen Umständen gearbeitet wurde, um Geld (zunächst vor allem im Ausland) für den Lebensunterhalt der Witwen und Kinder zusammenzutragen; wie viel Einsatz und Willen das Hilfswerk brauchte, „um den von den Nazis böswillig beschädigten Ruf der Widerständler wiederherzustellen“.
Rainer Volk: Von der Missachtung zur Anerkennung des Widerstands. Lukas-Verlag, Berlin 2025, 221 Seiten, 29,80 Euro.
(Foto: Lukas Verlag)
Der Autor zeichnet akribisch nach, wie das Häuflein, vor allem unter Gräfin Hardenberg, die als „Motor des Netzwerks“ fungierte, schließlich immer mehr Wirkung entfaltete und wie es schließlich 1952 gelang − mithilfe erstaunlich zugewandter Ministerialbeamter in Bonn −, eine jährliche Unterstützung vom Staat für die Hinterbliebenen zu organisieren. Das Hilfswerk, das später in eine Stiftung umgewandelt wurde und bis 1994 aktiv war, kümmerte sich nicht zuletzt um die „Aufklärung der Öffentlichkeit“ und war ein entscheidender Faktor bei den Gedenkfeiern zum Jahrestag im Bendlerblock.
Volk blickt dabei auch immer wieder auf interne Konflikte und Grabenkämpfe sowie auf Anfeindungen von außen oder Reibereien mit der Bundesregierung und arbeitet so anschaulich heraus, dass man nicht von einer allzu glatten Erfolgsgeschichte des Hilfswerks sprechen sollte. Ebenso erinnert er daran, dass der Anspruch des Hilfswerks, sich als die Stimme des Widerstands „aufzuschwingen“, zulasten anderer Verfolgten-Verbände ging. Insgesamt bleibt aber doch die Achtung vor einer „hartnäckigen Lobbyarbeit“.
Geschichte
:Die Stauffenbergs – auf ewig die Nachfahren des Hitler-Attentäters
Maximilian Karl Schenk Graf von Stauffenberg will nur ein ganz normaler Mensch sein. Das ist nicht immer so einfach mit seinem Familienhintergrund, der ein gewichtiger Teil der deutschen Geschichte ist.
Von Olaf Przybilla (Text) und Johannes Simon (Fotos)
https://www.sueddeutsche.de/
Berlin & Brandenburg
Wegner: Müssen an Widerstand gegen Hitler erinnern
19.07.2025, 11:16 Uhr
(Foto: Jens Kalaene/dpa)
Das Attentat auf Adolf Hitler ist 81 Jahre her. Für Berlins Regierenden Bürgermeister war der 20. Juli 1944 einer der bedeutendsten Tage in der Geschichte Deutschlands.
Berlin (dpa/bb) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat auf die Bedeutung des Umsturzversuchs gegen die NS-Diktatur vor 81 hingewiesen. "Mit dem gescheiterten Attentat am 20. Juli 1944 haben Widerstandskämpfer und Gegner des Nationalsozialismus gezeigt, dass es auch ein "Anderes Deutschland" gab", erklärte der CDU-Politiker.
"Der 20. Juli 1944 war einer der bedeutendsten Tage in der Geschichte unseres Landes. Denn die Werte, für die die Widerstandskämpfer eingetreten sind, überdauern ihren Tod." Sie wirkten bis heute im Grundgesetz und in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Deutschlands fort.
Mahnung an kommende Generationen
"Deshalb ist es eine bleibende Aufgabe unseres Landes, der Frauen und Männer des Widerstands zu gedenken und die Erinnerung an sie und an ihr Wirken wachzuhalten – als Mahnung und als Anspruch für uns alle, für heutige und kommende Generationen."
Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg vergeblich versucht, den NS-Diktator Adolf Hitler mit einer Bombe zu töten, die nationalsozialistische Herrschaft zu stürzen und den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Dutzende Beteiligte wurden hingerichtet oder in den Suizid getrieben.
Am 81. Jahrestag am Sonntag hält Wegner ein Grußwort auf der Gedenkveranstaltung der Bundesregierung in der Gedenkstätte Plötzensee. Am Nachmittag nimmt der Regierende Bürgermeister am Gelöbnis von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Bendlerblock teil.
Quelle: dpa
https://www.n-tv.de/
Sie stehen bis heute dafür ein
Stand:19.07.2024, 17:18 Uhr
Von: Tatjana Coerschulte
Der gefesselte Widerstandskämpfer im Innenhof des Bendlerblocks, davor die Gedenkplatte „... für Freiheit, Recht und Ehre“. © imago images/Jürgen Ritter
Das „Hilfswerk 20. Juli 1944“ unterstützt seit dem Krieg die Angehörigen der Hitler-Attentäter. Ihre Nachkommen treffen sich nach wie vor. In der aktuellen politischen Debatte unternehmen sie einen für sie ungewöhnlichen Schritt.
Heute würde man es „shit-storm“ nennen, damals kommt der Hass per Postkarte und Leserbrief. In deutschen Tageszeitungen erscheinen in den 50er Jahren Zuschriften, die den „Landesverrätern“ den Tod wünschten. Die Adressaten dieses Hasses kennen sich teilweise nicht mal. Es eint sie ein einziges Datum: Sie sind Frauen und Kinder, Eltern, Geschwister und andere Verwandte jener Männer, die am 20. Juli 1944 versuchten, Adolf Hitler zu töten.
„Wie die Familien angegriffen wurden, das ist zum Teil erschütternd“, sagt Barbara Lier. „Die Hinterbliebenen wurden nicht geachtet, sie wurden verachtet“, schreibt die Kölner Historikerin in ihrer Geschichte des „Hilfswerks 20. Juli 1944“. Der Verband wurde kurz nach dem Krieg gegründet, agiert heute als Stiftung und ist mit der später geschaffenen „Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944“ verbunden. Nach wie vor treffen sich in diesem Rahmen die Nachkommen der Männer und Frauen vom 20. Juli. Mittlerweile ist die Urenkelgeneration dabei.
Als das NS-Regime direkt nach dem missglückten Attentat mit Verhaftungen beginnt und noch am Abend des 20. Juli in Berlin Claus Schenk Graf von Stauffenberg und drei weitere hohe Militärs erschießen lässt, weiß niemand genau, wer alles zum Kreis der Verschwörer gehört – auch deren Angehörigen nicht. Das ist der Geheimhaltung des Vorhabens und der Vorsicht der Verschwörer geschuldet, und auch der Verzweigung des militärischen Widerstands in bürgerliche und kirchliche Kreise hinein. So waren die Frauen der Hitler-Attentäter teils gar nicht eingeweiht, teils erst spät oder lückenhaft, sagt Barbara Lier. Andere hätten von Anfang an Bescheid gewusst oder seien aktiv an den Planungen beteiligt gewesen.
Der Historikerin zufolge wurden in der Folge des 20. Juli etwa 600 bis 800 Menschen verhaftet. Es kommt zu rund 50 Prozessen mit 200 Angeklagten vorm „Volksgerichtshof“ unter dem berüchtigten Vorsitzenden Roland Freisler.
Bestattungen nicht erlaubt
Viele Angehörige kommen ins KZ, Kinder werden von Müttern getrennt und an weit entfernte Orte verfrachtet. Die Frauen werden in Unkenntnis über das Schicksal ihrer Männer gelassen, erhalten keine Besuchs– oder Sprecherlaubnis, ihr Besitz wird eingezogen. Jene, die durch Freislers Todesurteile zu Witwen werden, dürfen ihre Männer nicht bestatten, müssen aber Prozess- und Hinrichtungskosten zahlen.
Bei Kriegsende sind die Familienmitglieder, die noch leben, auseinandergerissen und über ganz Deutschland verteilt. Die Witwen – Stauffenbergs Frau Nina zum Beispiel gebiert während der Haft im Januar 1945 das fünfte Kind – stehen vor der Aufgabe, ihre Kinder und Angehörigen zu finden und die Netzwerke ihrer Männer nachzuvollziehen, sagt Barbara Lier.
Bald nach Ende des Krieges im Mai 1945 rufen Überlebende ein Hilfswerk für die Familien des 20. Juli ins Leben. Es soll die Nachkommen zusammenbringen, sie mit Geld und Hilfsgütern wie Kleidung und Medikamenten versorgen. Ab 1946 ist das Hilfswerk tätig, im August 1947 hält es seine erste offizielle Zusammenkunft ab.
Anfangs sei Unterstützung dafür vor allem aus den USA und Großbritannien gekommen, sagt Lier. Später zahlte auch die Bundesrepublik Geld, das vom Hilfswerk verteilt wurde. Das wurde oft dringend benötigt, denn Witwen- und Waisenrenten flossen spät oder mussten erstritten werden. Manchmal wurden sie kühl verweigert. So habe das Oberlandesgericht München einer Witwe lange nach dem Krieg mitgeteilt, ihre Rente könne nicht bewilligt werden, weil ihr Mann Hochverrat begangen habe, berichtet Barbara Lier im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau.
Die öffentliche Wahrnehmung änderte sich allmählich, nachdem der damalige Bundespräsident Theodor Heuss 1954 erstmals die Männer und Frauen des 20. Juli würdigte. Die Gedenkfeiern des Hilfswerks gewannen an allgemeiner Bedeutung. Die jährlichen Andachten seien anfangs für jene Angehörigen, denen ein Grab verwehrt worden war, wie eine Art Friedhofsgang gewesen, schreibt Lier. Vor allem seien sie jedoch „ein Forum des Zusammentreffens, des Austauschs und des Vertiefens der Bindungen der Hinterbliebenen“ geworden.
Bei allem Dissens, den das Hilfswerk über die Jahre über Ort und Gestaltung der Gedenkfeier austrug – grundsätzlich infrage gestellt wurde die Veranstaltung kaum. Sie wird inzwischen ausgerichtet von der Stiftung 20. Juli und dem Berliner Senat, ist fester Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur. „Das, was die Hinterbliebenen sich früh gewünscht hatten, ist längst Wirklichkeit geworden: Aus dem Gedenken an den 20. Juli ist eine Tradition geworden“, schreibt Lier.
Besondere Bedeutung erlangte die Arbeit des Hilfswerks für die Kinder des 20. Juli. „Jugendtreffen“ führten die Waisen und Halbwaisen zusammen, die durch das gemeinsame Leid und das geteilte Schicksal enge Freundschaften knüpften, schildert die Historikerin. Verbunden habe diese Gruppe auch, dass in vielen Familien die unmittelbaren Auswirkungen des Attentats tabuisiert worden seien. Die „Jugendtreffen“ schufen Raum für Austausch.
Junge fordern Aufarbeitung
Von einem Generationenkonflikt blieb denn aber auch das Hilfswerk nicht verschont, als Ende der 60er Jahre die Jüngeren einen anderen Umgang mit der Geschichte forderten. Aus dieser Debatte heraus entstand Mitte der 70er die „Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944“, die sich für eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Widerstands einsetzt.
Wie die Verschwörer vom 20. Juli sind auch die Nachkommen eine heterogene Gruppe, mit unterschiedlichen Auffassungen, Lebensweisen und Erfahrungen. „Dennoch gibt es einen Zusammenhalt“, konstatiert Barbara Lier. Obwohl dieses Erbe erdrückend wirken könne und trotz aller Anstrengungen stünden die Nachkommen des 20. Juli mehrheitlich bis heute dafür ein. Es sei die Erinnerung an die Väter und Mütter und der Stolz auf das, was diese getan haben, was die Nachfahren verbinde.
80 Jahre nach dem Attentat auf Hitler ist diese Haltung aktueller als lange zuvor. Das gesellschaftliche und politische Klima in Deutschland hat sich verändert: So sind Anwürfe von rechts gegen die Männer vom 20. Juli in sozialen Medien keine Seltenheit. Die Beeinflussung der politischen Debatte durch den Aufstieg von Rechtspopulisten hat die Nachkommen des 20. Juli jüngst zu einem für sie ungewohnten Schritt veranlasst: Nach dem Bekanntwerden des Potsdamer Geheimtreffens von Rechtsextremen meldeten sie sich öffentlich zu Wort. „Das Vermächtnis des Deutschen Widerstandes verlangt danach, für die freiheitliche-demokratische Grundordnung einzutreten und seine Stimme zu erheben, wo die Demokratie in Gefahr gerät“, heißt es in ihrer Erklärung. „Nie wieder ist jetzt!“
Die diesjährige Gedenkveranstaltung im Livestream am Samstag, ab 11 Uhr auf gdw-berlin.de/livestream
Der 20. Juli 1944
Der „Fall Walküre“ war im Original ein Geheimplan der Wehrmachtsführung für den Fall „innerer Unruhen“ im Deutschen Reich. Der militärische Arm der Verschwörergruppe schrieb diesen Plan geringfügig um, womit man sich quasi legal die Möglichkeit gab, die NSDAP und alle ihre Unter- und Parallelorganisationen zu neutralisieren. Ausgeführt nach dem Tod Hitlers, würde dann eine neue – bereits mit Widerständlern besetzte – Reichsregierung berufen, die dann unverzüglich mit den Westalliierten über einen separaten Waffenstillstand verhandeln sollte.
Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg avancierte 1943/44 zu einem Hauptakteur von „Walküre“. Als Stabsoffizier hatte der konservative Vorzeigesoldat direkten Zugang zu Hitler und platzierte den Sprengsatz, mit dem dieser getötet werden sollte. Durch einen Zufall entging Hitler dem Attentat mit nur leichten Blessuren. Im Berliner Bendlerblock lösten Stauffenbergs Kameraden den „Fall Walküre“ aus, aber schon bald wurde bekannt, dass Hitler überlebt hatte. Regimetreue
Offiziere in Berlin schlugen daraufhin den Aufstand nieder. In der Folge kamen Himmlers SS und andere „150-prozentige“ Nazis zu höchsten Ehren unter Hitler. Viele von ihnen betrieben nach dem Krieg massive Geschichtsklitterung. FR
https://www.fr.de/
Das „Hilfswerk 20. Juli 1944“
VfZ-Autor Rainer Volk stellt sein Buch in Berlin vor
In der Juliausgabe 2024 der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte erschien Rainer Volks Dokumentation „‚Ein ziemlich starkes Stück‘. Klaus Harpprechts ungedruckter Essay zum 25. Jahrestag des 20. Juli 1944“. Am Beispiel dieses Essays zeichnete der Autor nach, welche Rolle Gruppierungen wie die Stiftung „Hilfswerk 20. Juli 1944“ für die Erinnerung an den Widerstand in der Bundesrepublik spielten.
Im Mai 2025 ist Rainer Volks Buch „Von der Missachtung zur Anerkennung des Widerstands. Die Geschichte des Hilfswerks 20. Juli 1944“ erschienen. Der Autor stellt es am 10. Juli 2025 in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand vor.
Ort und Zeit:
Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Zweite Etage, Saal 2B
Stauffenbergstraße 13-14
10785 Berlin
10. Juli 2025, 18 Uhr
https://www.ifz-muenchen.de/
Zeitzeugin
Karla Spagerer ist tot
Erst vor einigen Jahren begann sie über ihre Erlebnisse im Nationalsozialismus zu sprechen - und warnte vor einem Wiedererstarken des Rechtsextremismus. Am Freitag starb Karla Spagerer im Alter von 95 Jahren.
16.5.2025 Von Daniel Kraft
Karla Spagerer ist im Alter von 95 Jahren gestorben. © dpa
Mannheim. Karla Spagerer ist tot. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes ist am Freitag im Alter von 95 Jahren gestorben, teilte die SPD Mannheim mit. „Die gesamte Mannheimer Sozialdemokratie verneigt sich in Trauer, Dankbarkeit und großem Respekt für ihre Lebensleistung vor dieser großartigen Frau“, wird der SPD-Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei zitiert.
„Mannheim trauert um eine vorbildhafte Bürgerin, eine leidenschaftliche Kämpferin für unsere Demokratie, eine stolze Waldhöferin und eine große Persönlichkeit“, sagte Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht am Freitag.
Karla Spagerer: Zeitzeugin des Nationalsozialismus und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes
Erst vor einigen Jahren begann Karla Spagerer über ihre Erlebnisse als Mitglied einer Familie zu sprechen, die aktiv im Widerstand gegen den Nationalsozialismus war. Seit 2018 trat sie als Zeitzeugin öffentlich vor allem an Schulen auf. 2022 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.
„Als eine der letzten Zeitzeuginnen der nationalsozialistischen Diktatur in Mannheim hat sie es sich in den letzten Jahren immer stärker zur Aufgabe gemacht, aufzuklären und vor einem erneuten Erstarken des Rechtsextremismus zu warnen“, sagte Fulst-Blei. In einem Interview mit dem „Mannheimer Morgen“ hatte Spagerer im vergangenen Oktober gesagt: „Dass ich an meinem Lebensabend wieder Angst um die Demokratie haben muss, hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können.“
Mannheimer Morgen Plus-ArtikelBundespräsident
„Unsere Karla war der Hit“ - Mannheimer bei der Steinmeier-Wahl in Berlin
Veröffentlicht13.02.2022VonPeter W. Ragge
Mehr erfahren
Mannheimer Morgen Plus-ArtikelBundesversammlung
Warum die 92-jährige Karla Spagerer aus Mannheim den Bundespräsidenten wählen darf
Veröffentlicht11.02.2022VonPeter W. Ragge
Mehr erfahren
Spagerer wurde am 27. Oktober 1929 in Mannheim geboren. 1947 heiratete sie Walter Spagerer. Die Ehe hielt bis zu dessen Tod am 20. Februar 2016. Walter Spagerer saß für die SPD von 1972 bis 1988 im Landtag. Er engagierte sich für den SV Waldhof. Die Haupttribüne des Benz-Stadions trägt seinen Namen. Auch Karla Spagerer war dem SV Waldhof eng verbunden.
“Ihr unermüdliches Engagement, ihre Liebe zum SV Waldhof und ihre Treue werden unvergessen bleiben. Karla war nicht nur Teil der Geschichte unseres Vereins – sie war Herz und Seele der Waldhof-Familie“, teilte der SV Waldhof Mannheim Freitag mit. Die Mannschaft des Vereins werde beim Auswärtsspiel am Samstag in Bielefeld mit Trauerflor auflaufen.
Die Sozialdemokratin war 2022 außerdem ältestes Mitglied der Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt. Am Freitagmorgen ist Karla Spagerer nach kurzer Krankheit friedlich eingeschlafen. (mit seko)
https://www.mannheimer-morgen.de/
Virtuelles Denkmal "Gerechte der Pflege"
"... die tolldreisten, machthungrigen Horden, sie konnten den Geist nicht morden!"
"Gerechte der Pflege" sind Pflegende, die inmitten des Terrors der Nazidiktatur durch ihr Leben und Werk späteren Generationen den Glauben an eine humane Pflege bewahrten. Hier erfahren Sie, welche Menschen die Ehre verdienen, in das Virtuelle Denkmal aufgenommen zu werden. Sie haben alle etwas gemeinsam: sie pflegten Menschen. Und sie sahen nicht weg, schwiegen nicht, erfüllten nicht ihre vorgezeichneten Rollen.
https://hriesop.beepworld.de/index.htm
+++
2.1 Widerstandsleistungen gegen Bestrebungen in und aus der Neuen Rechten, wie u.a. in und aus der AFD
Gewerkschafter*innen widersetzen sich
Von Anfang an beteiligten sich Gewerkschafter*innen im Netzwerk ,widersetzen‘. Deren Beteiligung ist Teil des Erfolgs, argumentiert der ver.di-Gewerkschafter Martin Wähler, denn sie verbinden nach außen Bewegungen und Betriebe.
Gastautor*in
28.05.2025 — 2 Minuten Lesezeit
Gewerkschafter*innen widersetzen sich
Foto: Martin Wähler
Das Netzwerk widersetzen feiert im April sein erstes Jubiläum. In dem Jahr seines Bestehens konnte es erfolgreich zu Aktionen des zivilen Ungehorsams zu zwei AfD-Bundesparteitagen mobilisieren. Im Juni 2024 störte widersetzen mit 7.000 Aktivist*innen den Parteitag der AfD in Essen. Im Januar 2025 blockierten 15.000 Aktivist*innen den Parteitag der AfD und verzögerten seinen Beginn für zwei Stunden.
Entgegen der Ankündigung von widersetzen konnte bislang kein Parteitag verhindert werden. Doch bei beiden Protesten konnten Menschen erleben, dass wir nicht machtlos gegenüber der AfD sind. Wir müssen nicht tatenlos zusehen, dass Hass und Hetze unwidersprochen Plätze und Räume einnehmen können.
Von Anfang an beteiligten sich Gewerkschafter*innen bei widersetzen. Sie sind Teil der Strategiekonferenzen oder beteiligten sich vor Ort mit der Organisierung der Proteste. Ohne die Beteiligung und das Know-How der Gewerkschafter*innen wären die Organisierungen nach Essen und Riesa deutlich schwieriger gewesen. Zu den Protesten in Essen riefen zahlreiche Kolleg*innen innerhalb von ver.di, der IG Metall oder der GEW auf. Mehrere ver.di Betriebsgruppen machten in Videostatements klar, warum sie sich in Essen der AfD entgegenstellen werden und das ihre Antwort auf Hass und Hetze der AfD Solidarität, Toleranz und Vielfalt ist.
In Essen zog ein "Demofinger" aus Gewerkschaftsmitgliedern früh morgens gemeinsam mit anderen Aktivist*innen morgens los, um Zufahrtswege zum Parteitag zu blockieren.
Ähnlich war es in Riesa. Dort organisierten sich weitaus mehr Kolleg*innen. Gewerkschaften organisierten Busse und riefen ihre Mitglieder zur Teilnahme an der Großdemo in Riesa auf. So z.B. die IG Metall Geschäftsstelle Dresden-Riesa oder die GEW Sachsen. ver.di rief bundesweit dazu auf sich zu beteiligen.
Die Beteiligung von Gewerkschafter*innen ist Teil des Erfolgs von widersetzen. Sie verbinden auch nach außen Bewegungen und Betriebe. Mit den Gewerkschafter*innen kann über die üblichen Strukturen hinaus erfolgreich und anschlussfähig für Viele zu Protesten gegen die AfD mobilisiert werden - auch mit Aktionen des zivilen Ungehorsams, deren Erfolg in der Entschlossenheit und der Breite des Widerstandes liegt.
👤
Martin Wähler ist Gewerkschaftssekretär bei ver.di und aktiv im Netzwerk widersetzen.
ℹ️
Der Beitrag stammt aus der diesjährigen Mai-Ausgabe unserer Zeitung WELT DER ARBEIT, die ihr hier findet: Heraus zum 1. Mai (Mai 2025)
https://betriebundgewerkschaft.de/
Mecklenburg-Vorpommern
Aachener Friedenspreis geht an Horst und Birgit Lohmeyer für Anti-Rechts-Festival „Jamel rockt den Förster“
Der Aachener Friedenspreis geht in diesem Jahr an Horst und Birgit Lohmeyer für ihr Festival gegen Rechtsextremismus „Jamel rockt den Förster“. Ausgezeichnet wird außerdem die studentische Plattform „Amirkabir Newsletter“ aus dem Iran.
24.05.2025
- Horst und Birgit Lohmeyer vor dem Pyramiden-Denkmal, das aus den Kanthölzern ihrer Scheune errichtet wurde, die einer Brandstiftung zum Opfer fiel.
Die Organisatoren des Musikfestivals „Jamel rockt den Förster“: Horst und Birgit Lohmeyer (Deutschlandradio / Sabine Adler)
Das Ehepaar aus Mecklenburg-Vorpommern organisiere ihre Veranstaltung seit 18 Jahren trotz Bedrohungen und Angriffen, teilte der Verein Aachener Friedensprei mit. Das Dorf Jamel in der Gemeinde Gägelow mit weniger als 40 Bewohnern gilt seit Anfang der 1990 Jahre als Hochburg der Neonazi-Szene.
Die Initiative „Amirkabir“ vernetzt nach Angaben des Friedenspreis-Vereins iranische Studierende bei ihren Protesten gegen die islamischen Machthaber und dokumentiert Repressionen im Umfeld iranischer Hochschulen.
Der mit jeweils 2.000 Euro dotierte Preis wird am Antikriegstag, dem 1. September, in Aachen verliehen. Der Friedenspreis würdigt seit 1988 Einzelpersonen oder Gruppen, die an der Basis für Frieden und Verständigung arbeiten. Geehrt werden laut Verein vor allem noch unbekannte Projekte oder Personen, um ihnen neben dem Preisgeld auch öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Diese Nachricht wurde am 24.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
https://www.deutschlandfunk.de/
Kundgebungen im Landkreis Regensburg
„Teufel der Nation“ prallt auf massiven Gegenprotest: AfD-Promi Höcke polarisiert in Neutraubling
24.05.2025| 11 Kommentare
Philip Hell
Redakteur | Lokalredaktion Regensburg
Verhärtete Fronten am Neutraublinger See: Der Thüringer AfD-Politiker sprach am Samstagmittag vor Anhängern. In Hörweite demonstrierte das Bündnis für Toleranz und Menschenrechte im Landkreis Regensburg gegen die Veranstaltung – und war mit Blick auf die Teilnehmer in der Überzahl....
https://www.mittelbayerische.de/
„Björn Höcke ist ein Nazi“
Warum bei den Lenzes ein Anti-AfD-Plakat im Vorgarten hängt
Enger: Die AfD abzulehnen, ist eine Sache. Sich ein Plakat in den Vorgarten seines Hauses in Enger zu hängen und den thüringischen AfD-Chef Björn Höcke als Nazi zu bezeichnen, ist noch einmal etwas ganz Anderes. Was sind die Reaktionen? Von Christian Althoff
Donnerstag, 22.05.2025, 17:19 Uhr
23.05.2025, 15:30 Uhr
Heike und Dr. Wolfgang Lenze aus Enger haben vor Monaten dieses Plakat im Vorgarten ihres Hauses aufgehängt. Foto: Althoff
Im Herbst spannte das Ehepaar Lenze aus Enger das Spruchband zwischen zwei Bäume. Dr. Wolfgang Lenze (73) ist Allgemein- und Kinderchirurg, seine Frau Heike (59) hat als Journalistin gearbeitet. Beide haben unterschiedliche Motive für ihr Eintreten gegen Rechtsextremismus...
https://www.wn.de/
Aachener Friedenspreis: Kampf gegen Rechts und Aktivismus im Iran
Stand: 22.05.2025, 20:49 Uhr
Mit dem Aachener Friedenspreis werden in diesem Jahr ein Künstler-Ehepaar in Mecklenburg-Vorpommern und studentische Aktivisten im Iran ausgezeichnet. Das hat der Verein Aachener Friedenspreis am Donnerstag bekannt gegeben.
Von Ulrike Zimmermann
Birgit und Horst Lohmeyer sind vor rund 20 Jahren aus Hamburg ins das Dorf Jamel gezogen, in einen alten Forsthof. Der ländlichen Idylle wegen. Doch mittlerweile ist Jamel vor allem als das Nazi-Dorf bekannt.
Immer mehr Rechtsextreme kamen dorthin, um das Dorf nach ihrem völkischen Ideal zu prägen. Sie folgten einem Neonazi, der dort vor Jahren damit begonnen hatte, Häuser aufzukaufen.
Musik-Festival für Toleranz und Demokratie
Das Ehepaar Birgit und Horst Lohmeyer in JamelDas Ehepaar Horst und Birgit Lohmeyer in Jamel
Die Lohmeyers wehren sich gegen diese Vereinnahmung. Dafür nehmen sie Einschüchterungen und Drohungen in Kauf. Vor rund zehn Jahren zündeten Unbekannte sogar die Scheune auf ihrem Hof an.
Trotzdem organisiert das Ehepaar jedes Jahr das Open-Air-Festival "Jamel rockt den Förster". Das Festival kommt gut an - beim Publikum und auch bei Bands.
Publikum vor einer FestivalbühneInterview mit Birgit Lohmeyer, Preisträgerin des Aachener FriedenspreisesWDR Studios NRW 22.05.2025 06:36 Min. Verfügbar bis 22.05.2027 WDR Online
Auf der Bühne gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und Toleranz standen schon die Toten Hosen im Jahr 2015, Herbert Grönemeyer oder die Fantastischen Vier.
- Jamel - Lauter Widerstand | ard mediathek
- Doku über Anti-Nazi Festival "Jamel rockt den Förster" | mehr
- Jamel: Rechter Angriff auf Festivalbetreiber | audio
"Tägliche Bedrohung"
Der Verein Aachener Friedenspreis will das Engagement der Lohmeyers unterstützen. In der Begründung heißt es:
Das persönliche Risiko, das Birgit und Horst Lohmeyer eingehen, verdient höchste Anerkennung.
Verein Aachener Friedenspreis
Die Initiatoren des Preisese betonen: "Trotz Widerstands und täglicher Bedrohung geben sie ihren Raum nicht auf und bleiben standhaft." Gerade jetzt, in einer Zeit populistischer Strömungen und einer Normalisierung rechtsextremer Positionen, verdiene das Anerkennung.
"Amirkabir Newsletter" - Sprachrohr iranischer Studierender
Zwei Frauen sitzen mit zwei Laptops, auf denen sie zwei Internetseiten präsentieren, an einem TischHilde Scheidt (l.) und Lea Heuser vom Verein Aachener Friedenspreis
Der zweite Preisträger sind die Macher des "Amirkabir Newsletter". Er erscheint seit Ende der 1990er Jahre. Herausgegeben wird er von studentischen Aktivisten. Sie berichten darin regelmäßig über Proteste, Festnahmen, Übergriffe und Menschenrechtsverletzungen an iranischen Universitäten.
Mittlerweile erreicht der Newsletter über das Internet und soziale Medien Hunderttausende und ist ein wichtiges Sprachrohr der Studierendenbewegung im Iran.
"Unerlässlich für Protestbewegung im Iran"
Der Aachener Friedensverein sieht den Newsletter als "eine unerlässliche Vernetzungsplattform für eine Protestbewegung, die weitgehend anonym im Untergrund arbeiten muss." Mit dem Preis würdigt er den "Mut der Redaktion".
Der Verein Aachener Friedenspreis zeichnet seit 1988 jedes Jahr Menschen und Gruppen aus, die sich an der Basis und oft aus benachteiligten Positionen heraus für Frieden und Verständigung einsetzen.
Die Preisverleihung ist am 1. September in Aachen. Der Preis ist mit jeweils 2.000 Euro dotiert.
Demonstranten halten am 13.01.2020 vor der Amir Kabir Universität weiße Blumen in die Höhe, während Iranische Sicherheitskräfte Tränengas in Richtung der Demonstration abfeuern. Die Demo ist für Opfer eines ukrainischen Flugzeugs, das abgeschossen wurde.Aachener Friedenspreis für iranische Plattform AmirkabirWDR Studios NRW 22.05.2025 00:43 Min. Verfügbar bis 22.05.2027 WDR Online
Unsere Quellen:
- WDR-Reporterin bei Bekanntgabe Aachener Friedenspreis
- Verein Aachener Friedenspreis
- Aachener Friedenspreis geht an Omas und Jugendliche | mehr
- Aachener Friedenspreis: Das sind die Preisträger 2024 | mehr
Der Film »JAMEL – Lauter Widerstand«
Ein Künstlerpaar und die deutsche Musikszene vereint im Kampf für Demokratie und Toleranz
Im Dokumentarfilm „JAMEL – Lauter Widerstand“ zeigt Regisseur Martin Groß, wie das Ehepaar Lohmeyer im rechtsextrem geprägten Dorf Jamel mit dem Musikfestival »Jamel rockt den Förster« ein starkes Zeichen für Demokratie und Toleranz setzt. Unterstützt von bekannten Bands wie Die Toten Hosen, Die Ärzte, Die Fantastischen Vier und Kraftklub hat das Festival inzwischen bundesweite Aufmerksamkeit erlangt. Ab 20. November 2024 in der ARD Mediathek und auf ardkultur.de.
https://www.forstrock.de/
2.2 Widerstandsleistungen gegen das Nationalsozialistische Terror-Verfolgungs- und Vernichtungsregime
Aufstand in Auschwitz-Birkenau 1944
"Besser mit der Waffe in der Hand sterben, als in die Gaskammer geschmissen werden"
Mit Steinen, Äxten und selbst gebauten Granaten griffen am 7. Oktober 1944 jüdische Häftlinge SS-Männer in Auschwitz-Birkenau an. Die Erhebung scheiterte zwar. Dennoch machte sie Mut - und rettete Menschenleben.
Von Martin Pfaffenzeller
07.10.2019, 14.09 Uhr
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Am 7. Oktober 1944 kurz nach 12 Uhr kommt SS-Unterscharführer Johann Gorges mit etwa 20 bewaffneten SS-Männern zum Krematorium 4 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.
Hier wohnen 325 Häftlinge des sogenannten Sonderkommandos, einer Sklavenarbeitertruppe aus griechischen, polnischen und ungarischen Juden, die Leichen aus den Gaskammern ziehen und in die Verbrennungsöfen schieben muss.
Gorges ruft die Häftlinge zum Appell auf den Hof, um den sich Stacheldraht zieht. Einer der SS-Männer geht eine Liste mit Häftlingsnummern durch. Die Aufgerufenen sollen auf die andere Seite des Hofes gehen. Angeblich benötigt die SS die Zwangsarbeiter in einer nahegelegenen Stadt, um Trümmer zu räumen.
Bei mehreren Nummern meldet sich niemand. Ein SS-Mann greift nach seiner Pistole. Da tritt der Häftling Chaim Neuhof hervor. "Mit dem Ruf 'Hurra' schlug er dem SS-Mann mit einem Hammer so auf den Kopf, dass er zu Boden geworfen wurde", berichtete der Gefangene Jehoshua Rosenblum später. Daraufhin werfen Häftlinge Steine auf die SS-Männer oder schlagen mit Äxten, Eisenstangen oder bloßen Fäusten auf sie ein, wie die Holocaustforscher Gideon Greif und Itamar Levin anhand von Zeitzeugenberichten und Akten rekonstruiert haben.
So beginnt am Mittag des 7. Oktober 1944 eine verzweifelte Rebellion, die ein Krematorium zerstören, einige Leben retten und vielen im Lager Mut machen wird: der Aufstand des Sonderkommandos in Auschwitz-Birkenau.
Fotostrecke
Aufstand in Auschwitz-Birkenau: "Wie bei einer Hasenjagd"
16 Bilder
Foto: Str/ picture alliance / dpa
Die Erhebung war teils spontan, teils lange geplant. Schon Ende 1942, wenige Monate, nachdem die SS alle vier großen Krematorien in Betrieb genommen hatte, kontaktierten Häftlinge aus dem Sonderkommando die Widerstandsbewegung im Stammlager Auschwitz, in der sich hauptsächlich nichtjüdische politische Gefangene organisierten.
Man war sich einig, dass ein Aufstand oder eine Massenflucht nur bewaffnet gelingen könne. Um die einzelnen Lager zogen sich Wachtürme und Stacheldrahtzäune, die die Deutschen nachts und bei Alarm unter Strom setzten. Mehr als 3000 SS-Angehörige bewachten das Areal mit abgerichteten Hunden und Maschinengewehren.
Beide Widerstandsgruppen beschlossen, sich ruhig zu verhalten, den industriellen Massenmord zu dokumentieren, Berichte und Fotos zu vergraben oder in den Westen zu schmuggeln. Zusätzlich aber wollten sie sich bewaffnen.
Schwarzpulver im BH
Die Sonderkommando-Häftlinge sammelten Hämmer und Äxte aus Werkstätten im Lager, schliffen Messer, die sie bei Leichen fanden und die ursprünglich dazu gedacht waren, das Sabbatbrot zu schneiden. Da sie den Toten die Goldzähne herausbrechen mussten, konnten sie bisweilen etwas Edelmetall vor der SS verbergen. Dafür kauften sie über Mittelsmänner einige Pistolen bei polnischen Partisanen, die sich in den Wäldern versteckten. Ein paar Revolver bekamen die Häftlinge von Zwangsarbeitern, die abgeschossene alliierte Flugzeugwracks zerlegen mussten und in den Bruchteilen Waffen der Piloten fanden.
Auch die Zwangsarbeiterinnen einer Munitionsfabrik im Lager belieferten das Sonderkommando: In Stoffsäckchen unter ihren Büstenhaltern schmuggelten sie kleinste Mengen Schwarzpulver aus dem Produktionsraum. Dieses Pulver stopften die Häftlinge mit Nägeln und Stacheldrahtstücken in Konservendosen und brachten Fetzen von Wolldecken als Zündschnüre an.
Je näher die Rote Armee, desto größer die Gefahr
Im Frühsommer 1944 rückte die Rote Armee rasch nach Westen vor, im Juni befreite sie das Vernichtungslager Majdanek, 300 Kilometer östlich von Auschwitz. Für das Sonderkommando bedeutete der Vormarsch der Roten Armee jedoch erhöhte Lebensgefahr - mit der deutschen Front brach auch die Logistik des industriellen Massenmords zusammen: Je weniger Züge mit Juden nach Auschwitz kamen, desto weniger Zwangsarbeiter benötigte die SS in den Krematorien. Außerdem rechneten die Häftlinge damit, dass die SS alle Augenzeugen ihrer Verbrechen würde beseitigen wollen.
"Unsere Haare, unsere Zähne und unsere Aschen": 1946 hielt der Künstler und Auschwitz-Häftling David Olère die grauenvolle Tätigkeit des Sonderkommandos in dieser Tuschezeichnung fest.
"Unsere Haare, unsere Zähne und unsere Aschen": 1946 hielt der Künstler und Auschwitz-Häftling David Olère die grauenvolle Tätigkeit des Sonderkommandos in dieser Tuschezeichnung fest. Foto: David Olere/ Collection Yad Vashem/ DPA
Das Sonderkommando drängte die Widerstandsbewegung der politischen Häftlinge, nun endlich loszuschlagen. Beide Gruppen verständigten sich auf einen gemeinsamen Plan: Erst sollten die Sonderkommando-Häftlinge SS-Wachmänner töten, ihre Uniformen anziehen, die SS-Einheiten von den Wachtürmen locken und ausschalten. Dann sollte auch der Rest des Widerstandes angreifen und ausbrechen. Geplant war der Angriff für einen Samstag im Juni 1944.
Doch die politischen Häftlinge sagten den Aufstand kurzfristig ab. Sie rechneten sich nur eine realistische Erfolgschance aus, wenn Sowjetpanzer und polnische Partisanen die Revolte unterstützten. "Wir konnten nicht teilnehmen, weil das, was für den Häftling in Birkenau die einzige Rettung darstellte, vielleicht für die anderen Selbstmord bedeutete", schrieb der österreichische Kommunist und Auschwitz-Häftling Bruno Baum später.
Die Sonderkommando-Häftlinge begriffen: Sie waren auf sich gestellt, ihren Aufstand bereiteten sie nun allein vor. "Wir beschlossen, dass der ganze Plan sich gelohnt hätte, wenn es auch nur einem einzigen Menschen gelingen sollte zu fliehen", berichtete Häftling Leon Cohen später, "wenn wir sterben müssten, dann sei es besser, in Ehren und mit der Waffe in der Hand zu sterben, als ehrlos in die Gaskammer geschmissen zu werden."
Leichenteile der Kameraden im Verbrennungsofen
Wie bedroht das Sonderkommando war, wurde spätestens am 23. September klar: Die SS sonderte mehr als zweihundert Häftlinge ab, angeblich zur Arbeit im Nebenlager Gleiwitz. Tatsächlich aber wurden sie in eine Desinfektionskammer im Hauptlager Auschwitz geführt und vergast. Um den Mord zu verheimlichen, verbrannten SS-Männer die Toten selbst.
Am nächsten Tag fand der Rest des Sonderkommandos jedoch Teile ihrer Kameraden in den Öfen des Krematoriums. Bei der nächsten Selektion, beschlossen die verbliebenen 663 Mitglieder, würden sie angreifen. Anfang Oktober war es so weit: Die SS befahl den Vorarbeitern des Sonderkommandos, eine Liste mit den Nummern von 300 Häftlingen anzufertigen, die ab dem kommenden Sonntag Trümmer räumen sollten - offensichtlich nur ein Vorwand, um sie heimlich zu ermorden.
Die vier Todesfabriken von Birkenau lagen im Abstand von mehreren Hundert Metern an unterschiedlichen Orten im Lager: Die Krematorien 2 und 3 im Südwesten, die Krematorien 4 und 5 im Nordwesten. Der Aufstand konnte nur gelingen, wenn er überall gleichzeitig begann. Die Gefangenen verabredeten sich, am Samstag, den 7. Oktober, beim Abendappell loszuschlagen.
Doch die SS machte den Plan zunichte: SS-Unterscharführer Gorges kam aus unklaren Gründen schon Samstagmittag, um die gelisteten Häftlinge aus den Krematorien 4 und 5 abzuholen.
"Wie bei einer Hasenjagd"
Und so begann die Rebellion mit dem Hammerschlag des Gefangenen Neuhof spontan und unkoordiniert. Viele Häftlinge hatten keine Waffen zur Hand. Einige von ihnen liefen in das Gebäude mit der Gaskammer und den Verbrennungsöfen, zündeten Strohmatratzen an, setzten das Gebäude in Flammen.
Nach der ersten Überraschung sammelte sich der SS-Trupp und zog sich schießend zum Hoftor zurück. Wenige Minuten später bremsten Lastwagen vor dem Hof. SS-Männer mit Stahlhelmen, kugelsicheren Westen und Maschinengewehren sprangen heraus und beschossen die Häftlinge durch den Stacheldraht hindurch. "Einer nach dem anderen fiel, wie bei einer Hasenjagd, getroffen zu Boden", erinnerte sich der Gefangene Filip Müller. Er selbst rannte zum brennenden Krematorium und versteckte sich in einem Kanal, der die Öfen mit dem Schornstein verband.
Einige Hundert Meter südlich hörten die Häftlinge aus Krematorium 2 die Schüsse, lockten einen SS-Mann ins Gebäude, warfen ihn in einen Ofen. Einige von ihnen rannten zu den Stacheldrahtzäunen, durchtrennten sie mit Zangen und flüchteten. Auf dem Weg schnitten sie ein Loch in den Zaun des benachbarten Frauenlagers. Sie gelangten bis zu einer Scheune nahe dem Lager.
Dort aber umstellte die SS die Häftlinge und eröffnete das Feuer. Die Gefangenen warfen ihre selbstgebauten Granaten. Doch gegen die Maschinengewehre der SS hatten die Flüchtenden keine Chance - alle wurden niedergemetzelt.
"Es waren Juden, die das vollbrachten"
Nach wenigen Stunden war der Aufstand des Sonderkommandos niedergeschlagen. 452 Häftlinge und drei SS-Männer waren tot. Wenige Wochen später hängte die SS auch vier Frauen aus der Munitionsfabrik, die Schwarzpulver herausgeschmuggelt hatten.
Doch der Aufstand rettete anderen das Leben. Die 17-jährige Jüdin Bella Fleischmann, die an jenem Mittag in Birkenau angekommen war und in die Gaskammer gehen sollte, nutzte die zwischenzeitliche Konfusion unter den SS-Männern und flüchtete zu einer anderen Häftlingsgruppe. Frieda Tennenbaum-Griesel, damals zehn Jahre alt, berichtete später, dass sie und ihre Mutter eigentlich zur Vernichtung vorgesehen waren. Dann aber habe die SS sie in eine andere Baracke getrieben. "In dieser Nacht wurde die Gaskammer gesprengt. Ich glaube, dass das der Grund war, warum wir nicht in die Gaskammer geschickt wurden."
Verwandte Artikel
- Todesmarsch der Auschwitz-Häftlinge: "Rechts und links war alles voll mit Leichen" Von Martin Pfaffenzeller
- Auschwitz-Überlebende aus Wien: Ruhe, jetzt redet Frau Gertrude Von Hasnain Kazim
- Holocaust: Der Fotograf von Auschwitz Von Stefanie Maeck
Das Krematorium 4 brannte komplett nieder, beide Schornsteine fielen in sich zusammen. Die Ruine wurde zum Symbol, dass Widerstand möglich war. "An der Stelle, wo Millionen unschuldiger Opfer ermordet wurden, fielen durch die rächenden Hände von Häftlingen die ersten SS-Mörder", schrieb der jüdische Auschwitz-Häftling und Historiker Israel Gutman, "Und es waren Juden, die das vollbrachten."
Der österreichische Widerstandskämpfer Baum berichtete: "Viele Polen und Deutsche hatten bisher geglaubt, dass Juden nicht kämpfen können. Die Häftlinge des Sonderkommandos belehrten sie eines Besseren. So wurde das Blutopfer des Sonderkommandos ein starkes Band, das die internationale Lagersolidarität festigte."
Ende November 1944 stoppte die SS die Vergasungen und zwang das Sonderkommando, zwei der drei verbleibenden Krematorien abzureißen. Im dritten aber mussten Sonderkommando-Häftlinge weiter die Leichen jener KZ-Insassen verbrennen, die die SS durch Unterernährung, Zwangsarbeit oder Genickschüsse vernichtete. Am 26. Januar 1945 wurde auch dieses Krematorium gesprengt, um Spuren zu verwischen.
Einen Tag später befreite die Rote Armee Auschwitz. Von den 663 Sonderkommando-Männern, die den Aufstand gewagt hatten, überlebten etwa 80 den Holocaust.
https://www.spiegel.de/
Verfolgung im nationalsozialistischen Essen
Community
Walter Wandtke
aus Essen-Nord
20.05.2025, 16:20 Uhr
Vor 90 Jahren: Käthe Larsch - Verhaftet am 18. Mai 1935 - getötet am 29. Mai 1935
1935: Die Altenessenerin Käthe Larsch kurz vor ihrer Verhaftung mit ihren vier Kindern - Abbildung aus dem Buch "Lichter in der Finsternis " von Dr. Ernst Schmidt - 1. Auflage erschienen 1979 | Foto: Dr. Ernst Schmidt7
Bilder
- 1935: Die Altenessenerin Käthe Larsch kurz vor ihrer Verhaftung mit ihren vier Kindern - Abbildung aus dem Buch "Lichter in der Finsternis " von Dr. Ernst Schmidt - 1. Auflage erschienen 1979
- Foto: Dr. Ernst Schmidt
- hochgeladen von Walter Wandtke
Vor kurzem noch waren die Zeitungsspalten gefüllt mit den Erinnerungen an das Ende des 2. Weltkriegs und den Zusammenbruch des nationalsozialistischen Terrorregimes in Deutschland am 8. Mai 1945. Am 1. September 1939 hatte Hitler-Deutschland mit seinen Eroberungsfeldzug gegen Polen den 2. Weltkrieg ausgelöst. Aber schon in scheinbaren "Friedenzeiten" vorher verfolgten NS-Staatapparat und seine Machtinstrumente wie die Gestapo - Geheime Staatspolizei - abweichendes Verhalten.
Wer die Freiheiten eines demokratischen Staates in Deutschland wiedererringen wollte, musste bereits in den ersten Jahren nach der Machtergreifung 1933 mit Gefängnis und Tod rechnen. Für die Stadt Essen und Altenessen sticht für diese frühe Phase der braunen Diktatur unter dem Stichwort Verfolgung und Widerstand der Fall des staatlichen Mordes an der vierfachen Mutter Käthe Larsch heraus.
Verhaftung der Seumannstraße 114
Gedenktafel der Stadt Essen für die Widerstandskämpferin Käthe Larsch - von der Gestapo in Essen verhaftet am 18 Mai 1935; ermordet in der Heilanstalt Düsseldorf Grafenberg am 29 Mai 1935 . Hier der Gedenktafelstandort am Bürgersteig und Gehewegsabzweig der unteren Seumannstraße | Foto: Walter Wandtke
- Gedenktafel der Stadt Essen für die Widerstandskämpferin Käthe Larsch - von der Gestapo in Essen verhaftet am 18 Mai 1935; ermordet in der Heilanstalt Düsseldorf Grafenberg am 29 Mai 1935 . Hier der Gedenktafelstandort am Bürgersteig und Gehewegsabzweig der unteren Seumannstraße
- Foto: Walter Wandtke
- hochgeladen von Walter Wandtke
Im Mai 1935, zwei Jahre nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, überlebte die im kommunistischen Widerstand aktive Käthe Larsch ihre Verhaftung durch die Gestapo keine 11 Tage. Käthe Larsch wohnte mit ihrer Familie bis dahin an der Seumannstraße 114 an der Grenze Altenessen/ Stoppenberg. In den Tagen nach ihrer Verhaftung sollte sie jetzt mit andauernden Verhören, körperlicher und psychischer Folter gezwungen werden, Informationen über die Aktivitäten von Widerstandgruppen gegen den NS-Terror preiszugeben.
Ihr Ehemann Rudolf Larsch war als Mitglied der KPD schon 1933 in den Illegalität gegangen. Er war bei seinen Versuchen, in der Region Bielefeld Widerstand gegen das brutale NS-System zu organiseren, allerdings bereits verhaftet und 1934 zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Trotz dieser akuten Gefahren für sie und den Rest der Familie waren in der Seumannstr. 114 weiterhin Flugblätter vervielfältigt und gelagert worden. Die Inhalte drehten sich um den "Kampf-Mai 1935", die anstehenden Vertrauenleutewahlen in den Betrieben. Aber auch Aufrufe der von den Nationalsozialisten schon im Frühjahr 1933 verbotenen und verfolgten KPD-Führung zu anderen Themen wurden von der Gestapo im Haus gefunden .
In seinem Buch "Lichter in der Finsternis" hatte der Stadthistoriker Dr. Ernst Schmidt bereits 1979 eindringlich das Schicksal von Käthe Larsch und ihrer Familie recherchiert.
Tod in Düsseldorf - Grafenberg
Am 29. Mai 2025 jährt sich der 90. Todestag der mehrfachen Mutter und Widerstandskämpferin Käthe Larsch. Schon lange hatte die Gestapo - ( geheime Staatspolizei in NS-Deutschland ) die Familie Larsch und ihr Wohnhaus unter Beobachtung, denn sie war im kommunistischen Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur aktiv.
Hier an der früheren Seumann Str. 114, heute eine Grünfläche, wurde Ende der achtziger Jahre eine Gedenktafel der Stadt Essen für die tapfere Frau errichtet. Diese Tafel erinnert an ihren grausamen, durch Folter und Zweckpsychose verursachten Tod und auch daran, dass ihre jetzt elternlosen vier Kinder bis zum Ende der NS-Herrschaft vom Essener Jugendamt fast 10 Jahre zwangsweise in ein nationalsozialistisches Kinderheim an der Berliner Straße in Frohnhausen gesteckt wurden.
Gedenktafel der Stadt Essen für die kommunistische Widerstandskämpferin Käthe Larsch, die seit den achtziger Jahre an der Seumannstraße an ihrem ehemaligen Wohnhaus kurz vor der Einmündung der Tuttmannstraße an die mutige Frau und Mutter von 4 Kindern erinnert. Ihre Verhaftung und ihr 11 Tage währendes Martyrium unter Gestapofolter haben mittlerweile auch Erinnerung durch eine Strassenbenennung in der "Grünen Mitte" nahe des Stadtzentrum gefunden. | Foto: Walter Wandtke
- Gedenktafel der Stadt Essen für die kommunistische Widerstandskämpferin Käthe Larsch, die seit den achtziger Jahre an der Seumannstraße an ihrem ehemaligen Wohnhaus kurz vor der Einmündung der Tuttmannstraße an die mutige Frau und Mutter von 4 Kindern erinnert. Ihre Verhaftung und ihr 11 Tage währendes Martyrium unter Gestapofolter haben mittlerweile auch Erinnerung durch eine Strassenbenennung in der "Grünen Mitte" nahe des Stadtzentrum gefunden.
- Foto: Walter Wandtke
- hochgeladen von Walter Wandtke
Seit Ende 2011 erinnert auf Initiative der grünen Stadtratsfraktion ebenfalls eine kleine Straße , die zur "Grünen Mitte" und der Essener Uni führt, an die Widerstandskämpferin Käthe Larsch. Schön, dass zur damaligen Strasseneröffnung nicht nur der frühere und auch heutige Bezirksbürgermeister Peter Valerius anwesend war, sondern auch 20 Personen aus der Familie. Für die Enkel von Käthe Larsch und deren Angehörige war das kleine Stück Blech sicherlich eine späte Genugtung .
An der Einmündung der kurzen, bis heute nur wenige Hausnummern zählenden Käthe-Larsch Str. zur Friedrich-Ebert-Str. gibt es leider keinen Hinweis zum widerständigen leben dieser Frau. Auch der Stadtverwaltung ist selbst anderthalb Jahrzehnte später keinerlei Hinweis vorgesehn, warum die Frau durch einen Strassennamen geehrt wurde. Aber vielleicht gelingt es zumindets bis zum hundersten Gedenktag an Käthe Larsch noch, hier einige knappe Informationen oder einen QR-Code mit weiteren Hintergründen zu instalieren.montiert worden.
Nachkommen der Familie von Käthe Larsch am frisch installierten Strassenschild vor der Einmündung zur Friedrich Ebert Straße. Die mutige Widerstandskämpferin Käthe Larsch passt hier natürlich bestens in die Nachbarschaft des ersten sozialdemokratischen Reichspräsidenten der Weimarer Republik, Friedrich Ebert. | Foto: Walter Wandtke
- Nachkommen der Familie von Käthe Larsch am frisch installierten Strassenschild vor der Einmündung zur Friedrich Ebert Straße. Die mutige Widerstandskämpferin Käthe Larsch passt hier natürlich bestens in die Nachbarschaft des ersten sozialdemokratischen Reichspräsidenten der Weimarer Republik, Friedrich Ebert.
- Foto: Walter Wandtke
- hochgeladen von Walter Wandtke
Ärzte leiten "Zweckpsychose" ein
Gestorben ist Käthe Larsch nicht in Essen, sondern am 29. Mai 1935 in der Düsseldorfer Heil-und Pflegeanstalt Grafenberg. Schließlich aber hat Käthe Larsch den Mut, gewaltlos mit Flugblättern gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime vorzugehen, nach 11 tägiger Gestapofolter mit dem Leben bezahlen müssen.
Die NS-Polizeibehörden-, wie auch der mit der Gestapo kooperierende Medizinapparat hatte in dieser Zeit erfolglos versucht, ihr wichtige Information über Widerstandsgruppen im Ruhrgebiet abzupressen.
Nach der Verhaftung in ihrer Wohnung in der Seumannstraße war Katharina (Käthe) Larsch allerdings im Zuge brutaler physischer wie psychiatrischer Verhörmethoden Opfer des NS-Unrechtstaats geworden. Die Gewalt wurde zuerst in Polizeigewahrsam, später in den Essener städtischen Krankenanstalten und in der Düsseldorfer psychiatrischen Klinik Grafenberg an ihr begangen. Die letztlich tödliche Gewalt des NS-Staats in der Klinik Grafenberg führte auch zu einer Grabstätte auf dem Krankenhausfriedhof.
Ihr Ehemann Rudolf Larsch verbüßte bereits seit 1933 wegen politischer Widerstandstätigkeit gegen den NS-Staat eine Zuchthausstrafe. So mussten die vier Kinder nach der Ermordung ihrer Mutter Käthe Larsch die Zeit bis Kriegsende 1945 in einem Kinderheim in Frohnhausen verbringen. Die Leidensgeschichte dort als sogenannte „Kommunistenkinder“ prägte schließlich noch die Erziehung der heutigen Enkelgeneration.
Klaus Gerstendorff, Sohn von Wera Gerstendorff, geborene Larsch, hatte als einer der Enkel von Käthe Larsch für diesen Erinnerungstag der Strassenbenennung einen Vortrag ausgearbeitet, der eindringlich das vom nationalsozialistischen Terror geprägte Leben der Familie über drei Generationen hinweg beschrieb. Herr Gerstendorff stellte auch das hier abgedruckte historische Foto seiner Großmutter mit ihren Kindern zur Verfügung.
aktualisierte Ergänzung :
Klinik-Grafenberg - keine Erinnerung an die Patientin Käthe Larsch
Eingang zur Alten Friedhofkappelle, die über dem früheren Friedhof der psychiatrischen Kliniken des LVR in Düsseldorf Grafenberg errichtet wurde. Links unter den Bäumen ist ein Findling zu erkennen, der den Euthanasieopfern der Zeit zwischen 1939 - und 1945 gewidmet ist. Leider gibt uns die eingravierte Inschrift weder die Zahl der Opfer , noch etwa besondere Daten zu den Verschiedenen Tötungsaktionen an. Tötungsopfer aus politischen Motivationen unterschiedlicher Widerstandsgruppen gegen die NS Diktatur werden gar nicht erwähnt. Nach eigener Recherche sind solche Angaben auch an anderer Stelle im Klinikareal nicht vorhanden . | Foto: Walter Wandtke
- Eingang zur Alten Friedhofkappelle, die über dem früheren Friedhof der psychiatrischen Kliniken des LVR in Düsseldorf Grafenberg errichtet wurde. Links unter den Bäumen ist ein Findling zu erkennen, der den Euthanasieopfern der Zeit zwischen 1939 - und 1945 gewidmet ist. Leider gibt uns die eingravierte Inschrift weder die Zahl der Opfer , noch etwa besondere Daten zu den Verschiedenen Tötungsaktionen an. Tötungsopfer aus politischen Motivationen unterschiedlicher Widerstandsgruppen gegen die NS Diktatur werden gar nicht erwähnt. Nach eigener Recherche sind solche Angaben auch an anderer Stelle im Klinikareal nicht vorhanden .
- Foto: Walter Wandtke
- hochgeladen von Walter Wandtke
In der heutigen Poliklinik für Psychiatrie in Düssendorf-Grafenberg fehlt für die dort zu Tode gebrachte Widerstandskämpferin Käthe Larsch jedwede Erinnerung an die ihr im Mai 1935 durch die Gestapo zugeführte Patientin. Bei Nachfrage konnten durchaus an diesem Fall interessierte Mitbeiterinnen der Klinik-Bibliothek nur an das allgemeine Archiv der LVR ( Landschaftsverband Rheinland) weiterverweisen.
Der Ende der 70ziger Jahre von Dr. Ernst Schmidt verfasste Aufsatz zum Schicksal der Essenerin Käthe Larsch erwähnt noch ihre sehr bescheidene Grabstätte auf dem Krankenhausfriedhof in D-Grafenberg. Auf einer von ihrer Familie mit betreuten Webseite sind u.a. auch Fotos des Grabkreuzes etwa im Zustand Ende der vierziger Jahre zu sehen. (der Link: https://ww.jugend1918-1945.de).
Gegenwärtig existiert dieser "Alte Friedhof" allerdings nur noch mit einigen übriggebliebenen Grabstätten und Grabsteinen, hauptsächlich wurde er zum Baumlehrpfad umfunktioniert.
Das Grab von Käthe Larsch war anscheinend nicht wichtig genug, um es zu erhalten oder die problematische Funktion psychiatrischer Kliniken in der nationalsozialistischen Diktatur zu verdeutlichen. Es gibt für Käthe Larsch auch keine Gedenkplakette innerhalb der Klinik-Gebäude. Eigentlich ist das merkwürdig, denn auf der Webseite des LVR Klinikums wird ansonsten durchaus ausführlich Stellung zu den Verwicklungen der Klinik in z.B. in Euthanasie- und Zwangssterilisationsaktionen genommen. Gerade in den ersten Jahren des NS-Diktatur war die Zahl eingewiesener Systemgegner*innen aber sicherlich soweit überschaubar, dass ein Fall wie das Einleiten einer "Zweckpsychose" mit tödlichem Ende sicherlich eine Besonderheit war.
Diesen und vielleicht auch weitere solcher tödlichen Fälle nicht sichtbar auf dem Klinikareal zu dokumentieren, ist ein Fehler, der hoffentlich bald geändert wird.
"Den Opfern der Euthanasie 1939 - 45" lautet die sehr allgemeine Inschrift auf dem Findling neben der Alten Friedhofskirche hinter der psychiatrischen Kilink in Düsseldorf - Grafenberg. Wann genau und wieviel Menschen als angeblich "Lebensunwertes Leben" durch den sogenannten "schönen Tod" von Staats wegen ermordet wurden , verschweigt der Findling also. Von anderen absichtvollen Tötungsaktionen innerhalb der Klinik während der NS-Diktatur ist hier ebenso keine Rede
Das ist traurig - nicht nur für die fehlende Erinnerung an die Widerstandskämpferin Käthe Larsch und ihre Familie. |
- Foto: Walter Wandtke
"Den Opfern der Euthanasie 1939 - 45" lautet die sehr allgemeine Inschrift auf dem Findling neben der Alten Friedhofskirche hinter der psychiatrischen Kilink in Düsseldorf - Grafenberg. Wann genau und wieviel Menschen als angeblich "Lebensunwertes Leben" durch den sogenannten "schönen Tod" von Staats wegen ermordet wurden , verschweigt der Findling also. Von anderen absichtvollen Tötungsaktionen innerhalb der Klinik während der NS-Diktatur ist hier ebenso keine Rede
Das ist traurig - nicht nur für die fehlende Erinnerung an die Widerstandskämpferin Käthe Larsch und ihre Familie.
Foto: Walter Wandtke
- hochgeladen von Walter Wandtke
Die ausführliche Geschichte, auch zum üblen Schicksal ihrer Kinder, die bis 1945 in einem Heim der Stadt Essen nationalsozialistisch erzogen werden sollten, gibt es mit weiteren Informationen in einer Radiosendung:
Zu hören am 29. Mai 2025 um 19: 04 Uhr bis 19: 55 Uhr auf der Frequenz 102,2 UKW) bzw. über die Webseite von Radio Essen . - eine Bürgerfunkproduktion von "Medienzentrum Ruhr macht Radio"- MZR e.V.
https://www.lokalkompass.de/
Kampf um Itter 1945
Wehrmacht und US Army verteidigten dieses Schloss gegen die SS
von Berthold Seewald
Freier Autor Geschichte
Stand: 13.05.2025 Lesedauer: 6 Minuten
won Kombo Kampf um Itter Bild links: Schloss Itter, Kitzbüheler Alpen, Tirol, Österreich, Europa Bild rechts: Josef Gangl neben seinem Auto im Gespräch mit John C. Lee vor der Verteidigung von Schloss Itter.
Um Schloss Itter in Tirol zu schützen, verbündete sich Major Josef Gangl mit den GIs
Quelle: Norbert Eisele-Hein; Wikipedia/Public Domain
Um die „Ehrenhäftlinge“ zu retten, die auf Schloss Itter in Tirol inhaftiert waren, verbündeten sich im Mai 1945 Soldaten der Wehrmacht und der US Army. Als die Waffen-SS mit Übermacht angriff, kam es zu einer dramatischen Situation.
Am 5. Mai 1945 ging es nur noch ums Überleben. In Süddeutschland kapitulierte die Wehrmacht einheitsweise, in den Niederlanden liefen die Verhandlungen darüber, in Reims wurde die deutsche Delegation für die Gesamtkapitulation erwartet und in Mauthausen befreiten US-Truppen das letzte KZ auf dem Gebiet Österreichs. Dennoch zogen weiterhin fliegende Standgerichte und fanatische SS-Einheiten durch die letzten unbesetzten Gebiete des Großdeutschen Reiches und vollstreckten mörderische Befehle. Einer davon lautete, die prominenten Gefangenen, die auf Schloss Itter in Tirol (bei Wörgl unweit von Kufstein) inhaftiert waren, zu liquidieren. Ein ungewöhnliches Bündnis übernahm die Verteidigung: Soldaten der Wehrmacht und der US Army.
Bereits bei der „Operation Cowboy“, der Rettung der Lipizzaner-Pferde aus Böhmen Ende April 1945, waren Deutsche und Amerikaner gemeinsam gegen Waffen-SS und tschechische Partisanen vorgegangen. Anders als das Gestüt Hostau (Hostouň), das von der Wehrmacht geführt wurde, unterstand Schloss Itter der SS. Hierher hatte sich der Kommandant des KZs Dachau, Eduard Weiter, gerettet, bevor US-Truppen sein Lager befreiten. Was anschließend geschah, hat der Historiker Chris Helmecke vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr jetzt in einem Aufsatz der Zeitschrift „Militärgeschichte“ zusammengetragen.
Hofpartie von Schloss Itter
Quelle: picture alliance / arkivi
Das Kommando über das „SS-Sonderkommando Schloss Itter“ führte der SS-Hauptsturmführer Sebastian Wimmer. Mit 15 SS-Männern und etwa 30 Häftlingen aus dem KZ Flossenbürg hatte er eine Gruppe sogenannter „Ehrenhäftlinge“ zu bewachen, die 1943 in dem mittelalterlichen Schloss, das zuvor als Luxushotel und Ausstellungsforum gedient hatte und nun als Außenlager von Dachau firmierte, interniert worden waren. Verglichen mit dem übrigen Heer der Nummern tragenden KZ-Häftlinge genossen sie ein erstaunliches Maß an Komfort, der aber unter internen Spannungen litt.
So wechselten Édouard Daladier, der 1938 als französischer Premierminister das Münchner Abkommen unterzeichnet hatte, und sein Nachfolger Paul Reynaud kein privates Wort miteinander. Eine ähnliche Feindseligkeit legte dieser gegenüber dem General Maxime Weygand an den Tag, der als französischer Oberbefehlshaber 1940 vor der Wehrmacht kapituliert hatte. Dieser sprach wiederum nicht mit seinem Vorgänger Maurice Gamelin. François de La Rocque hatte als Faschistenführer sogar in der Regierung des Vichy-Regimes gesessen, bis die Gestapo seine Kontakte zum britischen Geheimdienst aufdeckte. Auch der ehemalige Tennis-Star Jean Borotra hatte zur Vichy-Regierung gehört, bevor sein Fluchtversuch nach Algerien gescheitert war. Alfred und Marie-Agnès Caillau hatte ihr Geburtsname nach Itter gebracht: de Gaulle. Sie war die Schwester des Generals und Führer der freien Franzosen.
Anzeige
Nachdem sein Chef Eduard Weiter wahrscheinlich um den 2. Mai in Itter Selbstmord begangen hatte, beschlossen auch Wimmer und seine Leute, sich aus dem Staub zu machen. Doch damit hatten die Häftlinge – sowohl die prominenten als auch das Dienstpersonal mit den Nummern – keineswegs ihre Freiheit wiedergewonnen. Jederzeit konnten Einheiten auftauchen, die noch in den letzten Tagen des Krieges Hitlers Vernichtungsbefehle gnadenlos exekutierten. Auch gingen Gerüchte von der „Alpenfestung“ um, in der ranghohe Nazis bis zum Endsieg würden durchhalten wollen.
Daher versuchte ein KZ-Häftling, sich zu den Amerikanern durchzuschlagen. Da aber im nahen Wörgl inzwischen die Waffen-SS das Sagen hatte, musste er bis nach Innsbruck fahren. Dort wurde ein Trupp US-Soldaten nach Itter in Marsch gesetzt, den aber deutsche Widerstandsnester zur Umkehr zwangen.
Josef Gangl (1910–1945)
Quelle: Wikipedia/Public Domain
In der Zwischenzeit gelang es den Häftlingen in Itter, Kontakt zu einem Offizier der Wehrmacht aufzunehmen, der sich mit einigen Artilleristen dem österreichischen Widerstand angeschlossen hatte. Dieser Major hieß Josef Gangl und war an der Ostfront und in der Normandie hochdekoriert worden. Er erkannte die Gefahr für Schloss Itter und beschloss, sich den Amerikanern zu ergeben und dabei um Hilfe zu bitten.
In Kufstein traf er auf den First Lieutenant John Lee, der zur Vorhut der 12. US-Panzerdivision gehörte. Der ehemalige Football-Star bekam das Plazet seines Kommandeurs und begleitete Gangl mit seinem Sherman-Tank und wenigen GIs nach Itter. Die Geografie begünstigte die Verteidigung. Auf einem Bergsporn gelegten, gab es nur einen Zugang, den Lee mit seinem Panzer (der beinahe die Zugangsbrücke zu Einsturz gebracht hätte) blockierte. Die Stacheldrahtverhaue und Freiflächen, die um das KZ-Außenlager angelegt worden waren, boten Schutz vor Überfällen. Und die dicken Mauern aus dem Mittelalter hielten dem Beschuss mit leichten Waffen stand.
Mit zwei Dutzend Soldaten von Wehrmacht und Army organisierte Lee die Verteidigung. Hinzu kamen einige Häftlinge, die sich mit zurückgelassenem Material der SS bewaffnet hatten und lieber kämpfen wollten, als sich in den Kellergewölben zu verstecken. „Zu diesen stieß sogar noch ein Angehöriger der Waffen-SS, der SS-Hauptsturmführer Kurt-Siegfried Schrader, der sich nach einer Verwundung zu Genesung in Itter befand“, schreibt Helmecke.
Nach der Befreiung (v. l.): Paul Reynaud, US-General Anthony Mac Auliffe, Frau Weygand, Maurice Gamelin, Édouard Daladier und Maxime Weygand
Quelle: Gamma-Keystone via Getty Images/Keystone-France
Am Morgen des 5. Mai begann die Attacke. Mehr als 100 Mann der 17. SS-Panzergrenadier-Division „Götz von Berlichingen“, denen sich auch Wehrmachtssoldaten angeschlossen hatten, wollten den Befehl, Gefangene und Besatzung zu töten, in die Tat umsetzen. Nach einem ersten gescheiterten Vorstoß erfolgte gegen Mittag der Großangriff. Mit einer Panzerabwehrkanone wurde der Sherman-Panzer ausgeschaltet. Damit verloren die Verteidiger auch ihr Funkgerät. „In der Rückschau muss der Anblick der Verteidigungsstellung skurril gewirkt haben“, schreibt Helmecke. „Hier lag etwa der ehemalige französische Premierminister Reynaud neben Soldaten der Wehrmacht – jener Streitmacht, die fünf Jahre zuvor noch sein Heimatland erobert hatte.“
Von Reynaud ist das Zitat überliefert: „Leider kann ich nicht bestätigen, dass ich einen Feind getötet habe.“ Dafür traf es Gangl, ein Kopfschuss tötete ihn. Schließlich musste Lee seine Truppe in den Bergfried zurückziehen. Da auch die Munition zur Neige ging, wagte Jean Borotra den Ausbruch. Als Bauer verkleidet, stahl er sich aus dem Schloss und konnte sich bis zu den anrückenden amerikanischen Panzern durchschlagen. Die beschleunigten ihren Vormarsch. Als sie gegen 16 Uhr vor dem Schloss erschienen, brachen die SS-Leute ihren Angriff ab. Mehr als 100 von ihnen wurde sofort oder in den nächsten Tagen gefangen genommen.
Dass ausgerechnet Gangl der einzige Verteidiger war, der die „Schlacht um Itter“ nicht überlebte, hat ihm einen prominenten Platz in der Geschichte des österreichischen Widerstandes eingetragen. Er wurde als Verfolgter des NS-Regimes eingestuft, in Wörgl ist eine Straße nach ihm benannt. Gleichwohl sind seine Motive unklar geblieben: Trieb ihn Altruismus oder wollte er sich den Amerikanern andienen?
In ihrem Song „The Last Battle“ von 2016 singt die schwedische Metal-Band Sabaton: „Und es sind die amerikanischen Truppen und die deutsche Armee, / die sich endlich zusammenschließen.“ Historiker Helmecke relativiert den „verklärenden Mythos von der ,guten‘ Wehrmacht, die sich gegen die SS stellte. Oftmals wird dabei außer Acht gelassen, dass auch Einheiten der Wehrmacht am Angriff auf das Schloss teilnahmen und ein Angehöriger der Waffen-SS bei der Verteidigung beteiligt war.“
Schon in seiner Geschichts-Promotion beschäftigte sich Berthold Seewald mit Brückenschlägen zwischen antiker Welt und Neuzeit. Als WELT-Redakteur gehörte die Geschichte der Weltkriege zu seinem Arbeitsgebiet.
https://www.welt.de/
Ende des Zweiten Weltkriegs in Aubing: Wie ein Polizist und eine Lüge den Ort vor Schlimmerem bewahrten
Stand: 10.05.2025, 16:00 Uhr
Von: Andreas Schwarzbauer
Team des Aubinger Archivs
Das Team des Aubinger Archivs recherchiert zum Kriegsende und sucht weitere Zeitzeugen. © Andreas Schwarzbauer
Ein Verein recherchiert, wie das Ende des Zweiten Weltkriegs in Aubing ablief. Ein Polizist und eine Lüge bewahrten den Ort vor Schlimmerem.
München / Aubing – Dem Leiter der Polizeistation, Max Beckerbauer, ist es wohl zu verdanken, dass der Krieg in Aubing am 30. April 1945 ohne Kämpfe und Verletzte endete. Das konnte das Aubinger Archiv anhand von Berichten der Pfarreien sowie Aufzeichnungen Beckerbauers rekonstruieren.
Max Beckerbauer © Aubinger Archiv
Eigentlich wollte ein SS-Bataillon den Ort vor den anrückenden Amerikanern verteidigen. Das war allerdings gar nicht im Sinne der Aubinger, die einen Beschuss und damit einhergehende Zerstörungen, Verletzte und Tote fürchteten. Ihre Einwände blieben aber ungehört. Also baten sie Beckerbauer um Hilfe.
Ende des Zweiten Weltkriegs in Aubing: Wie ein Polizist und eine Lüge den Ort vor Schlimmerem bewahrten
Diesem gelang es, die SS-Truppen mit einer List zu vertreiben. Er erfand einen Anruf der Gendarmerie Germering, in dem ihm seine Kollegen angeblich mitgeteilt hätten, dass dort bereits US-Panzer eingerückt und nun in großer Zahl in Richtung Aubing unterwegs seien.
Die SS-Soldaten würden – wenn sie blieben – überrannt werden. „Dies entsprach nicht ganz der Wahrheit. Gott und die Geschichte wird mir diese Lüge verzeihen“, notierte Beckerbauer. Die SS-Männer flüchteten Richtung Lochham.
Am 30. April zogen die ersten amerikanischen Soldaten – eine kleine Truppe von 30 Mann – gegen 6.30 Uhr über die Eichenauer Straße aus Richtung Puchheim nach Aubing ein. „Es ist kein Schuss gefallen, kein Haus beschädigt, kein Mensch verwundet oder getötet worden“, berichtet der damalige Pfarrer von St. Quirin, Josef Oswald.
Kriegsende 1945: Schießereien am Ortseingang von Planegg
Anders lief es in Planegg. Von dort berichtet Pfarrer Schneller von Schießereien am Ortseingang, bei denen neben mehreren SS-Männern auch eine Bürgerin starb. Zudem brannte ein Bauernhof nieder und die Pfarrkirche wurde beschädigt.
Meine News
Raus aus den Trümmern
80 Jahre „Stunde null“: Wie es Münchnern und ihren Institutionen nach Ende des Zweiten Weltkriegs erging
Trambahn- und Autoverkehr zwischen Trümmern, aufgenommen 1947.
Geschichte
Ende und Anfang: Der 8. Mai und die Deutschen
80 Jahre Kriegsende - Museum Karlshorst
Beckerbauer übergab den Amerikanern die Ortschaft. Es kamen immer mehr US-Soldaten nach Aubing, die schließlich weiter nach Lochham marschierten. Beckerbauer und seine Kollegen blieben auf freiem Fuß. Allerdings wurden sie aufgrund ihrer Uniformen, sobald sie die Wache verließen, immer wieder von nachrückenden Truppen gefangen genommen.
Er sprach daher in der US-Kommandantur in der Apotheke in Neuaubing vor, ob und wie sie weiter ihren Dienst versehen könnten. Nach einem Verhör entschieden die Amerikaner, Beckerbauer und seine Kollegen im Amt zu belassen – allerdings ohne Uniform und Waffe. Sie erhielten stattdessen Armbinden mit der deutschen und englischen Aufschrift „Polizei“.
Polizist berichtet von Herausforderungen nach Kriegsende in Aubing
Zudem mussten sie sich an die Sperrstunde halten. „Außerdem waren die Rechte und die Befugnisse in keiner Weise geklärt.“ Das stellte sich vor allem bei den folgenden Plünderungen als Herausforderung heraus.
Beckerbauer berichtet von neun Morden, 90 Plünderungen und 95 Fällen von Straßenraub bis Oktober in Aubing und Lochhausen. „Aubing kam bei diesen Plünderungen verhaltensmäßig gut weg, weil die Polizei mit Unterstützung einiger beherzter Bürger die Plünderer jeweils vertreiben konnte“, berichtet der Polizist.
Das Aubinger Archiv sucht weitere Zeitzeugen. „Wir wollen mehr Informationen sammeln, denn alle Erinnerung, die wir heute nicht festhalten, fehlt in der Zukunft“, sagt der Vorsitzende Egbert Scherello. Zeitzeugen oder deren Angehörige können sich unter Telefon 80 07 60 57 oder per E-Mail an info@aubinger-archiv.de melden.
https://www.tz.de/
Dorflehrer verhindert 1945 Katastrophe - Riebelsdorferin berichtet Enkel von dramatischen Stunden
Stand:08.05.2025, 17:00 Uhr
Von: Matthias Haaß
Vormarsch amerikanischer Sherman-Panzer über die heutige Kreisstraße in Suttrop, April 1945. Quelle: Heimatverein Suttrop.
Vormarsch amerikanischer Sherman-Panzer in Nordhessen. Das Bild enstand 1945 in Suttrop. So ähnlich muss es auch in vielen Orten in der Schwalm ausgesehen haben. Auch in Riebelsdorf. © Agentur
Am 8. Mai 1945 schwiegen die Waffen. Zumindest in Europa endete damit der Zweite Weltkrieg. Krieg und Kriegsende waren vor 80 Jahren auch in der Schwalm einschneidende Ereignisse. Das zeigt auch die Resonanz auf den HNA-Leseraufruf vor einigen Wochen.
Riebelsdorf - Noch gibt es Zeitzeugen, aber eindrückliche Geschichten und Erinnerungen wurden auch in den Familien weitergetragen. So auch bei Bernd Hennighausen aus Riebelsdorf.
In den 1980er-Jahren habe er lange Gespräche mit seiner Großmutter Katharina Elisabeth Blumenauer zum Kriegsalltag im Dorf und speziell über das Kriegsende in Riebelsdorf geführt, berichtet Hennighausen der HNA: „Ich habe diese Gespräche damals auf Tonband aufgenommen, sodass ich auch heute noch auf diese ansonsten verschollenen Erzählungen einer Zeitzeugin zurückgreifen kann.“
Vieles – vornehmlich auch das, was im Dorf nur hinter vorgehaltener Hand erzählt werden durfte - habe er so erfahren können, schreibt uns der Riebelsdorfer: „Sie zeichnete ein für mich sehr düsteres und beklemmendes Bild auf das dörfliche Alltagsleben jener Zeit. So berichtete meine Großmutter unter anderem von Dorfbewohnern, die sich insbesondere in der Vorkriegszeit den Repressalien örtlicher SA-Leute ausgesetzt sahen, wenn sie nicht bereit waren, aktiv bedingungslos mitzumachen.“
Hennighausens Großmutter wurde am 26. Oktober 1911 geboren. Bei Kriegsende war sie 34 Jahre alt und lebte auf dem Hof des Ehemannes und der Schwiegereltern direkt an der Hauptstraße in Riebelsdorf. Sie ist 1999 im Alter von 87 Jahren gestorben.
„Die Erinnerungen von Anneliese Schwalm (HNA-Artikel vom 3. Mai, Anm. der Redaktion) möchte ich noch ergänzen, denn die Situation bei Kriegsende hätte für das ganze Dorf weitaus schlimmer ausgehen können“, erläutert Bernd Hennighausen.
Obwohl der Amerikaner schon fast da gewesen sei, habe der Ortsgruppenleiter nicht kapitulieren wollen, erinnert sich damals Katharina Elisabeth Blumenauer: „Noch am frühen Morgen des Einrückens durch die Amerikaner beabsichtigte er fest entschlossen, den Feind vor dem Dorf aufzuhalten. Hierfür versuchte er auch noch – erfolglos – Gleichgesinnte zu gewinnen.
Auch meinen Schwiegervater sprach er vergebens an. Wir hatten doch schon alle die weiße Fahne draußen hängen!“ Sie erinnert sich genau an die Worte ihres Schwiegervaters: „Konrad, überlege Dir doch einmal, was Du machst. Du machst das ganze Dorf unglücklich. Du hältst sie doch nicht mehr auf.“
Katharina Elisabeth Blumenauer aus Riebelsdorf. Aufnahme entstand vermutlich in den 1930er Jahren. Foto/Repro Bernd Hennighausen
Katharina Elisabeth Blumenauer aus Riebelsdorf. Die Aufnahme entstand vermutlich in den 1930er-Jahren. © privat
Meine News
Kriegsende in Niestetal
Zeitzeugen erzählen: So erlebte Niestetal das Kriegsende
Zerstörtes Heiligenrode nach dem Zweiten Weltkrieg Trümmerschutt in Heiligenrode im Breiten Weg Foto: Geschichtsverein Niestetal
80 Jahre Kriegsende: Zeitzeuge Alfred Röver erlebte spannende Spiele in den Trümmern
Kinder spielten mit den Patronenhülsen
Zeitzeuge Alfred Röver, Jahrgang 1937, aus Kassel mit seinem Vater im Jahr 1947. Sein Vater war gerade aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt.Sammlung: Alfred Röver
Persönliche Erlebnisse
Angst und Hunger regierten: Wolfhager Bürger erzählen vom Kriegsende
Kriegsende Zeitzeugen Buchhandlung Mander Elke MüldnerZeitzeugen berichten: In der Buchhandlung Mander schilderten Detlef Heidenreich (1.v.li.) und Elfriede Thiele (3.v.li.) ihre persönlichen Erlebnisse zum Kriegsende. Andrea Appel (2.v.li.) und Elke Müldner (re.) begleiteten den Abend.
Erinnerungen, die nicht weichen
Martin Kimpel (87) über seine Kindheit im Zweiten Weltkrieg
Ottrau - Kriegsende in Immichenhain
Martin Kimpel (87) aus Immichenhain erinnert sich an das Kriegsende vor 80 Jahren. Martin Kimpel mit seiner Frau Erika beim Betrachten der alten Fotos.Repro: Susanne Luley
Die Mahnung sei verhallt, so die Riebelsdorferin. Der Ortsgruppenleiter habe sich nicht von seinem Ansinnen abbringen lassen. Und so fuhr er – ganz allein – in voller Uniform die Dorfstraße entlang mit dem Fahrrad Richtung Neukirchen, um sich dem Feind entgegenzustellen.
Nicht auszudenken, was dies für das Dorf bedeutet hätte, wenn sich wirklich irgendein Widerstand am Dorfrand formiert hätte.
Katharina Elisabeth Blumenauer, Zeitzeugin
Auf Höhe der Schule habe dies der Dorflehrer Schmitt gesehen und ihn in sprichwörtlich letzter Minute gestoppt, berichtete Katharina Elisabeth Blumenauer ihrem Enkel: „Lehrer Schmitt sah nämlich aus seiner Schulwohnung im Obergeschoss schon die Panzer von Rückershausen her anrollen.“
Daraufhin habe der Ortsgruppenleiter dank des beherzten Zuredens des Lehrers Schmitt von seinem Vorhaben abgelassen, so die bei Kriegsende 34-Jährige: „Nicht auszudenken, was dies für das Dorf bedeutet hätte, wenn sich wirklich irgendein Widerstand am Dorfrand formiert hätte.“
Am Gründonnerstag, 29. April 1945, erreichten die ersten amerikanischen Panzer Riebelsdorf. Es sei gerade Backtag gewesen und im Backhaus wurden Blechkuchen gebacken, sprach die Riebelsdorferin in das Diktiergerät ihres Enkels: „Als sie mit dem fertigen Blechkuchen unterm Arm in Rückershausen ankamen, hielten die Amerikaner an und aßen den Kuchen.“ Gebacken hatte den Kuchen die Familie Diengümpels aus Rückershausen.
Ganz Riebelsdorf sei voller Militär gewesen. „So 300 bis 400 Panzer und andere Fahrzeuge habe ich an diesem Tag gezählt. Endlose Kolonnen rollten auf der Dorfstraße. Wir standen ängstlich im Haus hinter den Gardinen, schauten, bewegten uns nicht und hofften nur, dass nichts passiert und sie vorbeifuhren.“
In jedem Jeep hätten mindestens zwei Soldaten – einer mit der Waffe nach links und einer mit der Waffe nach rechts im Anschlag gesessen, beschreibt Katharina Elisabeth Blumenauer die dramatischen Stunden: „Der Nachbarsjunge im Haus gegenüber stand ebenfalls hinterm Fenster – machte jedoch den Fehler ‚verdächtig‘ mit der Gardine zu wackeln und sofort sprangen zwei Bewaffnete vom Jeep und kontrollierten das Haus. Es ist aber nichts weiter passiert.“
Bereits kurz nach dem Einmarsch wurde der Ortsgruppenleiter von den Amerikanern festgenommen.
Polnische Zwangsarbeiter hätten ihn verraten, so die Riebelsdorferin: „Auf Riebelings Hof musste er sich breitbeinig vorne auf einen Panzer setzen und wurde – so zur Schau gestellt – abtransportiert.“
Ihr Bruder habe ihn später noch einmal in Kriegsgefangenschaft zufällig in einem der Rheinwiesenlager bei Bad Kreuznach gesehen, erzählte Katharina Elisabeth Blumenauer ihrem Enkel Bernd Hennighausen: „Er war schwer gezeichnet. Mehr als ein paar flüchtige Worte waren nicht möglich. Danach hat er ihn nie wieder gesehen.“
https://www.hna.de/
Gedenken 100 Jahre Erich Schulz mit Boris Pistorius
01.05.2025
Am 25. April 2025 gedachten Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und Gedenkstätte Deutscher Widerstand des vor 100 Jahren ermordeten Reichsbanner-Mitgliedes Erich Schulz in Berlin. Als Ehrengast sprach Verteidigungsminister Boris Pistorius.
Bericht von Jörg Sommer, Pressereferent des Bundesvorstandes
Erschlagen, erstochen, erschossen – Demokraten erinnern an die von den Nationalsozialisten ermordeten Angehörigen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Die Weimarer Republik war Deutschlands erste Demokratie. Und sie war vom ersten Tage an bedroht. Viele Menschen engagierten sich für ihren Schutz, unter anderem in der Republikschutzorganisation Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Das war gefährlich, oft lebendgefährlich. Schon vor 1933 fielen dem rechtsradikalen und nationalsozialistischen Terror mehr als 50 Angehörige des Reichsbannes zum Opfer.
In Berlin wurde am 25. April 1925 – also vor 100 Jahren – der Reichsbanner-Mann Erich Schulz auf offener Straße erschossen. Seine Beerdigung am 2. Mai wurde zur Demonstration für die Republik. Am Grab von Erich Schulz fanden bis 1933 Gedenkveranstaltungen für die von den Nationalsozialisten Ermordeten statt.
Diese Tradition haben das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und die Gedenkstätte Deutscher Widerstand 2017 wieder aufgenommen. Was zunächst mit nur wenigen Teilnehmern begann, entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einer immer größeren Veranstaltung. In diesem Jahr war der Andrang so groß, dass nur ein Teil der Anwesenden Platz in der Halle fand. Zahlreiche Kamerateams und Journalisten begleiteten die Veranstaltung. In Printmedien, Hörfunk und Fernsehen wurde ausführlich berichtet.
Nach der Begrüßung und Einführung von Prof. Dr. Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, sprach Bundesvorsitzender Dr. Fritz Felgentreu zu den Anwesenden. „Dass wir seiner hier gedenken, hängt nicht nur damit zusammen, dass er der erste Gefallene des Reichsbanners in Berlin war.“, schilderte Felgentreu. „Wir verdanken es auch dem glücklichen Umstand, dass sein Grab erhalten geblieben ist, obwohl es durch regelmäßige Gedenkveranstaltungen des Reichsbanners bis zum Untergang der Republik zumindest in diesem Teil Berlins bekannt gewesen sein muss.“
Felgentreu wies auch auf die zahlreichen anderen Opfer des Kampfs für die Demokratie hin: „Wir ehren mit dem unbekannten, parteilosen Arbeiter Erich Schulz einen Gegenpol zu dem wohl prominentesten Toten des Reichsbanners, dem für seinen Mut und seine Geradlinigkeit stets bewunderten bürgerlichen Sozialdemokraten Dr. Julius Leber. Diese beiden Männer versinnbildlichen, dass die Bereitschaft, mit höchstem Einsatz für Demokratie und Rechtstaat zu kämpfen, in allen Milieus des deutschen Volkes und selbst im Adel vorhanden war, wenn ich an Hubertus Prinz zu Löwenstein denke. Die Organisation dieser Bereitschaft war damals das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, dessen Erbe wir pflegen und dessen Werten wir uns verpflichtet fühlen. Denn das ist ja das eigentliche Wesen einer Gedenkkultur: Wir gedenken nicht für Erich Schulz, der nichts davon weiß, dass wir hier heute zusammengekommen sind. Und wir gedenken auch nicht um des Gedenkens willen, um geschichtsverliebt in der Erinnerung zu schwelgen. Sondern wir gedenken, um uns der Vorbilder und der Werte zu vergewissern, die uns in unserem Tun und Denken heute motivieren und zusammenhalten, als Bürgerinnen und Bürger unserer großartigen Republik. Damit machen wir uns immer wieder klar: Was für ein Privileg ist es doch, dass wir in Frieden und Wohlstand in einem freien Deutschland leben dürfen! Das ist es, was Erich Schulz sich gewünscht hat und wofür er gestorben ist. Erleben durfte er es nicht.“
Dass der Kampf für ein demokratisches Deutschland nicht nur ein Teil unserer Geschichte ist, betonte Felgentreu besonders: „Die Bundesrepublik ist nicht Weimar. Sie verfügt über starke Institutionen. Ihr Gewaltmonopol wird nicht infrage gestellt. Aber in Sicherheit wiegen dürfen wir uns deshalb noch lange nicht. Auch heute versuchen innere und äußere Feinde, die Demokratie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und ihre Institutionen für sich zu nutzen, um sie auszuhöhlen … Das Symbol unseres Auftrags sind die Farben Schwarz-Rot-Gold. Es ist ein grotesker Etikettenschwindel, wenn die geistigen Erben der Deutschnationalen und der Nationalsozialisten heute versuchen, sich dieser Farben zu bemächtigen. Wir werden die schwarz-rot-goldene Trikolore der deutschen Republik niemals dem Rechtsextremismus preisgeben, der sie vor hundert Jahren noch so erbittert bekämpfte!“
Im Anschluss sprach Verteidigungsminister Boris Pistorius zu den Anwesenden. Er betonte den unschätzbaren Wert unserer Demokratie: „Sie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben und unsere Zukunft frei und selbstbestimmt zu gestalten.“ Erich Schulz sei ein starker Verbündeter dieser Demokratie gewesen und habe sein Engagement für sie schließlich mit dem eigenen Leben bezahlt, so der Minister auf dem Berliner Friedhof Columbiadamm.
Heute, 100 Jahre nach dem politischen Mord an Erich Schulz, geraten Demokratien weltweit wieder unter Druck. Ihre Feinde gewinnen nicht nur in Deutschland und in Europa an Boden. Russland und andere Autokratien, so Minister Pistorius, hätten es dabei nicht nur auf die äußere Sicherheit abgesehen. Sie versuchten gleichzeitig, Demokratien von innen zu unterminieren – mit dem Ziel, Spaltung und Verunsicherung in offene, freiheitliche Gesellschaften zu tragen. „Unsere Demokratie ist erneut in Gefahr, so sehr, wie seit langem nicht mehr. Sie braucht unseren Schutz vor Bedrohungen von innen und außen. Sie muss verteidigt werden: jetzt und in Zukunft, weltweit und eben auch hierzulande“, appellierte Pistorius auf der Gedenkveranstaltung.
Die Demokratie gegen ihre Feinde zu verteidigen, sei jedoch nicht alleinige Aufgabe der Staatsgewalt, führte der Verteidigungsminister aus. Dazu brauche es auch und vor allem überzeugte Demokratinnen und Demokraten. Unverändert seit dem Tod von Erich Schulz gelte: „Demokratie braucht Menschen, die sich täglich für sie einsetzen und, wenn erforderlich, auch für sie kämpfen. Sie braucht Menschen, die sie zu schätzen wissen, die die Demokratie lieben, die sie tragen, aber eben auch bereit sind, sie zu beschützen.“
„Wir dürfen nicht zulassen, dass die Lautesten und Radikalsten den Ton angeben. Wir dürfen uns nicht wegducken. Sonst überlassen wir unsere Zukunft denjenigen, die unsere Demokratie zerstören wollen“, unterstrich Pistorius zum Ende seiner Ansprache und appellierte: „Kämpfen wir für unsere Demokratie!“ Im Anschluss legten Boris Pistorius, Johannes Tuchel und Fritz Felgentreu gemeinsam Kränze am Grab von Erich Schulz nieder. Gleiches tat für den Berliner Senat Christian Hochgrebe, Staatssekretär für Inneres.
Am Nachmittag desselben Tages fand das Gedenken eine würdige Fortsetzung mit der feierlichen Enthüllung einer Gedenktafel für Erich Schulz. Am Ort seines Wohnhauses steht heute das Deutsche Technikmuseum, dessen Direktor Joachim Breuninger die Gäste begrüße. Er freue sich sehr, dass die Gedenktafel an so prominenter Stelle platziert werden konnte, sagte Breuninger vor zahlreichen Teilnehmern. Nach kurzen Ansprachen von Johannes Tuchel und Fritz Felgentreu berichtete Staatssekretär a.D. André Schmitz über das Wenige, was wir über das zu kurze Leben von Erich Schulz wissen (weitere Informationen zur Kurzbiographie von Erich Schulz).
Es war ein besonderer Tag für das Reichsbanner und das Gedenken an die Verteidiger der Demokratie zu dem Kameradinnen und Kameraden des Reichsbanners aus dem ganzen Bundesgebiet angereist waren. Zu danken ist allen Beteiligten, die die Veranstaltung möglich gemacht haben, hierbei besonders den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gedenkstätte sowie den eingesetzten Kräften der Bundeswehr, die der Veranstaltung einen würdigen Rahmen verliehen haben.
Ausgewählte Medienberichte
Bericht in der Abendschau des rbb
Bericht in der Sendung „Kulturzeit“ auf 3sat
Bericht im Vorwärts
Artikel in der Süddeutschen Zeitung
Redemanuskripte
Ansprache Dr. Fritz Felgentreu, Bundesvorsitzender
Ansprache Bundesminister Boris Pistorius
Ansprache Staatssekretär a.D. André Schmitz
Impressionen
Bilder: Marius Grünhagen, Bild 45-57: Bundeswehr/Emmerich
https://www.reichsbanner.de/
80 Jahre nach dem Schrecken: Gedenken an die verhinderte Sprengung der Johannisbrücke in Miesbach
Stand:28.04.2025, 12:17 Uhr
Von: Fridolin Thanner
Gedenkstein Johannisbrücke
An der Johannisbrücke: Ein Gedenkstein erinnert an das couragierte Handeln einiger Miesbacher, die verhinderten, dass die Brücke gesprengt wurde. © Fridolin Thanner
Zum 80. Mal jährt sich die Verhinderung der Sprengung der Johannisbrücke in Miesbach am 1. Mai 1945. Bürger retteten die Brücke, ein Akt des Widerstands, der mit einer Gedenkfeier gewürdigt wird.
Miesbach – Das Ende des zweiten Weltkriegs und der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten jährt sich in diesen Tagen zum 80. Mal. Ende April 1945 rückten die Alliierten auch im Oberland vor, am 2. Mai zogen Amerikaner nach Miesbach ein. Davor sollte aber noch die Johannisbrücke über die Schlierach gesprengt werden. Mutige Miesbacher verhinderten das so wahnsinnige wie sinnlose Vorhaben der SS. Am Donnerstag (1. Mai) findet eine Gedenkfeier statt.
80 Jahre nach dem Schrecken: Gedenken an die verhinderte Sprengung der Johannisbrücke in Miesbach
Heute erinnert ein Gedenkstein an die Miesbacher, die am 1. Mai 1945 die Johannisbrücke unter Lebensgefahr vor der Sprengung bewahrten, wie an der Tafel auf dem Stein zu lesen ist. Die örtliche SPD erinnert nun „an dieses denkwürdige Ereignis und den Mut der Frauen und Männer“. Sie lädt deshalb für Donnerstag, 1. Mai, 16 Uhr, ans Denkmal an der Brücke.
Um die anrückenden US-Truppen aufzuhalten, sollte diese zerstört werden. „Es kam zu einem Handgemenge, bei dem ein Miesbacher von SS-Leuten gefangen genommen und gefoltert wurde. Er überlebte dank des raschen Fortkommens der amerikanischen Soldaten“, schreibt die SPD in ihrer Ankündigung der Gedenkfeier.
Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der verhinderten Sprengung der Johannisbrücke
Dabei wird nach der Einführung durch den angehenden Geschichtslehrer Patrick Stein der Miesbacher Stadthistoriker Alexander Langheiter den historischen Kontext erläutern. Zudem wird aus dem Zeugenbericht von Josef Seitz vorgelesen und Blumen niedergelegt. SPD-Vorstandsmitglied Thomas Acher möchte einen Bogen in die Gegenwart schlagen, für den musikalischen Rahmen der Gedenkstunde werden Gertraud und Jürgen Bügler sorgen.
Die verhinderte Sprengung der Johannisbrücke ist nur ein Beispiel der dramatischen Ereignisse in den letzten Kriegstagen in der Region. Dass die Stadt Miesbach am 2. Mai 1945 weitgehend friedlich übergeben wurde, ist mitunter dem als „Notbürgermeister“ eingesetzten Carl Feichtner – zuvor schon von 1919 bis 1938 Bürgermeister – zuzuschreiben.
Mutiger Widerstand und tragische Ereignisse in den letzten Kriegstagen
Aber es kam auch hier zu tragischen Ereignissen, wie etwa der damalige Stadtpfarrer Johann Trasbeger an die Erzdiözese München und Freising berichtete: Nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen habe der „Wahnsinn der SS“ noch vom Stadlberg aus Richtung Miesbach geschossen. Eine Frau starb, als ein Geschoss auf einer Straße einschlug. Ihr „wurde durch den Luftdruck die Lunge zerrissen, sie war sofort tot“, schrieb Trasberger.
Mahnung für die Zukunft
80 Jahre Kriegsende: Gedenkfeier im Waitzinger Park in Miesbach mit klarem Appell für die Demokratie
Gedenkfeier in Miesbach
Er berichtete auch von drei getöteten Buben gut eine Woche später: Sie fanden „in einer Wiese an der Straße nach Baum“ eine Panzerfaust, die explodierte, als einer der Buben sie wegwarf. Zwei seien sofort tot gewesen, einer starb am Abend im Krankenhaus. Ein vierter „kam mit dem Schrecken davon“.
Aber weder eines dieser, noch ein anderes Unglück der letzten Kriegstage steht am kommenden Donnerstag im Mittelpunkt. An diesem Tag jährt sich das couragierte Handeln von Miesbachern zum 80. Mal, die die Sprengung der Johannisbrücke verhinderten. Nicht nur die retteten sie, denn durch die Menge des Sprengstoffs wären „die Häuser in nächster Umgebung mit in die Luft geflogen“, wie Feichtner in seinen Aufzeichnungen festhielt.
https://www.dasgelbeblatt.de/
Une pétition pour demander l'entrée au Panthéon de l'Alsacienne Adélaïde Hautval, résistante et Juste parmi les nations
25.04.2025
Adélaïde Hautval, résistante et Juste parmi les nations. - Document familial
Diffusé le vendredi 25 avril 2025 à 7:31
Publié le vendredi 25 avril 2025 à 7:31
Le grand rabbin de France et la Fédération protestante de France ont demandé jeudi l'entrée au Panthéon d'Adélaïde Hautval, résistante alsacienne. Originaire du Hohwald, la protestante a été déportée à Auschwitz en tant qu"amie des Juifs" pendant la Seconde Guerre mondiale.
Plusieurs personnalités politiques et intellectuelles demandent, dans une initiative rendue publique jeudi, l'entrée au Panthéon de la résistante Adélaïde Hautval, protestante déportée à Auschwitz pour son soutien aux juifs.
L'initiative, lancée par le grand rabbin de France Haïm Korsia et le président de la Fédération protestante de France (FPF) Christian Krieger, vise à "reconnaître l'engagement d'Adélaïde Hautval contre l'oppression et l'injustice, en l'accueillant au Panthéon aux côtés d'autres grandes figures de la Nation".
"Cette demande va être étudiée avec toutes celles qui sont portées à la connaissance de la présidence de la République", a commenté l'Elysée.
Déportée à Auschwitz comme "amie des juifs"
Née en 1906 en Alsace, cette fille de pasteur, devenue médecin-psychiatre, a été arrêtée en 1942 et déportée à Auschwitz-Birkenau comme "amie des Juifs". En tant que médecin, elle a aidé de nombreux prisonniers et refusé de participer aux expérimentations menées par les nazis."Elle fait preuve de résistance à deux niveaux : en cachant les déportés, en protégeant les patients des chambres à gaz, en modifiant les feuilles de températures", détaille Denis Labayle, ancien médecin qui a consacré un livre à celle qu'on surnomme "Heidi".
Envoyée ensuite à Ravensbrück, Adélaïde Hautval a été **reconnue *"Juste parmi les nations" ***en 1965, un titre honorifique décerné par le mémorial de Yad Vashem. Elle est morte en 1988.
Une pétition en ligne
Un site a été créé et une pétition de soutien lancée avec, parmi les premiers signataires, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, l'ancien président François Hollande, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, l'historienne Annette Wieviorka, les écrivains Didier Decoin, Camille Laurens et David Foenkinos. "En faisant entrer cette femme au Panthéon, la France rendra hommage à toutes les résistantes de l'ombre, aux héroïnes inconnues ou mal connues qui ont permis à la République de garder ses valeurs de justice et de fraternité, en un temps où d'autres les bafouaient", soulignent les présidents du comité sur le site.
"Il se trouve qu'Adélaïde Hautval, dans la destinée qu'elle a connu pendant la Grande Guerre, correspond à l'idéal de la République, c'est-à-dire qu'elle incarne une conscience universelle qui respecte tout être humain", souligne le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, il est à l'origine de la proposition. "Elle correspond à ce que racontent les gens qui sont au Panthéon, au récit de la nation."
"Très humaniste, éthique, elle a fait preuve d'énormément de dévouement : ce sont des valeurs qui correspondent à celles dont on a besoin, à celles de la République aussi", estime Hélène Hautval, sa nièce, qui se dit "ravie qu'il y ait cette démarche de Panthéonisation pour elle".
Seulement sept femmes sont enterrées au Panthéon. Le conseiller mémoire du Président de la République a affirmé être favorable à l'entrée d'Adélaïde Hautval. Il doit en faire la proposition à Emmanuel Macron, qui validera ou non ce choix dans les prochaines semaines.
https://www.francebleu.fr
„Mutiger, selbstloser Einsatz“: Zeitzeugen erinnern sich an das Kriegsende in Melsungen
Stand: 31.03.2025, 17:00 Uhr
Von: Manfred Schaake
Melsungen / Kriegsende / Bilder von der alten Schule an der Kasseler Straße: Im Haus Nummer 35 lebte Otto Siemon mit seinen Eltern und beiden Brüdern Heinz und Kurt und seiner Schwester. Die längst abgerissene Stadtschule war im Krieg Lazarett. Foto: Manfred Schaake
Bilder von der alten Schule an der Kasseler Straße: Im Haus Nummer 35 lebte Otto Siemon. Die längst abgerissene Stadtschule war im Krieg Lazarett. © Manfred Schaake
Der Melsunger Arzt Dr. Heinrich Sostmann sorgte während des Kriegsendes im Ort für eine friedliche Übergabe. Nachfahren und Zeitzeugen erinnern sich.
Melsungen – An den Ostertagen vor 80 Jahren endet im Melsunger Land der Zweite Weltkrieg. Amerikanische Soldaten marschierten ein. Die Menschen hatten damals Angst, erinnern sich Zeitzeugen. Und freuen sich über 80 Jahre Frieden.
Ostern 1945 – vom 30. März bis 3. April – waren in der Region die Kampfhandlungen des Zweiten Weltkrieges zu Ende. Es ist dem praktischen Arzt Dr. Heinrich Sostmann (1892 – 1987) zu verdanken, dass die Kreisstadt Melsungen am Ostersamstag, 31. März 1945, ohne Kampfhandlungen an die Amerikaner übergeben wurde. Nach den Überlieferungen starben damals in Melsungen trotzdem etwa 15 Melsunger und deutsche Soldaten.
Melsungen / Kriegsende / Zeitzeugin Bärbel Appell mit einem Zeitungsbericht aus dem Jahr1965. Ihr Vater, der Oberstabsarzt Dr. Heinrich Sostmann, sorgte vor 80 Jahren dafür, dass Melsungen ohne Blutvergießen an die Amerikaner übergeben wurde. Auf Befehl der Wehrmacht sollte er als ranghöchster Offizier Melsungen gegen die Amerikaner verteidigen. Er widersetzte sich der sinnlosen Anordnung und verhinderte ein Blutvergießen. Foto: Manfred Schaake
Bärbel Appell mit einem Zeitungsbericht aus dem Jahr 1965: Ihr Vater sorgte vor 80 Jahren dafür, dass Melsungen ohne Blutvergießen an die Amerikaner übergeben wurde. © Manfred Schaake
Dr. Sostmann habe durch seinen mutigen, selbstlosen und zukunftsweisenden Einsatz seine Heimatstadt vor größerem Schaden bewahrt und eine Eskalation vermieden. Das hatte Melsungens Bürgermeister Markus Boucsein vor zehn Jahren gesagt, als er auf dem alten Friedhof einen Kranz auf Sostmanns Grab niedergelegt hatte.
Das Wehrkommando Kassel hatte dem Oberstabsarzt als dem ranghöchsten Offizier Melsungens und zugleich Chef der Lazarette mit über 500 Verwundeten befohlen, die Stadt mit Hilfe der verletzten Soldaten zu verteidigen. Dem hat sich Sostmann widersetzt, und er hat später protokolliert: „Blutvergießen und Brand mussten unter allen Umständen vermieden werden. Der Bürgermeister und alle Parteigrößen hatten sich in Richtung Kirchhof abgesetzt, ich allein hatte die Verantwortung.“
Tochter erinnert sich
Sostmanns Strategie: Die Amerikaner müssen darüber informiert werden, dass es in Melsungen keinen Widerstand geben werde, dass Hunderte von Verwundeten in der Stadt seien sowie viele Ausgebombte – meist Frauen und Kinder.
Auch heute noch erinnert sich Sostmanns Tochter Bärbel Appell (88): „Da in den Lazaretten im Krankenhaus, im Lutherhaus, im Alten Casino, in der Landwirtschaftsschule und im ehemaligen Gymnasium mehr als 500 verletzte Soldaten versorgt werden mussten, konnte mein Vater die Stadt nicht verlassen.“ Er schickte seinen Assistenzarzt Dr. Nell, den Sanitäts-Unteroffizier Günther Matthaei und den Auslandskaufmann Hermann Schaefer als Dolmetscher mit unserem Opel P4 mit weißer Fahne entgegen. Etwa dorthin, wo heute die Sostmann-Hütte steht.“
Melsungen / Bartenwetzerbrücke Melsungen / Foto: Manfred Schaake
Sehenswürdigkeit Bartenwetzerbrücke, erbaut 1595/96 unter Landgraf Moritz. Wehrmacht-Soldaten sprengten einen Teil vor dem Einmarsch der Amerikaner. Die fuhren mit ihren Panzern durch den Fluss in Richtung Kirchhof. © Manfred Schaake
Matthaei hat protokolliert, dass am Gründonnerstag ein 22-jähriger SS-Offizier „sehr herrisch“ Melsungen zu einer Stadt erklärt hatte, die verteidigt werden müsse. Drei Brücken hat die SS dann vor dem Einmarsch der Amerikaner gesprengt. Matthaei: „Völlig sinnlos, wir waren alle empört.“
In den Verhandlungen mit den Amerikanern bei Melgershausen baten die drei Melsunger um den Schutz der Lazarette. Die wurden dann von den Amerikanern gut mit Medikamenten, Verbandsmaterial und Lebensmitteln versorgt. Er habe seine Lazarett-Tätigkeit ungestört fortsetzen können, hat Sostmann schriftlich festgehalten. Vor dem Einmarsch der Amerikaner hatte der Arzt großes Glück. Ehrenbürgermeister Dr. Ehrhart Appell (1934 -2022) sagte uns vor fünf Jahren: „Ein SS-Kommamndo war zurückgekommen und hatte nach Sostmann gesucht. Ihm drohte die Erschießung.“ Der Architekt Berthold Schweitzer hatte Sostmann rechtzeitig gewarnt. Der Arzt versteckte sich.
Frieden als größtes Geschenk
Seine Tochter Bärbel Appel, die im Oktober 1943 die Bombardierung Kassels und das Leid der Menschen miterlebt hatte, ist heute noch dankbar und zufrieden, dass der schreckliche Krieg damals im Melsunger Land auf diese Weise endete: „Das größte Geschenk meines Lebens ist, dass ich, ohne nochmals Krieg erleben zu müssen, 80 Jahre im Frieden leben darf.“
„Amerikanische Truppen besetzen den Kreis Melsungen, das Geschick der Bartenwetzerstadt hing am seidenen Faden, Niedermöllrich hatte zwei Tage früher schwer leiden müssen.“ Unter dieser Überschrift berichtete das Melsunger Tageblatt am 31. März 1965 ganzseitig über den Einmarsch der Amerikaner in den damaligen Landkreis Melsungen.
Im Handbuch des Kreises Melsungen hatte der Kreisdeputierte und Heimatchronist Julius Müller 1950 geschrieben: „Als am Gründonnerstag 1945 die Mitteilung kam, dass Bad Wildungen besetzt sei, da wussten die Kreisbewohner, dass auch für sie die Schicksalsstunde geschlagen hatte.“ Niedermöllrich an der Grenze zwischen den Kreisen Fritzlar und Melsungen wurde zu einem Stützpunkt ausgebaut, die 1881 gebaute Ederbrücke wurde gesprengt, was den Vormarsch der Amerikaner keinesfalls aufhalten konnte.
48 Stunden unter Beschuss
Müller: „Durch den Widerstand unserer Truppen lag das Dorf fast 48 Stunden unter Feindbeschuss. Ein Flammenmeer hüllte das Dorf ein, Rettung war nicht möglich.“ Am 30. Märzwaren die Amerikaner in breiter Front auf den Kreis Melsungen vorgerückt. Nachmittags war eine Linie Melgershausen-Heßlar Beuern-Hilgershausen-Dagobertshausen-Wichte erreicht. Ostersamstag näherten sich die Amerikaner Melsungen. Der am 22. Januar 1938 in Melsungen geborene Otto Siemon erinnert sich heute noch gut an die Ereignisse. Er ist mit seinen Brüdern Heinz, Kurt und seiner Schwester Martha mit den Eltern Else und Georg im Haus Kasseler Straße 35 aufgewachsen. Die Einschulung als Sechsjähriger habe er noch in guter Erinnerung.
Im HNA-Gespräch sagt er: „Ich habe im Volksempfänger den Diktator Hitler brüllen hören, wortwörtlich den damaligen Propagandaminister Goebbels schreien hören und 20.000 bis 25.000 Nazis, die auf die Frage ‚Wollt Ihr den totalen Krieg?‘ hysterisch Ja gebrüllt haben.“ „Wir Kinder schliefen nur im Trainingsanzug“, erzählt Siemon. Und immer, wenn es bei Luftangriffen auf Kassel Alarm gab, „liefen wir mit unserer Mutter in den sogenannten Eiskeller an der Schlossstraße“. Damals habe man immer Angst gehabt: „Es war ganz schrecklich, aber am Ende waren wir alle froh, dass Melsungen kampflos übergeben und dadurch außer Kleinigkeiten nichts mehr zerstört wurde“.
Siemon stand damals als Siebenjähriger an der Kreissparkasse und erlebte mit, als sich der Opel P4von Dr. Sostmann mit weißer Fahne Richtung Kesselberg bewegte, mit dem Ziel der Insassen,Melsungen vor einem Angriff zu verschonen und die Stadt kampflos zu übergeben. „Im letzten Moment haben die Nazis noch einen Bogen der schönen alten Bartenwetzerbrücke gesprengt. Das war absoluter Schwachsinn.“
(m.s.) Melsungen / Dr. Heinrich Sostmann / Repro: Manfred Schaake © Manfred Schaake
Die amerikanischen Panzer fuhren nach den Worten Siemons „mit Leichtigkeit“ durch die Fulda Richtung Carl-Braun-Straße in Richtung Kirchhof. Otto Siemon arbeitete 40 Jahre als Feinmechaniker bei B. Braun, war Leiter der Entwicklungsabteilung. „Ich bin ein echter Braunianer“, sagt er stolz. Während seiner Bundeswehrzeit war er beim Heeresmusikkorps der 2. Panzergrenadierdivision eingesetzt. Seit 1965 lebt er in Schwarzenberg. Für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement wurde er unter anderem mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen und vom Schwalm-Eder-Kreis ausgezeichnet.
Er war unter anderem Ortsvorsteher, hat den TSV Schwarzenberg mit aufgebaut, war Spielertrainer, Spartenleiter der Fußballer, 2. Vorsitzender und Bauleiter des neuen Sportplatzes mit 5500 Stunden Eigenleistung. Dankbar blickt er heute mit Ehefrau, Tochter, Sohn, vier Enkeln und einem Urenkel auf die 80Jahre zurück: „Nachdem sich Hitler so grausam benommen hatte, konnte es 1945 für ganz Deutschland kein schöneres Geschenk geben als den Frieden.“ Seine Wünsche: „Dass endlich auch in der Ukraine wieder Frieden herrscht, es in Deutschland wieder aufwärts geht und die Wirtschaft wieder zum Laufen kommt.“ (Manfred Schaake)
https://www.hna.de/
Veranstaltung am Sonntag
Nazis in Frohnau überlebt: Ein Zeitzeuge erzählt über sein Leben
24.01.2025, 17:08 Uhr • Lesezeit: 1 Minute
Dirk Krampitz
Im Gemeindesaal der Johanneskirche am Zeltinger Platz gibt es am Wochenende zwei interessante Veranstaltungen.
© Dirk Krampitz | Dirk Krampitz
Berlin. Als Sohn kommunistisch-jüdischer Eltern hat Peter Neuhof die Nationalsozialisten überlebt. Im Gespräch erzählt er aus seinem Leben.
Peter Neuhof wurde 1925 in Frohnau geboren und hat sein ganzes Leben dort gewohnt. Als Sohn kommunistisch-jüdischer Widerstandskämpfer überstand er mit viel Glück die Zeit der Nationalsozialisten in Deutschland. Sein Vater hingegen wurde im Konzentrationslager Sachsenhausen ermordet, seine Mutter inhaftiert. Nach dem Krieg war er als Journalist und West-Berlin-Korrespondent des DDR-Rundfunks im Kalten Krieg ein außergewöhnlicher Grenzgänger zwischen den politischen Systemen. Auf der Grundlage seiner Tagebücher und der seines Vaters entstanden mehrere Veröffentlichungen.
Am Sonntag um 15 Uhr ist Neuhof, mittlerweile 99 Jahre alt, im Rahmen der Studientage der Evangelischen Kirchengemeinde Frohnau zu Gast. Unter dem Titel „Überleben in Frohnau 1933-1945“ erzählt er im Gespräch mit Trille Schünke-Bettinger aus seinem Leben. Die Historikerin entstammt ebenfalls einer Familie von Reinickendorfer Widerstandskämpfern und widmet sich als Politikwissenschaftlerin und Zeithistorikerin besonders dem Widerstand von Frauen im Nationalsozialismus. Moderiert wird die Diskussion von Dorothee Bernhardt, der zweiten Vorsitzenden des Bürgervereins Frohnau. Die Veranstaltung findet im Gemeindesaal der Johanneskirche Frohnau am Zeltinger Platz statt.
Bereits am Sonnabend gibt es Vorträge zum Kirchenbau und der Geschichte
Bereits am Sonnabend findet in der Johanneskirche eine Veranstaltung zur vielschichtigen Geschichte des Kirchenbaus in Frohnau statt. Neben Vorträgen u.a. von Pfarrer Ulrich Schöntube, der Kunsthistorikerin Beate Rossié zu Kirchenbauten im Nationalsozialismus und zu neuen Erkenntnissen zum Pfarrer Herman Tönjes von Christoph Anders wird der erste Vorsitzende des Bürgervereins Frohnau, Carsten Benke, zum Wettbewerb für den Kirchenbau von 1930 vortragen und bisher kaum bekannte historische Zeichnungen aus dem Kirchenarchiv vorstellen.
https://www.morgenpost.de/
Die Geschichte der Organisation Reichs-Banner Schwarz-Rot-Gold – Eine Ausstellung im Deutschen Bundestag –
Infos in Leichter Sprache
04.10.2024 | PDF | 625 KB
Manche Mitglieder vom Reichs-Banner waren in einer demokratischen Partei. Andere Mitglieder vom Reichs-Banner waren in keiner Partei. Die Organisation Reichs-Banner hat vor Demokratie-Feinden gewarnt. In der Weimarer Republik gab es viele Demokratie-Feinde. Die Demokratie-Feinde wollten die Demokratie abschaffen.
https://www.bundestag.de/
Geschichte
Ausstellung Wehrhafte Demokratie über Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold eröffnet
Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat am Mittwoch, 25. September 2024, die Ausstellung „Wehrhafte Demokratie – Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und die Verteidigung der Weimarer Republik“ eröffnet. Anlass ist der 100. Jahrestag der Gründung des Reichsbanners. Die Ausstellung wird von Donnerstag, 26. September, bis Freitag, 18. Oktober 2024, gezeigt und kann montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr in der Halle des Paul-Löbe-Hauses des Bundestages in Berlin-Mitte besichtigt werden.
Es handelt sich dabei um eine Ausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Zusammenarbeit mit dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund aktiver Demokraten e. V., die von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Claudia Roth, gefördert wird.
Bas: Mahnung und Aufruf zur Wehrhaftigkeit
Bei der Ausstellungseröffnung am Mittwoch, 25. September, betonte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas im Beisein des Reichsbanner-Bundesvorsitzenden, des früheren Berliner Bundestagsabgeordneten Dr. Fritz Felgentreu, mit dieser Ausstellung würden die weit über eine Million Menschen geehrt, die als Mitglieder des Reichsbanners die Weimarer Verfassung gegen die „Feinde der Demokratie auf der links- und rechtsextremen Seite“ – am Ende nicht erfolgreich – verteidigt hätten.
Das Reichsbanner könne bis heute stolz darauf sein, so Bas, dass es sich immer gegen Antisemitismus und Extremismus positioniert hatte. „Die Mitglieder des Reichsbanners standen ein für ihre politischen Überzeugungen und identifizierten sich mit der Republik“, sagte die Bundestagspräsidentin. Derzeit sei zu beobachten, wie politische Kräfte „unseren Staat verächtlich machen“, durch Desinformation, das Schüren von Vorurteilen gegenüber Minderheiten und das Bedienen und Verstärken von Ängsten der Menschen.
Populismus sei allgegenwärtig und ziele letztlich „auf unsere freiheitliche und vielfältige Demokratie“. Die Ausstellung sei Mahnung und Aufruf an alle Demokratinnen und Demokraten, „wehrhaft“ zu sein. Bas schloss mit dem Gruß des Reichsbanners: „Freiheit!“
Größte demokratische Organisation der Weimarer Republik
Mit mindestens 1,5 Millionen Mitgliedern war das 1924 gegründete Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold die größte demokratische Organisation der Weimarer Republik. In den Jahren zuvor war die junge Republik Angriffen von Rechts- und Linksextremisten ausgesetzt. Politische Morde und Aufstandsversuche erschütterten die Demokratie.
Im Reichsbanner engagierten sich Parteilose sowie Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), der liberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) und der katholischen Zentrumspartei (Zentrum). Ziel des Bundes war es, die Demokratie gegen ihre Feinde zu verteidigen. Als Gegner standen dem Reichsbanner Nationalsozialisten, Monarchisten und Kommunisten gegenüber.
Schutz politischer Versammlungen und Demonstrationen
Das Reichsbanner engagierte sich in besonderer Weise für die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland. Eine zentrale Aufgabe des Reichsbanners bestand im Schutz politischer Versammlungen und Demonstrationen. Ein weiterer Schwerpunkt war die politische Bildung. Lange vor 1933 machte der republikanische Bund auf die drohende Zerschlagung der Demokratie durch die Nationalsozialisten aufmerksam.
Gegen Ende der Weimarer Republik traten Reichsbanner-Angehörige immer stärker gegen die NS-Bewegung auf. Zu deren Abwehr bildeten SPD, ihr nahestehende Massenorganisationen und Reichsbanner 1931 das Bündnis „Eiserne Front“. Auch nach 1933 waren zahlreiche Mitglieder des Reichsbanners nicht bereit, sich den Nationalsozialisten unterzuordnen. Sie beteiligten sich am Widerstand gegen die Diktatur.
Geschichte des Reichsbanners in vier Abschnitten
Nach Kriegsende war es ehemaligen Mitgliedern des Reichsbanners ein Anliegen, dass sich Bürgerinnen und Bürger für eine demokratische Gesellschaft verantwortlich fühlen. Die Ausstellung widmet sich der Geschichte des Reichsbanners in vier Abschnitten. Der erste Schwerpunkt liegt auf der Gründungsphase und den Zielen des Reichsbanners, der zweite auf den Aktivitäten der Republikverteidigung durch das Reichsbanner.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Widerstand von Angehörigen des Reichsbanners gegen den Nationalsozialismus. Das abschließende vierte Kapitel zeigt das politische Engagement ehemaliger Angehöriger des Reichsbanners nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Ausstellung greift auf neueste Forschungsergebnisse zurück und präsentiert zahlreiche bisher unbekannte Fotos und Dokumente.
Ausstellungsbesuch mit Anmeldung
Für den Besuch der Ausstellung ist spätestens zwei Werktage vor dem gewünschten Besuchstermin über dieses Anmeldeformular eine Anmeldung notwendig. Aus organisatorischen Gründen ist ein Besuchsbeginn jeweils nur zur vollen Stunde möglich. Spätester Besuchsbeginn ist jeweils 16 Uhr. Anmeldebestätigungen werden nicht erteilt.
Die Ausstellung ist über den Westeingang des Paul-Löbe-Hauses, Konrad-Adenauer-Str. 1, 10557 Berlin, zugänglich. Bitte finden Sie sich 15 Minuten vor dem Besuchstermin beim Personal der Westpforte ein, damit ausreichend Zeit für die Einlasskontrolle besteht.
Öffentliche Führungen
Öffentliche Führungen mit Vertretern der Gedenkstätte Deutscher Widerstand beziehungsweise dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund aktiver Demokraten e. V. werden wie folgt angeboten:
- Donnerstag, 26. September 2024, 15 Uhr
- Dienstag, 1. Oktober 2024, 15 Uhr
- Dienstag, 8. Oktober 2024, 15 Uhr
- Mittwoch, 9. Oktober 2024, 15 Uhr
- Dienstag, 15. Oktober 2024, 15 Uhr
- Mittwoch, 16. Oktober 2024, 15 Uhr.
Bitte melden Sie sich zu der gewünschten Uhrzeit über das oben genannte Anmeldeformular an, wenn Sie einen der Führungstermine wahrnehmen möchten. (26.09.2024)
https://www.bundestag.de/
Würdigung deutscher Résistance-Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg
Deutscher Bundestag
Drucksache 20/12573
20. Wahlperiode
Antwort
der Bundesregierung
12.08.2024
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jan Korte, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Gruppe Die Linke– Drucksache 20/12309
Vorbemerkung der Fragesteller
Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren immer wieder den Mut und die Verdienste von Menschen gewürdigt, die in verschiedenen Formen Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben. Ohne jede Würdigung blieben dabei bislang diejenigen Deutschen, die sich während des Zweiten Weltkriegs der französischen Résistance anschlossen und so im Kampf gegen den Hitler-Faschismus ihr Leben einsetzten.
https://dserver.bundestag.de/
Buchauszug aus „Wir Kinder des 20. Juli“
Als Ex-Soldat über den Tod des Hitler-Attentäters spricht, hält er den Atem an
Dokumentarfilm: Szenenfoto mit Horst Naumann (mit Augenklappe): kurz vor der Hinrichtung im Bendlerblock.
Imago, Copyright: Roba/MaxxSchweigmann UnitedArchives24345 Dokumentarfilm: Szenenfoto mit Horst Naumann (mit Augenklappe): kurz vor der Hinrichtung im Bendlerblock.
- FOCUS-online-Autor Tim Pröse
Mittwoch, 12.06.2024, 22:13
Vor 80 Jahren zündete Claus Graf von Stauffenberg die Bombe, die Hitler töten sollte. Der Bestsellerautor Tim Pröse traf letzte Zeitzeugen des Attentats und die Nachfahren der Helden. In seinem neuen Buch „Wir Kinder des 20. Juli. Die Töchter und Söhne des Widerstands gegen Hitler erzählen ihre Geschichte“ stellt er sie vor. Ein Auszug.
Bis heute steht dieser Ort des Abgrunds jedem offen. Jeder kann den Hinrichtungsraum in der Gedenkstätte Plötzenseee in Berlin besuchen. Jeder kann unter den Fleischerhaken stehen, an denen die Männer des 20. Juli 1944 „aufgehängt wurden wie Schlachtvieh“, so hatte es Hitler persönlich verfügt. An Drahtschlingen, nicht an Seilen.
Es ist die Absicht der Schergen, dass die Männer des 20. Juli an den Fleischerhaken von den Drahtschlingen langsam stranguliert werden. Der Unterschied zum üblichen Vorgehen: Einem Gehenkten wird meist das Genick gebrochen vom Gewicht des hinabfallenden Körpers. Die Opfer in Plötzensee aber werden von ihren Henkern absichtlich langsam in die Schlingen hineingehoben, um den Genickbruch zu vermeiden.
Die Drahtschlingen statt der sonst üblichen Seile wählen die Henker zudem aus, um noch einmal die Qualen zu vergrößern, denn sie schneiden sich in den Hals hinein. Manchmal ziehen die Schergen den Männern in ihrem Todeskampf die Hosen herunter, um sie in ihren letzten Momenten auch noch zu demütigen.
Stauffenbergs Fahrer traf ich vor ein paar Jahren
Bis ins letzte Detail hin hatte Hitler alles angeordnet. So wurde auch der Eisenbalken mit den Fleischerhaken in den Hinrichtungsschuppen gebaut. Den Todeskampf der Widerständigen ließ er für sein Privatkino filmen. Deswegen war der Hinrichtungsraum in Plötzensee grell von Scheinwerfern ausgeleuchtet.
Mehr als 150 Männer und Frauen des 20. Juli ließ der Massenmörder so hinrichten. Sie kamen aus allen Teilen der Gesellschaft, aus dem Militär, der Kirche, dem Zivilleben, von links bis rechts. Mit den Kindern dieser Opfer besuchte ich diesen Ort in Berlin-Plötzensee. Für mein neues Buch „Wir Kinder des 20. Juli. Die Töchter und Söhne des Widerstands gegen Hitler erzählen ihre Geschichte“.
Für die weiblichen Widerstandskämpferinnen wie Elisabeth von Thadden und später auch für Elisabeth Kuznitzky und Elisabeth Gloeden wurde extra eine Guillotine in den Raum gestellt, um sie zu köpfen. Ein fast baugleiches Modell wie jenes Fallbeil, mit dem auch Sophie und Hans Scholl und die Mitstreiter der Weißen Rose, Kurt Huber, Willi Graf, Alexander Schmorell und Christoph Probst in München ermordet wurden.
Stauffenbergs Fahrer traf ich vor ein paar Jahren. Da war er der letzte noch lebende Zeitzeuge, der Stauffenbergs letzte Worte gehört hatte. Im Juli 44 war er ein einfacher Soldat im Bendlerblock gewesen. Und wenn er nach all den Jahren als alter Herr kurz seine Augen schloss und innehielt, konnte er Oberst Stauffenberg immer noch rufen hören.
Er musste dafür nur kurz seinen Atem anhalten. Dann klangen die letzten Worte des Grafen in ihm nach. So sehr hatten sie sich verfestigt in seinen Erinnerungen. „Es lebe das heilige Deutschland!“
Das neue Buch von Tim Pröse (Anzeige)
Wir Kinder des 20. Juli. Die Töchter und Söhne des Widerstands gegen Hitler erzählen ihre Geschichte
Ab 19,99 € bei Amazon
„Er hat ihn förmlich in die Kugeln hineingerufen“
In der Nacht des 20. Juli 1944 steht Splinter an einem Fenster des Bendlerblocks und schaut hinab auf die vier Männer, die sich gleich vor einen Sandhaufen stellen müssen. Nicht einer nach dem anderen, wie so oft in den Filmen dargestellt, sagt Splinter, sondern nebeneinander.
Hans Splinters Kameraden bekommen den Befehl, diese düstere Szenerie mit den Scheinwerfern ihrer Fahrzeuge zu beleuchten. Splinter hört die Schritte des Erschießungskommandos, dann das Geräusch der durchladenden Gewehre.
Ein Kommandeur sieht Splinter oben an einem der Fenster stehen und brüllt ihm zu, er solle sofort verschwinden. Splinter duckt sich unter das offene Fenster, sodass er nur noch hören kann, was nun geschieht. Der Kommandeur unten im Hof schreit: „Legt an!„, und dann schreit er: „Feuer!“
Bevor Claus Schenk Graf von Stauffenberg von den Kugeln des Erschießungskommandos getroffen niedersinkt, hört Hans Splinter ihn rufen: „Es lebe das heilige Deutschland!“ Andere Zeugen wollen nur „Es lebe Deutschland!“ oder auch „Es lebe das geheime Deutschland!“ verstanden haben. Letzteres hätte dann eine Anspielung auf die Gedankenwelt des Dichters Stefan George sein können, den der Graf so sehr verehrte.
Doch Hans Splinter ist sicher: „Er rief ganz deutlich: ›Es lebe das heilige Deutschland!‹ Und ich fand es enorm, dass er diesen Satz noch loswerden konnte. Er hat ihn förmlich in die Kugeln hineingerufen.“
Stauffenberg und seine Mitstreiter werden auf dem St--Matthäus-Kirchhof verscharrt
Sonderbar wirkt dieser Satz heute, in Zeiten, in denen kaum jemandem noch etwas heilig ist. Deswegen missverstehen ihn auch so viele. Vielleicht versteht man ihn heute besser, wenn man bedenkt, dass Stauffenberg Patriot und gläubiger Christ war. Dass ihm sein Land heilig im Sinne von „geliebt“ war. Dass auch er am Anfang von Hitler geblendet und von dessen militärischen Erfolgen berauscht war. Aber dass er sich dann verwandelte.
Der Graf wollte nicht länger hinnehmen, dass sein Land, das er liebt, untergeht. Stauffenberg stand für ein Deutschland, das der Naziideologie menschliche Werte entgegensetzte. „Der sittliche Wert eines Menschen beginnt erst dort, wo er bereit ist, für seine Überzeugung sein Leben hinzugeben“, hatte Henning von Tresckow, der große geistige Anführer und Initiator der Verschwörer, gesagt, und genau so handelte Stauffenberg. Er war bereit, sich zu diesen Werten zu bekennen und alles für sie zu geben. Sich selbst zu geben.
Der 20. Juli kam keineswegs zu spät, wie so oft angenommen: Nach ihm kamen mehr Menschen ums Leben als in all den Jahren des Kriegs zuvor!
Noch in den frühen Morgenstunden des 21. Juli 1944 werden Stauffenberg und seine Mitstreiter auf dem St.-Matthäus-Kirchhof verscharrt. Bis heute erinnert ein Gedenkstein auf dem Friedhof der heutigen Zwölf-Apostel-Gemeinde in Berlin-Schöneberg, dass die Männer dort für ein paar Stunden in der Erde lagen.
Denn Reichsführer Heinrich Himmler lässt sie wieder ausgraben. Am Hals des gläubigen Stauffenberg finden die SS- Leute eine Kette mit einem Kreuz. Sie verbrennen die Leichen. Nichts soll an die Männer des 20. Juli erinnern. Ihre Asche wird, so mutmaßen einige Historiker, über den Rieselfeldern Berlins verstreut, auf denen damals Abwässer geklärt wurden.
Da sind nur ihre Galgen, die an ihren letzten Moment erinnern
Womöglich trifft das Gleiche für die am 8. September 1944 Ermordeten in Plötzensee zu. Gesichert ist nur, dass die Erhängten in das Krematorium Berlin-Wilmersdorf gebracht und dort eingeäschert werden.
Einen Tag später bringt ein Arbeiter des Krematoriums die Aschereste in einem unauffälligen Karton in das Reichsjustizministerium an der Wilhelmstraße. Sie liegen jedenfalls nicht in Gräbern, auf die ihre Nächsten Blumen legen könnten. Da sind nur ihre Galgen, die an ihren letzten Moment erinnern.
Am 8. September 1944 schrieb der „Reichsminister der Justiz, Sonderreferat Ministerialrat Franke“, an einen Stadtobersekretär im Krematorium Berlin-Wilmersdorf:
„Unter Bezugnahme auf die fernmündliche Besprechung ... ersuche ich, die Ihnen heute aus der Strafanstalt Plötzen see zugeführten ... Leichen sofort formlos einzuäschern, und die Asche nicht getrennt in Behältern, die so verpackt sind, dass auf ihren Inhalt nicht geschlossen werden kann, dem Reichsjustizministerium ... zur Verfügung zu stellen.“
„Ihr weiterer Verbleib ist ungeklärt“, dokumentiert die Gedenkstätte in Plötzensee. In ihrem Hof steht heute eine Urne aus Stein, gefüllt ist sie mit Erde aus mehreren deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagern. Ein Symbol, das das Gedenken an den Widerstand und das Erinnern an die Opfer in Auschwitz, Belzec, Majdanek, Treblinka und all die anderen Verbrechensorte für immer einschließt.
Die Nazis brachen mit dem Menschsein
Dass die Menschen des 20. Juli ohne Gräber irgendwo im Nichts ruhen, eint sie mit den meisten Opfern der Shoah, deren Asche so oft namenlos verstreut ist. Die durch die Schornsteine in den Himmel wehte.
Was von diesen Menschen blieb, hat sich in Luft aufgelöst. Aber sind sie deswegen verschwunden? Nichts geht verloren auf der Welt, heißt es. Dann auch nicht die Asche im Wind.
Und Luft, auch wenn sie Asche in sich trägt, ist doch lebenswichtig. So wie die Erinnerung lebenswichtig ist in Deutschland. Ohne sie können wir in diesem Land nicht frei atmen.
Seine Nächsten zu bestatten, ist etwas zutiefst Menschliches. Es unterscheidet den Menschen vom Tier. Man sagt, der Mensch sei erst Mensch geworden, als er irgendwann begann, seine Toten zu begraben.
Die Nazis brachen mit dem Menschsein, als sie anfingen, Menschen ausrotten zu wollen. Dann kamen sie auf die Idee, ihren Opfern ein Grab zu verweigern. Denn auch ihre Familien sollten leiden und vergessen gemacht werden.
Das neue Buch von Tim Pröse heißt: „Wir Kinder des 20. Juli. Die Töchter und Söhne des Widerstands gegen Hitler erzählen ihre Geschichte“ (Heyne, 365 Seiten, 22 Euro). In ihm porträtiert Pröse neben Berthold von Stauffenberg unter anderem Klaus von Dohnanyi, Carl Goerdeler und Helmuth Caspar Graf von Moltke.
https://www.focus.de/
Aufstand im Warschauer Ghetto
Als sich Hunderte Juden der SS widersetzten
Mittwoch, 19. April 2023
Eigentlich sollte es ein Geburtstagsgeschenk für Adolf Hitler werden: die Räumung des Warschauer Ghettos. Doch etwas läuft nicht nach Plan. Jüdische Aufständische liefern sich wochenlang einen erbitterten Kampf mit den übermächtigen SS-Schergen.
https://www.n-tv.de/
Siehe auch:
"Marsch der Lebenden": Israel gedenkt der Opfer des Holocaust
Von Euronews mit dpa • Zuletzt aktualisiert: 18/04/2023 - 19:34
Tausende Menschen, darunter auch Holocaust-Überlebende, haben sich in Auschwitz am "Marsch der Lebenden" beteiligt. Bei der jährlichen Veranstaltung wird der rund sechs Millionen Opfer des durch die Deutschen begangenen Völkermordes an der jüdischen Bevölkerung Europas während des Zweiten Weltkriegs gedacht. Der Tag Jom Ha-Schoah wird in Israel seit 1951 begangen.
In diesem Jahr wird gleichzeitig der 80. Jahrestag des jüdischen Aufstandes im Warschauer Ghetto begangen. Der verzweifelte Kampf gegen die deutschen SS-Truppen, der am 19. April 1943 begann, endete rund vier Wochen später. Nur wenige Warschauer Juden überlebten. Am Mittwoch wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der zentralen Gedenkfeier in Warschau eine Rede halten.
Anlässlich des Holocaust-Gedenktages wurde in Israel eine Schweigeminute abgehalten. Der Verkehr kam in diesem Augenblick zum Erliegen, die Bevölkerung hielt inne, um der Opfer zu gedenken.
Netanjahu beschwört die innere Einheit
In der Gedenkstätte Yad Vashem nahmen Israels Staatsoberhaupt Jitzchak Herzog und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an einer Gedenkveranstaltung und einer Kranzniederlegung teil.
Netanjahu sagte, die Geschichte des Aufstands verpflichte die Israelis zur inneren Einheit. "Nur so können wir die besiegen, die uns zerstören wollen." Heute sei dies der Iran, der an einer Aufrüstung mit Atomwaffen gehindert werden müsse.
Teheran droht mit Zerstörung
Nur wenige Stunden später drohte der Iran dem Land erneut. "Der kleinste Fehler ihrerseits gegen die Sicherheit unseres Landes wird begegnet mit der Zerstörung der Städte Tel Aviv und Haifa", sagte Irans Präsident Ebrahim Raisi im Staatsfernsehen.
Bereits in der Vergangenheit hatten iranische Präsidenten dem Erzfeind Israel mit Zerstörung gedroht. Besonders umstritten war der Hardliner Mahmud Ahmadinedschad, der von 2005 bis 2013 Präsident war. Raisi kam im Sommer 2021 an die Macht. Der Regierungsstil des konservativen Geistlichen wird seitdem viel kritisiert. Der 18. April ist ein Feiertag in der Islamischen Republik zu Ehren der nationalen Streitkräfte.
https://de.euronews.com/
Siehe auch:
CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Schenderlein/Widmann-Mauz: Gedenken an den Widerstand vom 20. Juli 1944 wachhalten
19.07.2022 – 10:18
Berlin (ots)
Mutiger Einsatz bleibt für immer Vorbild
Das Attentat vom 20. Juli 1944, bei dem eine Gruppe von Widerstandskämpfern um Claus Schenk Graf von Stauffenberg versuchte, Adolf Hitler zu töten, jährt sich am Mittwoch. Dazu erklären die kulturpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christiane Schenderlein, und die Berichterstatterin Annette Widmann-Mauz:
Christiane Schenderlein: "Am 20. Juli gedenken wir all der Männer und Frauen, die im Widerstand gegen Hitler ihr Leben geopfert haben. Wir bewundern ihren Mut und ihre Kraft, sich von ihrem Gewissen leiten zu lassen. Ihr selbstloser Einsatz gegen die nationalsozialistische Diktatur bleibt uns für immer ein Vorbild, sich konsequent für Freiheit und Demokratie einzusetzen. Die wichtige Rolle der Frauen im NS-Widerstand muss dabei noch stärker in die Erinnerungsarbeit einfließen. Insbesondere die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, aber auch zahlreiche andere Gedenkstätten leisten wichtige Vermittlungs- und Erinnerungsarbeit, die weiterhin gestärkt werden muss."
Annette Widmann-Mauz: "Der 20. Juli erinnert uns für immer daran, dass wir uns jeder Form von Diktatur, Willkür und Unrecht widersetzen müssen. Er verpflichtet uns, für unsere Werte einzustehen. Wir dürfen uns nicht zurückziehen - auch nicht in scheinbar ausweglosen Situationen. Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist dabei bei weitem kein abgeschlossenes Kapitel. 78 Jahre nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler tobt wieder ein menschenverachtender Krieg mitten in Europa."
Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.
Pressekontakt:
CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de
https://www.presseportal.de/pm/7846/5276433
Siehe auch:
- NS-Vergangenheitsbewältigung >>>
- Öffentlichkeitsarbeit >>>
- NS-Konzentrationslager und NS-Gedenkstätten >>>
"Ich habe den Krieg verhindern wollen" – Georg Elser und das Attentat vom 8. November 1939
Vom 9. November bis 2. Dezember 2022 präsentierte das Grundbuchzentralarchiv Kornwestheim die Wanderausstellung der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand: "Ich habe den Krieg verhindern wollen" – Georg Elser und das Attentat vom 8. November 1939
Vor genau 83 Jahren, am 8. November 1939, verübt der Schreiner Johann Georg Elser aus Königsbronn einen Bombenanschlag auf Adolf Hitler und nahezu die gesamte NS-Führungsspitze. Mit seiner Tat will Elser "noch größeres Blutvergießen" durch die Ausweitung des Krieges im Westen verhindern. Doch das Attentat scheitert. Wenige Minuten vor der Explosion verlässt Hitler den Versammlungssaal. Noch am selben Tag wird Georg Elser festgenommen und nach über fünf Jahren strenger Einzelhaft in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau am 9. April 1945 im KZ Dachau ermordet.
Lange Zeit ist es auch nach 1945 schwierig gewesen, an Georg Elser und sein Attentat vom 8. November 1939 im Münchener Bürgerbräukeller zu erinnern. Im Nachkriegsdeutschland wurde der Handwerker zunächst nicht als Widerstandskämpfer wahrgenommen. Lügen und Legenden verstellten den Blick auf jenen Mann, der früher als andere erkannt hatte, dass Hitlers Politik auf ein Ziel, auf Krieg hinauslief. Um dies zu verhindern, entschloss sich Elser zur Tat.
Heute hat der Einzeltäter seinen Platz in der Geschichte des deutschen Widerstands gegen die NS-Diktatur gefunden. Georg Elser gilt heute als "der wahre Antagonist Hitlers" (Joseph P. Stern), der "einsame Attentäter" (Peter Steinbach) oder der "einsame Zeuge" (Klemens von Klemperer) und als einer der konsequentesten Gegner der NS-Diktatur.
Die durch die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und die Gedenkstätte Deutscher Widerstand konzipierte und mit Förderung durch die Baden-Württemberg Stiftung realisierte Wanderausstellung stellte einen wertvollen und wichtigen Beitrag zur Erinnerung an Georg Elser dar. Sie zeigte die politisch-moralische Motivation Elsers und seinen aktiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus.
Insgesamt 29 Ausstellungsfahnen mit Fotos, Dokumenten und Erläuterungen zeigten sein Leben, die Hintergründe des Bombenanschlags sowie die anschließenden Vernehmungen durch die Gestapo.
Eröffnungsveranstaltung am 8. November 2022 um 15.00 Uhr (Online–Übertragung)
Die Ausstellung wurde am 8. November 2022 um 15.00 Uhr im Beisein von Präsident Prof. Dr. Gerald Maier, Landrat Dietmar Allgaier und Oberbürgermeisterin Ursula Keck mit geladenen Gästen eröffnet.
Programm
1. Begrüßung durch den Präsidenten des Landesarchivs Baden-Württemberg Prof. Dr. Gerald Maier
2. Grußwort von Landrat Dietmar Allgaier
3. Grußwort von Oberbürgermeisterin Ursula Keck (Kornwestheim)
4. Georg Elser: "Ich habe den Krieg verhindern wollen" – Eröffnungsvortrag zur Ausstellung von Joachim Ziller, Leiter der Georg Elser Gedenkstätte in Königsbronn
Joachim Ziller, Leiter der Georg Elser Gedenkstätte, berichtet in seinem Vortrag über Kindheit und Jugend des Widerstandskämpfers. Ausführlich geht er auf die Motive Elsers ein, die Führung der Nationalsozialisten zu beseitigen. Akribisch setzte der Königsbronner Schreiner sein Vorhaben um, das letztlich doch missglückte.
Er berichtet von der schwierigen Aufarbeitung des Attentates und über den langen Weg voller Hindernisse zur Anerkennung. Dabei geht er aber auch darauf ein, was uns Elsers Tat heute bedeutet und was für Lehren wir aus dem Mut und Entschlossenheit des schwäbischen Handwerkers ziehen können.
Gerade in heutiger Zeit kann uns Elsers Zivilcourage sehr vieles lehren.
5. Musikalischer Ausklang: Frank Eisele – Akkordeon
Ausstellung
Anschrift und Auskunft
Grundbuchzentralarchiv Kornwestheim
Stammheimer Straße 10
70806 Kornwestheim
Telefon: +49 7154-17820-500
E-Mail: gbza@la-bw.de
https://www.landesarchiv-bw.de/
Siehe auch:
- Siehe auch:
- Nazi-Vergangenheitsbewältigung und Nazi-Kontinuität in Baden und Württemberg >>>
- Öffentlichkeitsarbeit >>>
- NS-Konzentrationslager und NS-Gedenkstätten >>>
"Das Erbe des deutschen Widerstandes ist das Erbe von Mut und Menschlichkeit"
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Rede des Ministers in der Gedenkstätte Berlin-Plötzensee anlässlich des Gedenkens der Bundesregierung und der Stiftung 20. Juli 1944 an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft am 20. Juli 2021
Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales:
Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident,
sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister,
sehr geehrter Herr Präsident des Abgeordnetenhauses,
sehr geehrter Herr Generalinspekteur!
Stellvertretend für die Angehörigen der Widerstandskämpfer begrüße ich von der "Stiftung 20. Juli 1944" Herrn Professor von Steinau-Steinrück und Herrn Doktor Smend!
Besonders begrüße ich all diejenigen, die diese Gedenkveranstaltung am 20. Juli 2021 live im Fernsehen und im Internet verfolgen!
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Es war eine Zäsur in der deutschen Nachkriegsgeschichte, als der Staatsanwalt Fritz Bauer 1952 öffentlich für die Ehre die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 eintrat. Acht Jahre nach dem gescheiteren Umsturz schaute die Öffentlichkeit mit Spannung auf das Landgericht in Braunschweig. Denn hier wurde keine einfache Strafsache verhandelt, sondern nichts weniger als ein hochsensibles Kapitel deutscher Geschichte.
Angeklagt war Otto Ernst Remer – ein Gefolgsmann Hitlers und nach dem Krieg Mitbegründer einer rechtextremistischen Partei – der ersten Partei, die in der Bundesrepublik später als verfassungswidrig verboten wurde. Die Anklage lautete: üble Nachrede und die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Diese Verstorbenen waren die Widerstandskämpfer des 20. Juli. Der Angeklagte, der als Wehrmachtsoffizier 1944 selbst zum Scheitern des Umsturzes beigetragen hatte, hatte sie später wiederholt als "Landesverräter" diffamiert.
In seinem leidenschaftlichen Plädoyer für ihre Rehabilitation ließ Fritz Bauer keinen Raum für Missverständnisse:
(Ich zitiere) "Am 20. Juli (1944) war das deutsche Volk total verraten. Verraten von seiner Regierung. (...) Ein Unrechtsstaat, der täglich zehntausende Morde begeht, berechtigt jedermann zur Notwehr." (Zitat Ende)
Es war eine Zäsur, denn Bauer ließ die Legitimität des Widerstandes durch ein Gericht feststellen und in diesem Zuge den NS-Staat als "Unrechtsstaat" definieren. Und es war auch ein bewusster Tabubruch, denn Fritz Bauer war klar: Die große Mehrheit der Deutschen hatte die Frauen und Männer des 20. Juli auch noch im Jahr 1952 nach wie vor eindeutig verortet – und zwar auf der vermeintlich falschen Seite der Geschichte. Der Widerwille gegen den Widerstand war enorm. Denn wenn, wie Bauer ausführte, "jedermann" das Recht zum Widerstand hatte – warum hatten dann nur so wenige darin auch ihre Pflicht erkannt?
Warum hatten nur sie ihre Angst überwunden und auf ihr Gewissen gehört? Für die deutsche Nachkriegsgesellschaft waren diese impliziten Fragen rasend unbequem. Und für den deutschen Widerstand folgte dem Kampf gegen den Nationalsozialismus ein zweiter, ungleich längerer Kampf: Die erbitterte Auseinandersetzung um die geschichtspolitische Deutungshoheit, um das kollektive Gedächtnis der deutschen Nachkriegsgesellschaft.
Auch heute, fast 70 Jahre nach dem Braunschweiger Prozess, ist diese Auseinandersetzung noch nicht vorbei. Immer wieder muss es uns erschüttern, wie schmerzvoll lange es dauerte, bis alle Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer die Anerkennung bekamen, die ihnen zusteht. Jahrzehntelang war das Gedenken an den Widerstand auch eine Frage des realpolitischen Kalküls und der ideologischen Opportunität – zumal im Kalten Krieg.
Das galt für beide deutsche Staaten – freilich mit sehr unterschiedlichen politischen Schwerpunkten. So stand man in der DDR den Widerstandskämpfern des 20. Juli offiziell mit teilweise zynischer Distanz gegenüber. Stattdessen schob der SED-Staat den kommunistischen Widerstand gegen Hitler in den Vordergrund. In der alten Bundesrepublik musste – vielleicht gerade deshalb – insbesondere der Widerstand der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung lange Ignoranz ertragen, ja sogar Diffamierungen – zumal wenn er aus dem Exil heraus geleistet wurde. Dabei war es gerade der gewerkschaftliche und der Arbeiterwiderstand, der besonders früh und besonders brutal verfolgt wurde. Parteiische Geschichtspolitik aus der Zeit des Kalten Krieges hat allzu lange den Blick auf die politische und gesellschaftliche Breite des Widerstands verstellt.
Heute gedenken wir ausdrücklich aller Menschen und Gruppierungen, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben, mit Trauer und mit Respekt.
Meine Damen und Herren,
ein ganz besonderer Respekt gebührt dabei zweifellos dem Mut und dem Schicksal der vielen Frauen im Widerstand. Die meisten von ihnen blieben jedoch nach dem Krieg lange unbeachtet. Oder sie wurden überstrahlt von einzelnen, besonders bekannten Persönlichkeiten des Widerstands – wie etwa Sophie Scholl. Auch diese Frauen verdienen die Aufmerksamkeit, den Respekt und die Anerkennung von uns allen! Denn sie waren an nahezu allen Formen des Widerstandes beteiligt. Sie entwarfen und verteilten oppositionelle Flugblätter. Sie bildeten Netzwerke, organisierten konspirative Treffen und versteckten Verfolgte. Sie arbeiteten mit an politischen Konzepten für ein Deutschland nach Hitler. Damit riskierten sie immer wieder die brutale Verfolgung durch das Regime. Manche von ihnen überlebten die Rachsucht des Diktators in den Gefängnissen und Konzentrationslagern.
Es waren diese Frauen, auch aus den Kreisen der Hinterbliebenen, die nach dem Krieg den Grundstein für die Erinnerung an den Widerstand legten. Viele bezahlten allerdings ihren Mut mit dem Leben; auch hier in Plötzensee.
Es waren Frauen wie Liane Berkowitz, eine junge Berlinerin, deren Eltern in den Zwanziger Jahren aus der damaligen Sowjetunion in die Weimarer Republik geflüchtet waren. Heute würden wir von einer Frau mit "Einwanderungsgeschichte" sprechen. Als Jugendliche wuchs Liane Berkowitz in einen regimekritischen Freundeskreis hinein. Hier wurde offen über die Verhältnisse im sogenannten "Dritten Reich“ diskutiert. Aus dem Entsetzen über die Verbrechen des Regimes entstand im Sommer 1942 der Impuls zum Handeln: In der Nacht vom 17. auf den 18. Mai 1942 verteilten Liane Berkowitz und ihre Mitstreiter in Berlin-Charlottenburg Klebezettel. Auf denen stand:
"Das Nazi-Paradies – Krieg – Hunger – Lüge – Gestapo – Wie lange noch?"
Es waren wenige Worte auf einigen Zetteln – und doch war es ein Akt des Widerstandes, der das NS-Regime radikal infrage zu stellen wagte.
Liane Berkowitz, ihr Verlobter und viele ihrer Freunde zahlten für diesen Mut einen furchtbaren Preis. Sie wurden als Teil der vermeintlich kommunistischen, so genannten "Roten Kapelle" festgenommen und im Januar 1943 zum Tode verurteilt. Liane Berkowitz war bei ihrer Verhaftung im dritten Monat schwanger. Sogar das Reichs-Kriegsgericht unterstützte ihr Gnadengesuch. Es wurde dennoch abgelehnt – von Adolf Hitler persönlich. Liane Berkowitz schrieb aus der Haft an ihre Mutter: "… wenn man bedenkt, wie jung wir sind, so kann man nicht an den Tod glauben." Und doch wurde sie am 5. August 1943 hier in Plötzensee umgebracht, zusammen mit zwölf weiteren Frauen der "Roten Kapelle".
Sie wurde 19 Jahre alt.
Der Mut und das Schicksal von Liane Berkowitz dürfen nicht vergessen werden.
Meine Damen und Herren,
auch heute, 77 Jahre nach dem 20. Juli 1944, stellen wir fest: Das Bild vom deutschen Widerstand ist nicht statisch. Es bleibt eine "umkämpfte Geschichte", eine gesellschaftliche Herausforderung und eine politische Aufgabe. Anders als zu den Zeiten Fritz Bauers geht es heute nicht darum, den Widerstand gegen Diffamierung und Stigma zu verteidigen. Sondern es geht darum, ihn vor Vereinnahmung und Instrumentalisierung zu schützen. Denn der Missbrauch des Widerstands gehört längst zum geschmack- und geschichtslosen Narrativ eines bestimmten politischen Milieus in Deutschland. Eines Milieus, das gleichzeitig die Nähe zu den geistigen Erben des Nationalsozialismus nicht scheut.
Zu dieser infamen Ironie gehört es, eine Widerstandskämpferin wie Sophie Scholl auf Demonstrationen politisch zu vereinnahmen und gleichzeitig mit notorischen Neo-Nazis zu marschieren.
Dazu gehört es, den vom Grundgesetz geschützten Widerspruch in unserer Demokratie mit dem lebensgefährlichen Widerstand in einer Diktatur gleichzusetzen.
Dazu gehört es, den Protest gegen Hygienemaßnahmen in der Corona-Pandemie mit dem Kampf gegen Krieg und Völkermord zu vergleichen.
Dazu gehört es, eine abstoßende Analogie herzustellen zwischen unserer freien Demokratie und einem mörderischen System, das für das größte Menschheitsverbrechen verantwortlich war.
Es ist diese De-Legitimierung unseres demokratischen Rechtsstaates, um die es diesen Leuten geht. Wir dürfen niemals hinnehmen, dass die Frauen und Männer des deutschen Widerstands als Kronzeugen für Geschichtsrevisionismus und Menschenfeindlichkeit instrumentalisiert werden!
Meine Damen und Herren,
es ist daher unsere Pflicht, diesem Missbrauch des Gedenkens mit Entschlossenheit entgegenzutreten.
Wir dürfen uns jedoch nicht darauf beschränken, das Gedenken lediglich defensiv zu verteidigen. Es geht vielmehr darum, dieses Gedenken immer wieder aktiv neu zu erschließen. Damit die Erinnerung an die Wenigen ein Gedenken für die Vielen bleibt. Deswegen ist das universelle Erbe dieser mutigen Menschen so wichtig. Die Frauen und Männer des Widerstandes sollten dabei keineswegs überhöht werden. Sie alle wurden nicht als Helden geboren, sondern waren Menschen in ihrer Zeit. Sie sahen die politischen, weltanschaulichen oder religiösen Motive ihrer Mitstreiter teilweise mit größter Skepsis, manchmal sogar mit offener Ablehnung. Aber sie haben damals eben nicht auf der Unvereinbarkeit ihrer Prinzipien bestanden – wie es leider heute allzu schnell und oft in unserer Gesellschaft geschieht. Stattdessen haben sie die Kraft gehabt, sich auf das Gemeinsame zu besinnen, und dabei Größe bewiesen.
Die Größe, nicht jeden Gegner zum Feind und nicht jede Differenz zum Gegensatz zu erklären.
Die Größe, mühsam Gemeinsamkeiten und Kompromisse zu erarbeiten, anstatt reflexhaft zu polarisieren.
Die Größe, die eigenen Selbst-Gewissheiten zugunsten eines höheren Ziels zurückzustellen.
Gerade diese Größe macht die Frauen und Männer des 20. Juli auch heute zu Vorbildern. Umso wichtiger ist es, dass wir uns heute daran erinnern, was sie verbunden hat – über alle sozialen Unterschiede, Altersgrenzen und politischen Überzeugungen hinweg.
Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus – das war die unbedingte Entschlossenheit, für Menschlichkeit und Recht einzutreten. Das war die individuelle Courage, dort zu handeln, wo schon Kritik, Widerspruch und Opposition ins Gefängnis, ins Konzentrationslager oder in den Tod führen konnten. Das war der Griff zur "Notwehr", die Fritz Bauer in seinem Plädoyer legitimierte.
Meine Damen und Herren,
Der 20. Juli 1944 liegt heute 77 Jahre zurück. Das ist die Spanne eines Menschenlebens. Je größer die zeitliche Distanz wird, desto größer wird die Verantwortung unserer Gesellschaft. Unsere Verantwortung dafür, diese Vergangenheit nicht zu vergessen. Weder die Verbrechen des Nationalsozialismus, noch den Widerstand dagegen. Wir dürfen nie vergessen, wozu Menschen fähig sind – in jeder Hinsicht.
Aber Erinnern bedeutet Arbeit. Fritz Bauer wusste das. Bauer, der streitbare Republikaner und leidenschaftliche Demokrat, der nach 1933 wegen seiner politischen Überzeugungen und seiner Herkunft seines Amtes, seiner Rechte und seiner Heimat beraubt wurde. Der von den Nazis schikaniert, verfolgt und ins Konzentrationslager gesperrt wurde. Der sich schließlich nach Skandinavien ins Exil retten konnte. Fritz Bauer war klar, dass es nicht reicht, das Gedenken an den Widerstand nur einmal zu verankern. Sondern dass es notwendig ist, dieses Gedenken immer wieder lebendig zu halten.
Das gilt auch für unsere Demokratie!
Es geht nicht darum, allein den Besitzstand zu bewahren.
Es geht nicht darum, sich lediglich in der Komfortzone unter Überzeugten zu engagieren!
Es geht vielmehr darum, auch die Gleichgültigen, die Distanzierten und die Skeptischen zu erreichen!
Die Aufgabe wird anspruchsvoller werden: Denn mit dem Abschied von den Zeitzeugen ändert sich auch das Gedächtnis und das Gedenken.
Schon für meine Generation lag bei Geburt der 20. Juli 1944 bereits viele Jahrzehnte zurück. Dennoch sind wir immer noch tief geprägt von den persönlichen Erinnerungen unserer Eltern und Großeltern: Der Krieg und seine Folgen, Fronterlebnisse und Bombennächte, der Treck nach Westen – all das sind für uns noch Überlieferungen aus erster Hand gewesen. Wir sind aufgewachsen mit den Zeitzeugen-Berichten über die Auschwitz-Prozesse, mit der Serie "Holocaust" im Fernsehen und den Auseinandersetzungen der "68er"-Generation mit den eigenen Eltern. Für unsere Generation hat diese Erinnerung noch einen konkreten persönlichen Bezug. Sie hat Gesichter und Stimmen, die uns vertraut und nahe waren.
Für meine Kinder, die heute im Grundschulalter sind, wird das nicht mehr so sein. Sie und ihre Generation werden andere, neue Wege finden müssen – zu unserer Vergangenheit und den Konsequenzen aus unserer Geschichte. Das ist ihre Herausforderung.
Dies gilt umso mehr für unsere Einwanderungs-Gesellschaft, in der viele Familien erst nach der NS-Zeit kamen. Auch sie gehören zu unserem Land mit seiner, mit unserer Geschichte. Und gleichzeitig haben gerade viele dieser Einwanderer-Familien selbst den Schrecken von Diktatur und Gewaltherrschaft erlebt. Viele von ihnen wissen, was Flucht vor Verfolgung bedeutet. Und sie wissen, wieviel es bedeutet, Widerstand zu leisten. Wir sollten diese Erfahrungen als Chance begreifen, um die Erinnerung an den Nationalsozialismus und den Widerstand des 20. Juli 1944 lebendig zu halten.
Meine Damen und Herren,
das Erbe des deutschen Widerstandes ist das Erbe von Mut und Menschlichkeit. Es gibt keinen Grund dafür, dieses Erbe antiquarisch zu behandeln. Stattdessen sollten wir es offen halten für neue Zugänge. Mut und Menschlichkeit, das waren die Ideale von Menschen wie Liane Berkowitz und den Frauen und Männern des Widerstandes. Das macht sie zu Vorbildern, auch für kommende Generationen.
Fritz Bauer hat es wie folgt ausgedrückt und es hat nichts an Aktualität verloren: Wir können aus der Erde keinen Himmel machen. Aber jeder von uns kann etwas dafür tun, dass sie nicht zur Hölle wird.
Ich bin überzeugt, das, meine Damen und Herren, ist und bleibt unser Auftrag.
https://www.bmas.de/
Weitere Informationen
Die Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“
01.07.2021
Vom damaligen Reichsluftfahrtministerium wurde die NS-Luftwaffe in den 2. Weltkrieg geschickt – aber zugleich auch das Dritte Reich bekämpft. Es war der Arbeitsplatz von Harro Schulze-Boysen, einem der Köpfe der von den Nazis jahrelang verfolgten Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“. Während der Dreißigerjahre sammelten sich Regimekritiker in seinem Umfeld. Nachdem es den Nazis im Juli 1942 gelang, die Oppositionellen zu enttarnen, wurden über 50 Todesurteile gegen Mitglieder der Schulze-Boysen/Harnack-Gruppe verhängt – und vollstreckt.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
https://www.bundesfinanzministerium.de/
Textfassung des Videos
Im April 1933 dringt die SS in die Redaktion der oppositionellen Zeitschrift „Der Gegner“ in Berlin ein. Gewaltsame Razzien sind seit Hitlers Machtübernahme an der Tagesordnung. Herausgeber Harro Schulze-Boysen und Redaktionsmitglied Henry Erlanger werden von der SS abgeführt und gefoltert. Durch Intervention einer Mutter beim Berliner Polizeipräsidenten kann Schulze-Boysen entkommen. Dabei stand er schon vor dieser Begegnung in strikter Gegnerschaft zum neuen Regime.
Er beschließt, die NS-Gewaltherrschaft von innen zu bekämpfen, aus einer der Machtzentralen des Dritten Reiches – dem Reichsluftfahrtministerium. 1934 wird er Mitarbeiter in der Nachrichtenabteilung. Eine Position, die er nutzt, um sich ein Bild über die Kriegsabsichten der NS-Führung zu machen. Er organisiert Gesprächsrunden mit anderen Regimekritikern und trifft 1938 unter anderem auf die Widerstandskämpfer Arvid Harnack, Regierungsrat im Wirtschaftsministerium, sowie Hilde und Hans Coppi. Die Widerstandskämpfer warnen die Sowjetunion 1941 vor dem bevorstehenden deutschen Angriff.
Auch danach leiten sie militärisch relevante Informationen an Moskau weiter. Bald wird die Gestapo, die bereits seit geraumer Zeit gegen einen sowjetischen Spionagering unter dem Namen „Rote Kapelle“ ermittelt, auf die Gruppe aufmerksam. Als vermeintliche Mitglieder dieser Organisation werden die Widerstandskämpfer im September 1942 verhaftet. Nach Verhören unter Folter ergehen mehr als 50 Todesurteile gegen die Widerstandskämpfer. Seinem Vater vertraut Schulze-Boysen in einem Brief vor seiner Hinrichtung an, er habe im vollen Bewusstsein der Gefahr gehandelt und sei nunmehr auch entschlossen, die Folgen auf sich zu nehmen.
https://www.bundesfinanzministerium.de/
Gedenken an Widerstandskämpfer
Aufruf zur Wachsamkeit
Stand: 20.07.2021 19:12 Uhr
77 Jahre nach dem Attentat auf Adolf Hitler ist in Berlin der Frauen und Männer im Widerstand gegen den Nationalsozialismus gedacht worden. Arbeitsminister Heil warnte vor NS-Vergleichen durch Kritiker der Corona-Maßnahmen.
Mit Aufrufen zur Wachsamkeit und zur Verteidigung der Demokratie haben Vertreter von Bund und Ländern in Berlin an die Hitler-Attentäter vom 20. Juli 1944 erinnert. Das zentrale Gedenken der obersten Verfassungsorgane fand gemeinsam mit der Stiftung 20. Juli 1944 in der Gedenkstätte Plötzensee statt. Unter den Teilnehmern waren Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Sachsen-Anhalts Ministerpräsident und Bundesratsvorsitzender Reiner Haseloff (CDU) sowie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD).Müller sagte, das vor 77 Jahren gescheiterte Attentat sei zu Recht einer der wichtigsten Tage in der deutschen Geschichte. Mutige Frauen und Männer hätten ein Zeichen gegen Unmenschlichkeit gesetzt und für Werte gekämpft, die auch heute verteidigt werden müssten. Die Geschichte habe eindringlich gezeigt, wohin es führt, wenn rechtspopulistischen Brandstiftern das Feld überlassen werde.
Player: videoGedenken an NS-Widerstandskämpfer am Jahrestag des Hitler-Attentats
Sendungsbild | ARD-aktuell2 Min Gedenken an NS-Widerstandskämpfer am Jahrestag des Hitler-Attentats Stephan Stuchlik, ARD Berlin, tagesschau 20:00 Uhr >>>
Missbrauch durch Kritiker der Corona-MaßnahmenBundesarbeitsminister Heil warnte vor falscher Vereinnahmung des deutschen Widerstands "durch ein bestimmtes politisches Milieu", wie den Kritikern der Corona-Maßnahmen. "Der Missbrauch des Widerstands gehört längst zum geschmack- und geschichtslosen Narrativ eines bestimmten politischen Milieus in Deutschland", sagte Heil. Der "Widerstand" werde in einem Milieu missbraucht, "das gleichzeitig die Nähe zu den geistigen Erben des Nationalsozialismus nicht scheut". Der Minister bezeichnete es mit Blick auf die Demonstrierenden als "infame Ironie", die Widerstandskämpferin Sophie Scholl "politisch zu vereinnahmen und gleichzeitig gemeinsam mit notorischen Neonazis zu marschieren". Bei einer Corona-Demonstration in Hannover im November hatte sich eine Rednerin mit Sophie Scholl verglichen und breite Kritik hervorgerufen.
"Unsere Pflicht, diesem Missbrauch entgegenzutreten""
Es ist deshalb unsere Pflicht, diesem Missbrauch des Gedenkens mit Entschlossenheit entgegenzutreten", sagte der SPD-Politiker. "Heute gedenken wir ausdrücklich allen Menschen und Gruppierungen, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben, mit Trauer und mit Respekt." Heil kritisierte zudem Vergleiche zwischen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen und dem "Kampf gegen Krieg und Völkermord".Der Minister rief zum Gedenken an alle Gruppen und Formen des Widerstands gegen die Nationalsozialisten auf. Die Erinnerung dürfe nicht von einer "parteiischen Geschichtspolitik" beeinflusst werden. Als Beispiel nannte Heil den Widerstand aus der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung, der in der DDR und der Bundesrepublik lange gegensätzlich bewertet worden sei. Dies habe "den Blick auf die gesellschaftliche Breite des Widerstands verstellt". Auch die gegen die Nationalsozialisten engagierten Frauen verdienten mehr "Anerkennung und Aufmerksamkeit", mahnte der Minister. Sie hätten ebenfalls eine "brutale Verfolgung des Regimes riskiert". Viele von ihnen seien jedoch unbeachtet geblieben.
Josef Schuster und Annegret Kramp-Karrenbauer bei einem feierlichen Gelöbnis von Rekruten anlässlich des 77. Jahrestags des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler.
Josef Schuster und Annegret Kramp-Karrenbauer erinnerten vor Rekruten an die Grenzen des Gehorsams.
Gelöbnis von Rekruten
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer rief bei einem feierlichen Gelöbnis von mehr als 100 Rekruten in Berlin dazu auf, das Erbe des militärischen Widerstands zu bewahren. Der 20. Juli gehöre "zur DNA der Bundeswehr", sagte sie. Gehorsam in der Bundeswehr stehe immer unter dem Vorbehalt des Gewissens. Die Rekruten gelobten ihre Treue nicht einer Person, sondern dem demokratischen, freiheitlichen Gemeinwesen und seiner Rechtsordnung. Mit Blick auf den 20. Juli 1944 sprach sie von einem "verzweifelten und späten Versuch", Deutschland von der NS-Schreckensherrschaft zu befreien. Dieser Versuch stifte bis heute Sinn, auch wenn er gescheitert sei. "Die Befreiung vom Nationalsozialismus gelang den Deutschen nicht aus eigener Kraft. Andere haben uns befreit." Die Ministerin betonte bei der Veranstaltung im Bendlerblock, dass Antisemitismus in der Bundeswehr keinen Platz habe.
Schuster mahnt: Nicht wegschauen
Als Ehrengast sprach Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, zu den Rekruten. Er erinnerte an die Grenzen des soldatischen Gehorsams und ermunterte dazu, nicht wegzuschauen. Heute werde mit tiefem Respekt auf die Widerstandskämpfer geschaut. "Respekt bedeutet nicht, sie als Helden zu verehren oder auf einen Sockel zu stellen, denn dies hielte ich für falsch", sagte er.Auch Schuster kritisierte, dass sich Corona-Leugner und sogenannte Querdenker auch mit Zeichen des Widerstands gegen den NS-Staat zeigten. Die sei infam und abstoßend. "Sie treten das Erbe der Widerstandskämpfer mit Füßen", sagte er. "Diese Menschen müssen spüren, dass sie mit ihrer Meinung isoliert sind."Am 20. Juli 1944 war der Sprengstoffangriff einer Gruppe deutscher Offiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg auf Adolf Hitler gescheitert. In den folgenden Stunden und Tagen wurden er und weitere rund 200 Mitwisser und Angehörige hingerichtet. Viele andere wurden verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt.
Gedenken
Dieses Thema im Programm:
Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 20. Juli 2021 um 17:00 Uhr.
https://www.tagesschau.de/
Groß-Gerau: Streit um Grab eines Nazi-Widerstandskämpfers entbrannt
Erstellt: 20.08.2020, 12:08 Uhr
Von: Claudia Kabel
Der Kommunist Wilhelm Hammann rettete in Buchenwald jüdische Kinder und war erster Landrat des Kreises Groß-Gerau – heute sehen manche sein Andenken in Gefahr.
Auf dem Friedhof in Groß-Gerau muss das Grab von Wilhelm Hammann neu gestaltet werden.
Hammann wurde als „Gerechter unter den Völkern" ausgezeichnet. Er hat im KZ Buchenwald 159 Kinder vor den Nationalsozialisten gerettet.
Wegen der Neugestaltung des Grabes in Groß-Gerau gibt es Streit oder ein Missverständnis.
Weil er im Konzentrationslager Buchenwald 159 jüdische Kinder vor der Ermordung rettete, wurde der Lehrer und KPD-Politiker Wilhelm Hammann 1984 vom Land Israel posthum ausgezeichnet. „Er ist der einzige Mensch im Kreis Groß-Gerau der als ‚Gerechter unter den Völkern’ geehrt wurde und hier sieht man nur den Kommunisten in ihm“, sagt Walter Ulrich im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau. Er ist Vorsitzender des Fördervereins jüdische Geschichte und Kultur im Kreis Groß-Gerau und hat sich viele Jahre mit der Geschichte des Widerstandskämpfers und ersten Landrats des Kreises Groß-Gerau nach Kriegsende beschäftigt. Kürzlich sprach er auch bei einer Gedenkfeier zum 65. Todestags Hammanns an dessen Grabstätte.
Die nicht angemeldete Veranstaltung, zu der rund 30 Menschen kamen, wurde jetzt zum Politikum, denn um das Grab von Wilhelm Hammann ist ein Streit entbrannt. Ein Streit, bei dem nicht ganz klar ist, ob es sich um ein Missverständnis handelt oder um Herabwürdigung eines besonderen Menschen nur weil er der Kommunistischen Partei Deutschlands angehörte.
Das Grab von Wilhelm Hammann in Groß-Gerau soll neu gestaltet werden
Fakt ist: Hammanns Grab auf dem Groß-Gerauer Friedhof soll neu gestaltet werden, weil zwei große Thuja-Bäume gefällt werden müssen, wie die städtische Pressesprecherin Cornelia Benz der FR sagte. Da die Ruhezeit abgelaufen sei und die Nachfahren nicht bekannt seien, wolle die Stadt die Grabpflege übernehmen. In einem Antrag des Bürgermeisters, über den am 25. August in der Stadtverordnetenversammlung abgestimmt werden soll, heißt es, „bei der Übernahme der Grabpflege handelt es sich um einen geringfügigen Aufwand, da es sich ausschließlich um einen Grabstein handelt, eine Grabstelle selbst ist nicht vorhanden“. Diese Formulierung sorgte für Verwirrung, da die Befürchtung aufkeimte, die Stadt wolle den Grabstein umlagern, wie Michael Lutz von der Initiative Geschichtswerkstatt sagte.
Die in Frankfurt ansässige antifaschistische Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora Freundeskreis, deren Ziel es ist, das Vermächtnis ehemaliger KZ-Häftlinge zu bewahren, ist „empört“. Ihrem Unmut hat die Organisation in einem Brief an den Groß-Gerauer Bürgermeister Erhard Walther (CDU) Luft gemacht. „Wir sind reichlich verwundert, dass es der Stadt Groß-Gerau derart schwer zu fallen scheint, die (...) Grabstätte (...), zu erhalten. Ist es Ihnen ein Dorn im Auge, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen Kommunisten handelt?“, schreibt Vorsitzender Horst Gobrecht.
Linke fordern für Wilhelm Hammann ein Ehrengrab in Groß-Gerau
Gleichzeitig fordern die Linken, dass der Widerstandskämpfer ein Ehrengrab auf dem Friedhof erhalten soll. Dies lehnt die Stadt jedoch ab, weil es laut Satzung keine Ehrengräber gäbe. Wohl aber Gräber von namhaften Persönlichkeiten – etwa von Hammann – , die durch die Stadt gepflegt würden. Auch Hammanns Grab sei in einer Broschüre der Stadt seit 1996 unter „Denkmäler und Kunst im öffentlichen Raum“ geführt und solle erhalten bleiben. Wie es zur Irritation kommen konnte, kann sich Benz nicht erklären.
Schon 2005, im 50. Todesjahr Hammanns, kritisierte Gerd Schulmeyer, Vorsitzender der DKP im Kreis Groß-Gerau in der Mörfelden-Walldorfer Stadtzeitung „blickpunkt“: „Der Kreistag und die Kreisverwaltung tun sich seit jeher sehr schwer damit, die persönlichen und politischen Verdienste Wilhelm Hammanns zu respektieren, weil er als Kommunist ein unbequemer politischer Gegner war und offensichtlich über den Tod hinaus ist.“
Das DKP-Blatt widmete ihm eine Sonderausgabe, in der Herausgeber Rudi Hechler Hammanns Lebensgeschichte dokumentierte. Dort ist nachzulesen, wie der Widerstandskämpfer, als Mitglied einer antifaschistischen Gruppierung innerhalb des Lagers, in geheim abgehaltenem Unterricht sich um die Kinder kümmerte und als Blockältester 159 jüdische Kinder vor dem Todesmarsch rettete. Dazu habe er in der Schreibstube das Wort Jude neben ihren Namen durch Ungar ersetzen lassen, so Hechler.
Wilhelm Hammann rettete im KZ Buchenwald 159 Kinder vor den Nationalsozialisten
Mit Hammann in Buchenwald gefangen war der Journalist und spätere Mitbegründer der Frankfurter Rundschau, Emil Carlebach. Er erinnert sich: „Plötzlich kamen Kinder ins KZ Buchenwald. Von der Mutter losgerissen, geprügelt, halbverhungert, verängstigt und hilflos. Transportbestimmung: Auschwitz, Gaskammer, Krematorium. Sechs-, Acht-, Zehnjährige dabei. Keiner von ihnen durfte sterben, das war der feste Wille der Antifaschisten. Der Lehrer Wilhelm Hammann übernahm die Rettungsaktion.“
Nachdem er im Mai 1945 nach sieben Jahren KZ freikommt, wird er auf Vorschlag der Bürgermeister des Kreises Groß-Gerau als kommissarischer Landrat eingesetzt und am 17. Oktober von der hessischen Landesregierung zum Landrat auf Lebenszeit ernannt.
Er ist jedoch ein unbequemer Landrat, der gegen ehemalige Nazis in hohen Ämtern bei Opel und unlautere Lebensmittelbeschlagnahmung durch die US-Armee vorgeht. Im Dezember 1945 wird er wegen einer Auseinandersetzung mit dem örtlichen CIC-Offizier und angeblich prokommunistischer Amtsführung verhaftet. Zwar spricht ihn das Darmstädter Militärgericht frei, doch Hammanns Gegner wühlten weiter, wie Hechler schreibt. Eine bis heute noch nicht aufgeklärte Nachkriegsintrige führte am 22. März 1946 zu Hammanns erneuter Verhaftung durch die US-Besatzungsbehörden. Er wurde in das US-Internierungslager in Darmstadt eingeliefert. Der Vorwurf: Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die er in Buchenwald verübt haben sollte.
Wilhelm Hammann: Gemeinsam mit SS-Männern in Dachau interniert
Dazu schrieb Hammann im Mai 1946 an seine Genossen: „Da ich der Auffassung bin, dass es sich um eine Anschuldigung gegen mich handelt, für die auch nicht der Schatten eines Beweises erbracht werden kann, bitte ich euch, vor einem ordentlichen deutschen Gerichte durch einen geeigneten Rechtsanwalt ein Strafverfahren gegen den oder die Verleumder zu beantragen.“
Die VVN (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes) wies laut Hechler zwar sofort die Haltlosigkeit der Anschuldigungen nach. Dennoch wurde Hammann im ehemaligen KZ Dachau mit den früheren SS-Wachmannschaften des KZ Buchenwald bis zum Beginn des „Buchenwaldprozesses“ zusammengesperrt.
25. Februar 1897: Wilhelm Hammann wird am 25. Februar 1897 in Biebesheim als Sohn einer Hebamme geboren.
1913-1916: Lehrerseminar in Alzey.
1916-1918: Kriegsdienst in Belgien und Russland.
1918: Teilnahme Novemberrevolution.
Staatsexamen im Juli 1920.
1922-1931: Lehrer in Wixhausen.
Ab 1925: Verschiedene Ämter als KPD-Politiker, unter anderem Abgeordneter im Hessischen Landtag.
1930 bis 1933: Verschiedene Gefängnisaufenthalte unter anderem wegen „Rädelsführerschaft“.
1933 bis 1938: Mehrere Inhaftierung durch die Nazis.
1938 bis 1945: Hammann ist im KZ Buchenwald inhaftiert und rettet 159 jüdische Kinder.
17. Oktober 1945: Hammanns Einsetzung als Landrat auf Lebenszeit.
Ende Oktober 1945: Suspendierung auf Verlangen der Militärregierung.
Dezember 1945 bis Februar 1946: Inhaftierung wegen angeblich unbegründeter Vorwürfe gegen den CIC-Offizier.
22. März 1946: Erneute Verhaftung durch die Besatzungsbehörden und Inhaftierung im ehemaligen KZ Dachau (bis Mai 1947) wegen angeblicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit im KZ Buchenwald.
1947 bis 1955: KPD-Sekretär des Kreises Groß-Gerau und Abgeordneter im Kreistag sowie Vorsitzender der KPD-Fraktion.
25. Juli 1955: Zusammenstoß seines Autos mit einem US-Panzer. Hammann verstirbt in einem amerikanischen Militärkrankenwagen.
18. Juli 1984: Die israelische Stiftung Yad Vashem ehrt Wilhelm Hammann als „Gerechter unter den Völkern“ wegen der Rettung jüdischer Kinder im KZ Buchenwald. cka
„Diese Zeit war schlimmer für mich als die vielen Jahre in Buchenwald“, schrieb Hammann später. FR-Herausgeber Carlebach erinnert sich: „Wilhelm Hammann verschwand (...) ohne Verfahren und ohne dass wir wussten, wo er war.“ Erst über Umwege erfuhr man, dass Hammann in Dachau interniert war. Carlebach und andere ehemalige KZ-Häftlinge – der stellvertretende hessische Ministerpräsident Werner Hilpert (CDU) und Arbeitsminister Oskar Müller (KPD) – machten mobil und fuhren nach Dachau, um Hammann rauszuholen. Was nach einer Bürgschaft durch Hilpert auch gelang. Er wurde rehabilitiert, aber nicht mehr als Landrat eingesetzt.
Mysteriös war auch Hammanns Tod 1955. In einem Waldstück auf der Bundesstraße 26 zwischen Bischofsheim und Königstädten prallte sein Auto frontal mit einem stehenden US-Panzer zusammen. Obwohl Hammann äußerlich nur Nasenbluten gehabt haben soll, verstarb er kurz darauf in einem US-Militärkrankenwagen. Angeblich soll er eine Liste mit Namen kommunistischer Agenten dabei gehabt haben. „Dass es darüber keine Akten gibt, lässt Raum für Spekulationen“, sagt Walter Ulrich. Er selbst könne sich nicht vorstellen, dass man an dieser Stelle einen Panzer übersehen könne. Und Rudi Hechler fragte rein spekulativ: „War das wirklich ein Unfall?“
Leben und Tod
Von Claudia Kabel
https://www.fr.de/
"...ihr Gewissen war ihr Antrieb": Ausstellung und Symposium der Universität Kassel zum 60. Jahrestag des 20. Juli 1944
25.11.2004 10:59
Ingrid Hildebrand Stabsstelle Kommunikation und Marketing
Universität Kassel
Vorgeschichte und die Ereignisse dieses Tages stehen anlässlich des 60. Jahrestages des 20. Juli 1944 im Zentrum einer Ausstellung, die am 7. Dezember im Foyer des Kasseler Justizgebäudes, Frankfurter Straße 9 eröffnet wird. Ein Symposium im Gießhaus der Universität wendet sich am 9. Dezember mit diesem Thema nicht nur an die Fachwissenschaft, sondern auch an Schulklassen und die Bürger der Region.
Kassel. Das Attentat auf Hitler war der Kulminationspunkt des Widerstandes gegen das NS-Regime. Aus moralisch-politischer Verantwortung heraus entschlossen sich die am 20. Juli Beteiligten zum aktiven Handeln und opferten damit ihr Leben für das Ziel eines umfassenden Neubeginns. Vorgeschichte und die Ereignisse dieses Tages stehen anlässlich des 60. Jahrestages des 20. Juli 1944 im Zentrum einer Ausstellung, die am 7. Dezember im Foyer des Kasseler Justizgebäudes, Frankfurter Straße 9 eröffnet wird. Ein Symposium im Gießhaus der Universität wendet sich am 9. Dezember mit diesem Thema nicht nur an die Fachwissenschaft, sondern auch an Schulklassen und die Bürger der Region.
Die Ausstellung will dazu beitragen, jungen Menschen herausragende Persönlichkeiten des Widerstandes nahe zu bringen, die aus Hessen stammen oder in Hessen gegen das NS-Regime gekämpft haben. Einzelne Lebensbilder beschreiben, was schließlich Menschen dazu bewogen hat, sich der Diktatur entgegenzustellen und in vielen Fällen auch ihr Leben zu opfern. Sowohl in dem in Kassel tätig gewesenen Studienrat Hermann Kaiser als auch in Willi Goethe, der sich nach schwerer Misshandlung, Verfolgung und Haft im KZ Sachsenhausen als Stadtverordneter beim demokratischen Neuaufbau engagierte, sind Bezüge zur Stadt Kassel gegeben. Deutlich wird, dass der Widerstand auf einer persönlichen Gewissensentscheidung beruhte. Daher wurde der Titel in Anlehnung an einen Ausspruch des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker gewählt: "... ihr Gewissen war ihr Antrieb".
Die Integrität des Widerstandes
In der Bundesrepublik Deutschland fiel es lange Zeit schwer, die Integrität des Widerstandes gegen die NS-Diktatur rechtlich, politisch und moralisch anzuerkennen. Inzwischen sind zahlreiche Veröffentlichungen erschienen, die das Bild des Widerstands verdeutlichen sowie differenzieren, und auch solche, die den Widerstand zu relativieren oder in Frage zu stellen suchen. Im Symposium geht es an ausgewählten Fragestellungen um eine Zwischenbilanz der Forschungen und Diskussionen der letzten Jahre. Im Zentrum steht die Frage nach der Bedeutung des Widerstandes im Rahmen der historisch-politischen Bildung. Weisen jene moralischen Haltungen der Beteiligten des 20. Juli 1944, sofern als solche erkennbar, in die Zukunft? Sind sie im kollektiven Gedächtnis zu bewahren? Was bedeutet dies, sofern man es bejaht, für Bildung und schulischen Unterricht?
Nach der Begrüßung durch den Präsidenten der Universität, Herrn Prof. Dr. Postlep, und der Einführung in die Tagung durch Prof. Dr. Leonhard, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, finden folgende Vorträge statt, zu denen sich anerkannte wissenschaftliche Experten bereit erklärt haben.
Prof. Dr. Peter Steinbach (TH Karlsruhe und Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin) spricht über "Widerstand gegen den Nationalsozialismus - mehr als ein Gründungsmythos!", Prof. Dr. Wolfram Wette (Universität Freiburg und Verfasser von Monographien und zahlreichen Aufsätzen zum Widerstand) über "Stille Helden - Rettungswiderstand aus der Wehrmacht" und Prof. Dr. em. Arno Klönne (Verfasser u.a. zahlreicher Monographien zur Hitlerjugend und zum Jugendwiderstand) über "Oppositionelle Jugendkulturen im 'Dritten Reich' - Zur Traditionspflege nicht geeignet".
Abschließend findet eine Podiumsgespräch der Kasseler Professoren Dr. Jens Flemming und Dr. Eike Hennig mit den Referenten unter der Leitung von Prof. Dr. Krause-Vilmar statt.
Die Ausstellung "... Ihr Gewissen war ihr Antrieb." Der 20 Juli 1944 und Hessen wird am 7. Dezember 2004 wird um 16 Uhr in Kassel im Foyer des Justizgebäudes (Frankfurter Straße 9) durch ein Ansprache des ehemaligen Hessischen Kultusministers Hans Krollmann eröffnet. Sie ist vom 8. bis 22. Dezember 2004, jeweils montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Schulklassen brauchen sich nicht vorher anzumelden. Der Eintritt ist frei.
Das Symposium "Einspruch, Resistenz, Protest und Widerstand gegen die NS-Diktatur - Haltungen, die in die Gegenwart und Zukunft weisen" das vom Hessischen Minister für Wissenschaft und Kunst Udo Corts gefördert wird, findet im Gießhaus der Universität in der Mönchebergstraße 5 statt und beginnt um 10.15 Uhr (Ende gegen 17 Uhr).
jb
4.305 Zeichen
Info
Universität Kassel
Prof. Dr. Dietfrid Krause-Vilmar
tel (0561) 804 3625
fax (0561) 804 3611
e-mail kvilmar@uni-kassel.de
https://idw-online.de/
+++
2.3 Online Artikel zum NS-WIDERSTAND in Baden-Württemberg
Würdigung des Widerstands gegen den Nationalsozialismus
FESTAKT
19.07.2019
Bei einem Festakt zum 75. Jahrestag in Erinnerung an den 20. Juli 1944 nannte Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Widerstand gegen den Nationalsozialismus eine Verpflichtung, die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit für unsere eigene Zukunft zu ziehen.
„Wenn wir den 20. Juli 1944 nur an seinem missglückten Ausgang messen würden, dann müssten wir sagen: Ja, es war umsonst. Der Krieg ging weiter und forderte Opfer über Opfer. Doch dann hätten wir nicht begriffen, worum es Stauffenberg und seinen Vertrauten ging. Der 20. Juli 1944 war nicht nur eine politische Tat. Es war vor allem auch eine moralische Tat“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann anlässlich des Festaktes zum 75. Jahrestag in Erinnerung an den 20. Juli 1944 im Neuen Schloss in Stuttgart.
In seiner Rede nannte der Ministerpräsident den Widerstand gegen den Nationalsozialismus eine Verpflichtung, die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit für unsere eigene Zukunft zu ziehen. „Hitler und der Nationalsozialismus haben uns zwölf Jahre der Unterdrückung und Willkür gebracht. Die Frauen und Männer um Claus von Stauffenberg haben dagegen aufbegehrt und mit ihrem Leben bezahlt. Mit unseren demokratischen Prinzipien und ihren obersten Grundwerten, die uns seit 70 Jahren Frieden, Freiheit und Recht geschenkt haben, stehen wir heute auch auf den Schultern derjenigen Menschen, die damals den Mut hatten, Widerstand zu leisten.“ Diese Demokratie sei es wert, gegen jede Form des politischen Extremismus beschützt und verteidigt zu werden.
Präsentation eines deutsch-polnisches Filmprojekts
Ministerpräsident Winfried Kretschmann bedankte sich auch bei den Schülerinnen und Schülern des Stuttgarter Ferdinand-Porsche-Porsche-Gymnasiums für die Präsentation eines deutsch-polnisches Filmprojekts im Rahmen des Festaktes. „Gemeinsam mit polnischen Schülerinnen und Schülern habt Ihr Euch am Ort des Geschehens dem Attentat, der Person Stauffenberg und dem deutschen Widerstand genähert. Und Euch intensiv damit auseinandergesetzt. Aus einer europäischen Perspektive. Ich bin begeistert von Eurem Engagement!“, betonte der Ministerpräsident.
Prof. Dr. Paula Lutum-Lenger, Direktorin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, hob bei der Veranstaltung ebenfalls die Bedeutung des Attentats für unsere heutige Zeit hervor. „Dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg ist es ein Anliegen, dass der Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 dauerhaft im Gedächtnis bleibt. Die Ausstellung ,Attentat. Stauffenberg‘ erinnert nicht nur an die Tat, sondern sie fragt auch, was sie heute bedeutet. Der Film über das heute präsentierte deutsch-polnisches Schülerprojekt am historischen Ort des Anschlags, der ,Wolfsschanze‘, wird ab jetzt auch in der Ausstellung zu sehen sein: eine eindrucksvolle Dokumentation über unterschiedliche Perspektiven und die Verantwortung, sich mit der Geschichte zu beschäftigen, um eine gemeinsame Zukunft zu haben.“
General a.D. Wolfgang Schneiderhan unterstrich als Vorsitzender der Stauffenberg Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. und Initiator des Festaktes in seiner Rede den Mut und die bis zum heutigen Tag wirksame Aktualität des Widerstandaktes. „Claus Graf von Stauffenberg hatte den Mut aufgebracht, der Naziherrschaft ein Ende setzen zu wollen. Er wollte das Steuer herumreißen, den Krieg beenden und mit ihm auch die ungeheuren Grausamkeiten gegen die Zivilbevölkerung und in den Konzentrationslagern. Millionen von Menschen wären Tod und Leid erspart geblieben, wenn der 20. Juli erfolgreich gewesen wäre. Und auch nach 75 Jahren ist der Widerstandsakt noch aktuell. Er ist Teil des demokratischen Fundaments, auf dem unsere Gesellschaft steht, er ist Mahnung, den Anfängen von Extremismus und Diktatur zu wehren, und er ist eine Aufforderung zum Mut.“
https://www.baden-wuerttemberg.de/
Festrede von Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Festakt zum 75. Jahrestag des 20. Juli 1944
https://www.baden-wuerttemberg.de/
Landesgeschichtliche Einordnung
Attentat, Umsturz und eine neue Ordnung - Stauffenberg und der 20. Juli
“Wir wollen eine Neue Ordnung, die alle Deutschen zu Trägern des Staates macht …"
Stauffenberg im Juli 1944
“Das Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 unter der Führung von Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg ist ein zentrales Ereignis des deutschen Widerstands und ein zentraler Bezugspunkt der demokratischen Grundrechtsordnung der Bundesrepublik seit 1949, auch wenn er nicht mit dem breiten Spektrum des deutschen Widerstands gleichgesetzt werden kann.“
(Rolf-Ulrich Kunze, Entwicklungen der Widerstandsforschung seit 1994, in: Mitverschwörer – Mitgestalter: Der 20. Juli im deutschen Südwesten, Konstanz 2004, S. 7)
Die eigentlichen Akteure des 20. Juli 1944 waren Offiziere, aber im Hintergrund standen Politiker, Gewerkschafter und Verwaltungsbeamte aus allen Gruppierungen. Der 1938 zurückgetretene Generaloberst Ludwig Beck sollte nach einem erfolgreichen Attentat auf Hitler Staatsoberhaupt werden. Er hielt engen Kontakt zu Carl Friedrich Goerdeler, dem Kopf des zivilen Widerstands. Attentat und Umsturz waren von einer Gruppe ziviler und militärischer Oppositioneller von langer Hand vorbereitet worden.
Stauffenberg und der 20. Juli
“Es ist Zeit, daß jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muß sich bewußt sein, daß er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterläßt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem eigenen Gewissen. [...] Ich könnte den Frauen und Kindern der Gefallenen nicht in die Augen sehen, wenn ich nicht alles täte, dieses sinnlose Menschenopfer zu verhinden.“
Stauffenberg kurz vor dem 20. Juli 1944:
( de.wikipedia.org/wiki/Claus_Schenk_Graf_von_Stauffenberg)
Treibende Kraft des Staatsstreichs war Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Die Gruppe um Stauffenberg, zu der auch sein Bruder Berthold gehörte, plante den Umsturz mit dem Ziel, Hitler auszuschalten, der NS-Herrschaft ein Ende zu setzen, den Krieg zu beenden und die Regierungsverantwortung zu übernehmen. Über das zukünftige Staatsmodell herrschten zwar unterschiedliche Auffassungen, aber die Grundsätze einer staatlichen Neuordnung und die Pläne für ein Schattenkabinett der potentiellen Regierung Beck/Goerdeler lagen vor.
Nach dem missglückten Staatsstreich wurden Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Werner von Haeften, Albrecht Ritter Merz von Quirnheim, Friedrich Olbricht und Ludwig Beck noch in der Nacht im Hof des Bendlerblocks erschossen.
“Dass dem Regime diese Dimension der Breite und Tiefe des Widerstands bewusst war, fand eine zynische Anerkennung in der mörderischen Verfolgungsweise nach dem 20. Juli mit etwa 1000 Verhaftungen und über 200 Hinrichtungen sowie mit der “Sippenhaft“ für die Familien des engsten Kreises der Hauptbeteiligten.“ (Rolf-Ulrich Kunze, s.o.,S.9)
Unter Sippenhaft genommen wurde beispielsweise Claus von Stauffenbergs schwangere Frau Nina, die nach dem Attentatsversuch von der Gestapo verhaftet, von ihren Kindern getrennt, in verschiedene Gefängnisse und ins KZ Ravensbrück – dort starb ihre ebenfalls in Sippenhaft genommene Mutter – deportiert wurde. Ihr fünftes Kind brachte sie am 17. Januar 1945 in einem Frauenentbindungsheim in Frankfurt/Oder zur Welt. Ihre vier anderen Kinder wurden bis zum Kriegsende in ein Kinderheim bei Bad Sachsa verbracht.
Bei Bertholds Zwillingsbruder, Alexander Graf von Stauffenberg, konnte die Gestapo konnte kein Wissen am Putsch nachweisen. Trotzdem blieb er bis zum Kriegsende in der Hand der Gestapo und wurde von Konzentrationslager zu Konzentrationslager verlegt.
Berthold Graf von Stauffenberg war am Tag des Attentats im Bendlerblock und organisierte die Verbindung zum Oberkommando der Marine. Er wurde dort in der Nacht auf den 21. Juli 1944 verhaftet, am 10. August 1944 zum Tode verurteilt und noch am selben Tag in Berlin-Plötzensee ermordet.
Kontakt
Institut für Bildungsanalysen
Baden-Württemberg (IBBW)
─ Landesbildungsserver ─
Heilbronner Straße 172
D-70191 Stuttgart
Telefax+49 711 6642-1099
E-Mailinfo@mail.schule-bw.de
https://www.schule-bw.de/
Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Mannheim
Autoren: Michaela Manall; Christoph Bartz-Hisgen
- Arbeitskreis Landeskunde/Landesgeschichte RP Karlsruhe -
Kurzbeschreibung der Einheit/des Moduls:
Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Mannheim auf vielfältige Weise stattgefunden hat. Sie lernen exemplarische mutige Menschen aus Mannheim – u.a. Marianne Cohn, Jakob Reiter, August Locherer –kennen. Das Modul ist nach drei Niveaustufen differenziert und direkt im Unterricht einsetzbar. Darüber hinaus beinhaltet es Materialien zur Erstellung und Durchführung einer interaktiven Lernorterkundung mit der Actionbound-App.
https://www.schule-bw.de/
Eugen Bolz (1881-1945) – württembergischer Staatspräsident und Widerstandskämpfer
Autoren: Dr. Michael Hoffmann
- Kompetenzzentrum für geschichtliche Landeskunde im Unterricht am Kultusministerium -
Andreas Schaaf
Peutinger Gymnasium Ellwangen
Kurzbeschreibung der Einheit/des Moduls:
Das Modul beschäftigt sich mit dem politischen Wirken des württembergischen Staatspräsidenten Eugen Bolz zur Weimarer Zeit sowie mit seiner Rolle im Widerstand gegen die NS-Herrschaft bis zu seiner Hinrichtung 1945. Der Vernunftrepublikaner Eugen Bolz ging als Innenminister und Staatspräsident Württembergs konsequent gegen alle extremistischen Gruppen vor und verteidigte die republikanische Verfassung hartnäckig. Nach seiner Verhaftung und Entfernung aus dem Amt entwickelte er eine politisch und religiös motivierte Resistenz gegenüber dem Nationalsozialismus, die ihn in das Umfeld der Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 brachte. An diesem Modul können die Schülerinnen und Schüler Haltung und Handeln eines demokratischen Politikers zwischen Weimar und Nationalsozialismus erarbeiten und bewerten.
Das Modul ist nach Niveaustufen differenziert und richtet sich an die Sekundarstufe 1.
https://www.schule-bw.de/
Die „Geislinger Weiberschlacht“ vom Dezember 1941. Frauen leisten Widerstand gegen die NS-Kindergartenpolitik
Autor: Dr. Ines Mayer
- Arbeitskreis Landeskunde/Landesgeschichte RP Tübingen -
Kurzbeschreibung der Einheit/des Moduls:
Seit einiger Zeit wird beim Thema Widerstand gegen den NS der Blick auch auf die „Stillen Helden“ gerichtet, die im Gegensatz zu den bekannten Protagonisten in der Öffentlichkeit bisher kaum wahrgenommen wurden. Auch gibt es wenige Beispiele weiblichen Widerstandshandelns und wenn, dann überwiegend als geheime Aktionen wie das Verstecken von Juden oder die Fluchthilfe. Um so beachtlicher ist der massenhafte Widerstand von rund 200 Frauen in der württembergischen Kleinstadt Geislingen bei Balingen, die sich im Dezember 1941 vehement der Schließung ihrer katholischen Kinderschule zugunsten eines NSV-Kindergartens (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) widersetzten. Das mutige Aufbegehren der Frauen gegen die NS-Behörden ging als „Geislinger Weiberschlacht“ in die Lokalgeschichte ein. Der Widerstand zeigte sich dabei nicht nur in den unmittelbaren Protesten, sondern wurde als Boykott des NSV-Kindergartens bis zum Ende der NS-Herrschaft durchgehalten. Das Modul umfasst die Sozialgeschichte des Ortes, die unmittelbare Vorgeschichte der Ereignisse am 1. und 2. Dezember 1941 sowie deren Ablauf und das Nachspiel. Eine besonders interessante Quelle stellt der Brief einer der teilnehmenden Frauen an den württembergischen Innenminister im Januar 1942 dar. Insgesamt ermöglichen Materialien mit unterschiedlichen Anforderungsniveaus eine Binnendifferenzierung.
https://www.schule-bw.de/
Showdown an der Panzersperre im April 1945 – Die mutigen Frauen von Geislingen-Altenstadt
Autor: Roman Blessing
- Arbeitskreis Landeskunde/Landesgeschichte an der ZSL-Regionalstelle Schwäbisch Gmünd -
Kurzbeschreibung der Einheit/des Moduls:
Fast 60 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland findet der Geislinger Stadtarchivar Hartmut Gruber im Archiv 78 Urkunden, die vom einstigen Bürgermeister nie den Adressantinnen übergeben worden sind. Damit sollten eigentlich die mutigen Frauen von Geislingen-Altenstadt geehrt werden, die sich in den letzten Kriegstagen immer wieder aktiv und unter Einsatz ihres Lebens für die Beseitigung einer Panzersperre engagiert hatten, sodass dadurch die Stadt beim Einmarsch der amerikanischen Truppen vor großen Opfern und Schäden bewahrt wurde. Die Unterrichtssequenz nimmt die Schülerinnen und Schüler mit hinein in den „Showdown“ an der Panzersperre im April 1945, und lässt sie auch die Aufarbeitung und späte Ehrung der mutigen Frauen von Altenstadt handlungsorientiert nachvollziehen.<
https://www.schule-bw.de/
2.4 Online-Artikel zu Angriffen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen antifaschistisch orientierte NGOs und Aktivisten
Überfall mit Hammer und Schlagstöcken: Razzia bei Neonazi nach Angriff auf linke Szenekneipe in Berlin
Im Mai sollen Neonazis des „Dritten Wegs“ versucht haben, eine alternative Kneipe in der Rigaer Straße zu stürmen. Jetzt hat das Landeskriminalamt die Wohnung eines Tatverdächtigen in Pankow durchsucht.
Von Madlen Haarbach
Stand: 29.01.2026, 20:53 Uhr
Am frühen Donnerstagmorgen hat der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes eine Wohnung in Pankow durchsucht. Nach Tagesspiegel-Informationen soll es sich um die Wohnung handeln, in der der 21-jährige Neonazi Erik S. gemeinsam mit seinen ebenfalls rechtsextremen Eltern lebt. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.
Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem Tagesspiegel bestätigte, wird wegen einer Sachbeschädigung ermittelt: Am Himmelfahrtstag hatten mehrere Vermummte versucht, die linke Szenekneipe „Fischladen“ in der Rigaer Straße in Friedrichshain mit Hämmern und Schlagstöcken zu stürmen. Bei der Durchsuchung der Wohnung seien Beweismittel sichergestellt worden, sagte der Sprecher.
Ein mutmaßlicher Täter wurde fotografiert
Anwesende konnten damals offenbar verhindern, dass die Gruppe in die Kneipe eindrang. Wenig später sollen die Angreifer auf Fahrrädern geflüchtet sein. An der Kneipe soll ein Sachschaden entstanden sein, auch Transparente seien gestohlen worden, hieß es. Verletzt wurde niemand.
Einer der mutmaßlichen Täter wurde offenbar direkt nach dem Angriff fotografiert. Das Bild wurde auf der Rechercheseite „ausdemweg.net“ veröffentlicht. Es zeigt einen jungen Mann von hinten auf einem Fahrrad, in der rechten Hand hält er einen Hammer. Bei dem Fotografierten soll es sich um Erik S. handeln.
Am Abend desselben Tages tauchte auch im Telegram-Kanal der Neonazi-Partei „Der Dritte Weg – Stützpunkt Berlin/Brandenburg“ ein Beitrag auf: Auf einem Foto sind mehrere sehr junge Männer auf Fahrrädern zu erkennen, die ihre Gesichter mit Flyern der Partei bedecken. „In der Gemeinschaft waren unsere Nationalrevolutionäre am heutigen Tage wieder sportlich mit dem Fahrrad auf Tour in der Berliner Großstadt“, ist darunter zu lesen. Das Foto entstand in der Nähe des Platzes der Vereinten Nationen in Friedrichshain. Von dort sind es ungefähr zehn Minuten mit dem Fahrrad bis zur Rigaer Straße.
Mehr über Neonazis in Berlin:
Mit Nazis spricht man nicht – oder doch? Dieser Youtuber zeigt, was es bringen kann
„Ich denke, dass das ein Wendepunkt für Sie ist“ Linksradikale nach Angriff auf Berliner Neonazi zu Bewährungsstrafe verurteilt
Noch extremer, noch martialischer, noch rassistischer So tickt die neue Neonazi-Vereinigung „Jägertruppe“
Der junge Neonazi Erik S. leitet die Jugendorganisation der Partei, die „Nationalrevolutionäre Jugend“ (NRJ), in Berlin und Brandenburg. Er gilt als äußerst gewaltbereit. Auf dem später bei Telegram geposteten Gruppenfoto ist er ebenfalls zu erkennen. S. tritt regelmäßig bei Demonstrationen der Partei, etwa im März 2025 in Hellersdorf, auf. Er war nach Tagesspiegel-Informationen unter anderem im November 2024 in eine Schlägerei im Potsdamer Stadtteil Babelsberg verwickelt.
https://www.tagesspiegel.de/
Donnersbergkreis
Angst und Attacken in Gauersheim: AfD sprengt Bürgerdialog
RHEINPFALZ Plus Artikel
Die Nordpfälzer Idylle wird zum Schauplatz von Wortgefechten, Vorwürfen, Beleidigungen: In Gauersheim sind am 3. Oktober die Gruppen von zwei Bürgerdialogen aneinandergeraten.
Foto: Tommy Rhein
Anja Kunz
07.10.2025 - 15:07 Uhr | Lesezeit: 4 Minuten
Zwei Bürgerdialoge, viele Provokationen und eine kurze Eskalation: In Gauersheim haben sich AfD-Anhänger und politische Gegner angefeindet. Die Polizei musste einschreiten.
Die Rede ist von Drohungen, Beleidigungen, Handgreiflichkeiten und von Einschüchterung. Am Nachmittag des 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, besuchte eine Gruppe von mehr als 40 AfD-Funktionären und -Anhängern einen privat initiierten Bürgerdialog auf dem Dorfplatz in Gauersheim. Dort gerieten die beiden Seiten aneinander; es soll verbale Attacken und teils körperliche Angriffe gegeben haben.
Das ehemalige Gästehaus in Gauersheim: der neue »Treffpunkt Nordpfalz« der AfD für regelmäßige Veranstaltungen.
Foto: Tommy Rhein
Seit dem Vorfall kursieren Vorwürfe, Verleumdungen und verschwommenes Videomaterial in den sozialen Netzwerken – und zwar von beiden Seiten, mit unterschiedlichen Anschuldigungen und Auslegungen. Wer hat wen provoziert? Wer ist handgreiflich geworden? Wer hat wen am Redebeitrag gehindert? Es gibt viel Interpretationsspielraum, Fakt ist allerdings: Mit dem Eintreffen der AfD auf dem Dorfplatz eskalierte die Situation in der Nordpfälzer Gemeinde und konnte erst durch die Polizei beruhigt werden.
Herausforderung: AfD-„Treffpunkt Nordpfalz“
Schaut man sich die Videos an, die auf den Kanälen der AfD verbreitet werden, wird ein mindestens verzerrtes Bild gezeichnet: Catalina Monzon, im Februar 2025 noch Landratskandidatin für die AfD im Kreis Kusel, läuft in Deutschlandfahne gehüllt über den Dorfplatz, filmt sich selbst, lächelt in die Kamera und spricht von einer „Antifa-Demo“, die dort gerade stattfindet. Tatsächlich hatten sich aber, nach Angaben der Veranstalter, nur rund 20 normale Bürgerinnen und Bürger auf dem Dorfplatz getroffen. Eingeladen hatte ein Gauersheimer, Tilo Hausmann, als Privatperson. Keine Partei saß offiziell mit im Boot, auch keine Antifa-Anhänger. Stattdessen viele ältere Menschen und Bürger, die in Gauersheim engagiert sind, denen ihr eigentlich so idyllischer Ort am Herzen liegt.
„Einwohnerinnen und Einwohner waren eingeladen und sollten die Möglichkeit haben, über lokale Probleme zu sprechen“, erklärt Ortsbürgermeister Reiner Schlesser den Hintergrund der Veranstaltung. Es sollte um Herausforderungen im Ort gehen und um Lösungen, wie man künftig damit umgehen könnte. Als eine solche Herausforderung sehen nicht wenige Menschen in Gauersheim den seit einigen Monaten von der AfD im Ort installierten „Treffpunkt Nordpfalz“ in einem ehemaligen Gasthaus. Genau dort hatte die Partei für den gleichen Tag, allerdings eine Stunde später, selbst zum Bürgerdialog eingeladen. Entsprechend war reichlich AfD-Politikprominenz vor Ort.
Generell politisch aufgeheizte Stimmung
Seit der Einrichtung des Treffpunktes Nordpfalz, der neuen AfD-Zentrale auf dem Land, ist die politische Stimmung im Donnersbergkreis angespannt und aufgeheizt. Und dennoch hatten im Vorfeld des 3. Oktober weder die Ortsgemeinde, noch die Polizei auf dem Schirm, dass die Lage eskalieren könnte, wenn zwei Bürgerdialoge nur rund 300 Meter voneinander entfernt stattfinden. So dauerte es am Freitag auch nicht lange, bis die Beamten hinzugerufen wurden. „Zwischen Teilnehmenden der unterschiedlichen Veranstaltungen kam es zu verbalen Auseinandersetzungen sowie Bild und Tonaufnahmen mittels Smartphones, was zu Unruhe und Verunsicherung unter den Anwesenden führte“, erklärt die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Außerdem habe „ungeordnetes kommunikatives Durcheinander“ geherrscht, es sei „wechselseitig“, auch zu körperlichen Provokationen gekommen. Eine weitere Eskalation sei durch das Einschreiten der Polizei verhindert worden.
Ortsbürgermeister Reiner Schlesser sucht nach Lösungen, mit der »Herausforderung AfD-Treffpunkt Nordpfalz« umzugehen.
Foto: privat/oho
Damian Lohr, AfD-Landtagsabgeordneter für den Donnersbergkreis, sieht sich und seine Anhänger als Opfer. Man sei lediglich der Einladung gefolgt, da die „offenkundige Gegenveranstaltung“, wie er es nennt, damit geworben hatte, dass „alle herzlich willkommen“ wären. „Ich wurde beleidigt und an einer Wortmeldung gehindert“, kritisiert Lohr. Die Videos der AfD zeigen das zwar, lassen andere Dinge aber bewusst weg. So wird auch Jürgen Wiedenhöfer, Stadtratsmitglied der AfD in Mainz, gezeigt, wie er beim Filmen von Bürgermeister Schlesser und anderen Personen bedrängt wird. Was im Video nicht deutlich wird: Die Polizei hatte das Filmen vorab bereits untersagt.
Provokationen, Einschüchterung, Bedrohungen
Aus Sicht von Reiner Schlesser geht die Eskalation jedenfalls auf das provokante Auftreten der AfD-Delegation zurück: „Sie kamen mit mehr als 40 Leuten auf den Dorfplatz und haben direkt versucht, die anwesenden Bürger einzuschüchtern“, sagt Schlesser im RHEINPFALZ-Gespräch. Die AfD habe die andere Gruppe eingekesselt, was auf viele Anwesende bedrohlich gewirkt habe. Das habe letztlich die Eskalation der Situation bewirkt.
Wer nun an welchen Stufen der Eskalation die Schuld trägt, lässt sich auch aus dem Bericht der Polizei nicht wirklich herauslesen. Diese äußerte sich, nachdem die RHEINPFALZ bereits am Sonntag bei der zuständigen Polizeidirektion in Worms angefragt hatte, erst am Dienstag und bleibt vage. Die Beamten bestätigen aber, dass es zu Anzeigen aufgrund von Bedrohung und Beleidigung gekommen sei. Nach dem Einschreiten der Polizei habe sich die Lage insgesamt beruhigt, und der Bürgerdialog sei ohne weitere Zwischenfälle fortgeführt worden. Die AfD-Delegation habe sich in ihren „Treffpunkt Nordpfalz“ zurückgezogen und dort die eigene Veranstaltung wie geplant abgehalten.
Heftige Dispute zwischen AfD und Verwaltung
Im Vorfeld der beiden Bürgerdialoge hatte es bereits Auseinandersetzungen zwischen der AfD und der Verbandsgemeinde (VG) Kirchheimbolanden gegeben. Die VG hatte auf ihrer Facebook-Seite den privaten Bürgerdialog beworben. „Wir dachten, das sei eine Veranstaltung der Ortsgemeinde und haben diese gepostet“, erklärt Verbandsbürgermeisterin Sabine Wienpahl (SPD) dazu. „Ein Irrtum“, wie sie später ohne Umschweife zugab., die Veranstaltung war keien der Ortsgemeinde, was nicht sofort ersichtlich war. Damian Lohr regierte jedoch sofort und begann – öffentlich – nachzuhaken, warum die Verwaltung eine private Veranstaltung bewerbe. Er stellte das Neutralitätsgebot infrage. Es entwickelte sich eine Debatte, „in einem besonders scharfen Ton, der der Sache nicht angemessen war“, so Wienpahl auf RHEINPFALZ-Anfrage. Damian Lohr drohte unter anderem mit der Aufsichtsbehörde und juristischem Nachspiel. „Wir haben unseren Fehler eingeräumt und den Post umgehend gelöscht“, erklärt Bürgermeisterin Wienpahl. Ein bisschen war das Kind da jedoch schon in den Brunnen gefallen.
Denn die Pressesprecherin der VG, die versehentlich den Post abgesetzt hatte, war eingeschüchtert und hat geweint. „Sie habe mehrere Tage nicht ruhig schlafen können“, erzählte Sabine Wienpahl. Offensichtlich muss das auch Christian Wieser, AfD-Kreistags- und VG-Ratsmitglied, so gesehen haben. Er hat sich noch vor dem Feiertag persönlich in der Verbandsgemeinde entschuldigt. Auch dafür, dass Personen unverschuldet und unwissentlich in den Konflikt geraten seien, die nichts mit der politischen Aktion zu tun hatten. Ihm persönlich, so Wieser, sei ein „wertschätzender und respektvoller Umgang wichtig“.
In Gauersheim wurde der Ton dann wieder härter, rigoroser und unversöhnlicher.
https://www.rheinpfalz.de/
"Hier gilt Respekt"
In einem kleinen Ort voller Hass lebt das wohl mutigste Ehepaar Deutschlands
FOCUS online/Wochit
Christoph Maria Michalski
Samstag, 23.08.2025, 12:11
Zwei bleiben, ein Dorf atmet auf: In Jamel begrenzen die Lohmeyers den Rechtsextremismus – mit Musik, Öffentlichkeit und dem Mut, nicht wegzusehen.
Jamel, ein kleines Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, steht seit Jahren sinnbildlich dafür, wie sich rechtsextreme Milieus in den Alltag drängen können: einschüchternde Symbolik, gezielte Provokationen, Druck auf Nachbarn – ein Klima, das viele leise macht.
Mitten drin halten Birgit und Horst Lohmeyer dagegen: Ihr Festival „Jamel rockt den Förster“, das gerade läuft (22./23. August), schafft wie jedes Jahr einen geschützten Raum für Respekt, Musik und Sichtbarkeit. Es geht nicht um Romantik, sondern um Sicherheit im unmittelbaren Umfeld – für Gäste, für Nachbarn, für das Dorf.
Christoph Maria Michalski, bekannt als „Der Konfliktnavigator“, ist ein angesehener Streit- und Führungsexperte. Mit klarem Blick auf Lösungen, ordnet er gesellschaftliche, politische und persönliche Konflikte verständlich ein. Er ist Teil unseres EXPERTS Circle. Die Inhalte stellen seine persönliche Auffassung auf Basis seiner individuellen Expertise dar.
Dass namhafte Musiker aufgetreten sind, ist mehr als Kultur – es ist ein sichtbares Bekenntnis, das Angstzonen schrumpfen lässt: von den Toten Hosen, den Ärzten und Herbert Grönemeyer über die Fantastischen Vier und Kraftklub bis Deichkind und Marteria.
Genau das ist die Botschaft: Wenn Öffentlichkeit entsteht, schrumpft die Angstzone.
Tote-Hosen-Frontmann Campino (l.) singt auf der Hauptbühne des Festivals "Jamel rockt den Förster“.
dpa
Der Aachener Friedenspreis 2025 würdigt diese Ausdauer – und erinnert uns alle, dass demokratische Normalität nur dort wächst, wo Menschen konkret handeln.
Worum geht’s hier eigentlich – um ein Festival oder um Haltung? Um Haltung, die Musik macht. Birgit und Horst Lohmeyer setzen seit Jahren einen Kontrapunkt in Jamel: „Jamel rockt den Förster“ ist kein Sommerspaß, sondern ein Signalfeuer. Zwei Menschen stellen sich hin und sagen: „Hier gilt Respekt.“ Punkt.
In einer Welt, in der Algorithmen unsere Aufmerksamkeit zerhacken, ist das fast altmodisch. Genau deshalb wirkt es. Das Festival schafft Nähe, wo sonst Distanz regiert – nicht digital, sondern auf dem Dorfplatz, mit Blickkontakt und echtem Handschlag.
Was zahlen die beiden dafür – und warum bleiben sie trotzdem? Sie zahlen mit Nervenkraft, Sachschäden, Angstmomenten. Das ist kein Theaterdonner. Da brennt eine Scheune, da knallen Raketen, da brüllen Leute Parolen. Und die beiden bleiben.
Nicht, weil sie Angst nicht kennen, sondern weil sie ihr einen Rahmen geben. Sie geben dem Guten eine Adresse.
Buchempfehlung (Anzeige)
Christoph Maria Michalski
Bildquelle: Christoph Maria Michalski
Buchempfehlung (Anzeige)
"Streiten mit System: Wie du lernst, Konflikte zu lieben" von Christoph Maria Michalski.
Zum Buch auf Amazon
Wer bleibt, gibt anderen Mut zum Dableiben. So entsteht ein Gürtel aus Verbündeten.
Mut ist hier kein Selfie, sondern eine tägliche, manchmal müde, immer wieder entschiedene Bewegung: weiter.
Warum fällt Zivilcourage so schwer – gerade jetzt, wo Technik alles „leichter“ macht? Weil Technik Verantwortung entkoppelt. Wir tracken, liken, forwarden – und fühlen uns beteiligt. In Echtzeit. Nur: Beteiligung ist nicht dasselbe wie Beteiligung. Im echten Moment fragt niemand nach einem Emoji. Da zählen Sekunden, Stimme, Blick.
Außerdem: Wenn viele zuschauen, wartet jeder auf „die Anderen“. Und wenn Situationen unklar sind, sucht unser Kopf erst nach Beweisen, statt nach Worten.
Kurz: Wir sind nicht feige, wir sind überfordert. Deshalb braucht es einfache, lernbare Erstreaktionen.
„Das betrifft mich nicht“ – warum denken das so viele? Weil Distanz beruhigt. Unsere Timeline liefert uns täglich Probleme aus aller Welt – bequem auf dem Sofa. Das macht die Missstände groß und uns selbst klein.
Im Alltag hilft dann ein Trick: Wir reden uns ein, das sei ein Spezialfall „dort draußen“. Das schützt das eigene Nervensystem – und lässt die Lage vor Ort kippen.
Die Lohmeyers drehen diese Logik um: Sie holen das Thema auf Gehweg-Niveau. Wenn es mich betrifft, kann ich handeln. Nähe schlägt Ohnmacht.
Wie wird aus guter Absicht echte Hilfe – ohne sich selbst zu gefährden? Mit einfachen Tipps, die auch im Stress abrufbar sind:
- Hinschauen. Nicht wegdrehen, kurz atmen, stabil stehen.
- Ansprechen. „Stopp. So nicht.“ – leise, klar, wiederholbar.
- Personalisieren. „Sie mit der blauen Jacke: Bitte die 110 wählen.“
- Verbünden. „Kommen Sie kurz zu mir, wir bleiben hier zu zweit.“
- Dokumentieren & melden. Fakten sichern, keine Show.
Das klingt schlicht. Genau das ist die Stärke. Kleine Sätze sind belastbar. Große Reden brechen unter Druck.
Was heißt das für Unternehmen, Verwaltungen, Nachbarschaften – ab morgen früh? Machen Sie Haltung bedienbar wie einen Lichtschalter:
- Gebrauchsanweisung auf einer Seite. Wer tut was in welchen Situationen – mit Rufnummern und Standardsätzen.
- Sichere Wege. Anonyme Meldestellen, klare Nachsorge, kein Karriere-Malus für Courage.
- Mikro-Trainings. 15 Minuten pro Monat: Szenario, Satz, Rolle – fertig.
- Verbündete vernetzen. Betriebsrat, Stadt, Verein, Kultur. Kein Sololauf.
- Erfolge zeigen. „Mut-Momente“ sichtbar machen – nicht als Heldengalerie, sondern als Normalfall.
- Tech als Hebel, nicht als Ausrede. Notruf-App? Ja. Meldetool? Ja. Aber am Ende braucht es Menschen, die hingehen.
Wir rasen technisch nach vorn – aber menschliche Sicherheit entsteht nur offline, im Quadratmeter vor unseren Füßen.
Die Lohmeyers erinnern uns daran. Mut ist kein akkubetriebenes Gadget. Er ist Handarbeit.
Und genau diese Handarbeit hält unsere Gesellschaft zusammen, wenn die Timeline wieder mal auseinanderdriftet.
https://www.focus.de/
Rechtsextreme AfD plant gezielten Angriff auf linke Vereine – „NGO-Sumpf austrocknen“ als perfider Feldzug
AFD-NEONAZIS PLANEN MASSIVE ANGRIFFE AUF DEMOKRATISCHE GRUPPIERUNGEN!
30.07.2025
Ein uns zugesendetes, brisantes internes Dokument aus den Reihen der rechtsextremen AfD offenbart einen erschreckenden Plan: Die Partei will linke Vereine und gemeinnützige Organisationen systematisch lahmlegen und ihre Arbeit unmöglich machen.
Eine „GaN“ vorliegende E-Mail eines hochrangigen AfD-Politikers enthält eine mehrseitige Präsentation, die minutiös beschreibt, wie der „NGO-Sumpf“ ausgetrocknet werden soll – mit dem klaren Ziel, steuerfinanzierte Initiativen zu zerstören, die sich für Demokratie, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Diese haben wir den Verfassungs – und Staatsschutz, sowie der Generalstaatsanwaltschaft zugänglich gemacht!
Die rechtsextreme AfD sieht in diesen Organisationen offenbar einen Gegner, der nicht länger geduldet werden soll. Mit aggressiven Methoden will sie die finanzielle Grundlage vieler linker und zivilgesellschaftlicher Projekte entziehen, sie mit bürokratischen Hürden und politischem Druck zermürben und letztlich zum Schweigen bringen. Die Präsentation skizziert eine Strategie, die gezielt auf die Schwächung dieser Vereine abzielt – von der systematischen Diffamierung bis zur Aushöhlung ihrer Fördermittel.
Hinter der vermeintlichen Jagd auf den „NGO-Sumpf“ verbirgt sich nichts anderes als ein Angriff auf die pluralistische Gesellschaft und die vielfältigen Stimmen, die für ein demokratisches Miteinander kämpfen. Die AfD versucht, mit ihren rechten Machtinstrumenten das Engagement für eine offene Gesellschaft zu ersticken – und das auf Kosten unserer demokratischen Grundwerte.
Diese Enthüllung macht klar: Wer die AfD wählt, unterstützt eine Partei, die nicht nur Menschen spaltet, sondern auch das Herzstück der Zivilgesellschaft angreift. Die geplante Zerschlagung linker Vereine ist ein Angriff auf die Demokratie selbst. Wir müssen wachsam bleiben und diesen rechten Feldzug entschlossen bekämpfen!
Weiteres folgt....
Team
„Germany against NAZIS“
Quelle: Interne E-Mail eines hochrangigen AfD Politikers (liegt Reaktion vor); diese wurde verifiziert und dem Staats – und Verfassungsschutz zugesandt
Germany against NAZIS >>>
DEM HASS ENTGEGEN TRETEN - GESICHT ZEIGEN FÜR EIN OFFENES FRIEDBERG
30.07.2025
Mit großer Sorge nehmen wir, der Kreisverband BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Wetterau, zur Kenntnis, dass die rechtsextreme Jugendorganisation Junge Nationalisten (JN) für den 23. August 2025 zu einer Demonstration unter dem Motto „Heimat, Familie & Nation statt CSD“ nach Friedberg (Hessen) mobilisiert. Dieser Aufruf ist aus unserer Sicht kein legitimer Beitrag zur politischen Meinungsvielfalt, sondern eine gezielte Provokation gegen die offene Gesellschaft – gegen queere Menschen, gegen demokratische Grundwerte und gegen das friedliche Miteinander in unserer Stadt.
Besonders perfide: Die Gegenveranstaltung richtet sich bewusst gegen den CSD Wetterau, der am selben Tag in Friedberg stattfindet – ein Fest der Sichtbarkeit, Vielfalt und Solidarität. Während Menschen an diesem Tag friedlich für Selbstbestimmung, Respekt und Menschenwürde einstehen, versuchen rechtsextreme Kräfte, diesen Raum durch Einschüchterung und menschenfeindliche Rhetorik zu verengen.
Die Sprache und Symbolik der Ankündigung sind eindeutig. Unter dem Deckmantel vermeintlich konservativer Begriffe wie „Heimat“ oder „Familie“ wird Hass geschürt – gegen queere Lebensrealitäten, gegen Gleichberechtigung, gegen Vielfalt. Der CSD wird nicht kritisiert, sondern zum Feindbild erklärt – als vermeintliche Bedrohung einer „gesunden nationalen Ordnung“. Das ist nichts anderes als die Fortsetzung eines völkisch-nationalistischen Weltbilds mit jugendpolitischen Mitteln, getarnt als „Widerstand“.
Wir verurteilen diesen Aufruf auf das Schärfste. Wer queere Sichtbarkeit mit dem Untergang der Nation gleichsetzt, betreibt keine demokratische Auseinandersetzung, sondern gezielte Hetze. Wer Vielfalt zur Gefahr erklärt, verlässt den Boden eines respektvollen, demokratischen Miteinanders. Und wer versucht, ausgerechnet am Ort friedlichen Zusammenlebens eine Bühne für Intoleranz zu errichten, darf auf keinen Fall unwidersprochen bleiben.
Die Wetterau ist eine Region für alle – unabhängig von Herkunft, Identität oder sexueller Orientierung. Der CSD steht für Respekt, Würde und Menschenrechte. Wer sich diesem Zeichen der Offenheit entgegenstellt, stellt sich gegen das, was unsere Demokratie im Kern ausmacht: die Freiheit, verschieden zu sein – ohne Angst, ohne Ausgrenzung, ohne Gewalt.
Es braucht Haltung, nicht Wegschauen. Es braucht Solidarität, nicht Schweigen.
Wir rufen alle Demokrat*innen, Initiativen, Vereine und politischen Akteure dazu auf, sich dem geplanten rechten Aufmarsch friedlich, aber entschlossen entgegenzustellen und sich am ersten CSD in Friedberg zu beteiligen.
Für Vielfalt. Für Respekt. Für eine Gesellschaft, in der niemand aufgrund seiner Identität zur Zielscheibe wird.
Dem Hass entgegentreten – Gesicht zeigen für eine offene Wetterau.
GRÜNE Wetterau
https://www.facebook.com/GrueneWetterau
Emmerich
CDU und SPD kritisieren AfD-Angriff auf den Mittagstisch
Emmerich · Die AfD will Lebensmittelabgabe bei der katholischen Einrichtung erst für deutsche Staatsbürger, dann für andere Menschen. Harald Peschel spricht von politischem Kalkül, Albert Jansen von Zynismus.
23.07.2025 , 16:36 Uhr 3 Minuten Lesezeit
Im Emmericher Mittagstisch bekommen Bedürftige Lebensmittel kostenlos.
Foto: dpa/Christian Charisius
Die Emmericher SPD hat sich am Mittwoch mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt, um den Angriff der AfD gegen den Emmericher Mittagstisch nicht unkommentiert zu lassen.
Darin heißt es: „Mit großer Bestürzung haben wir als SPD Emmerich am Rhein den jüngsten Artikel über die Vorwürfe der AfD gegen den Mittagstisch der St. Christophorus-Gemeinde zur Kenntnis genommen. Was dort geschildert wird, ist bezeichnend für die politische Strategie der AfD: populistische Stimmungsmache, bewusste Desinformation und gezielte Spaltung unserer Gesellschaft.“
Zur Erinnerung: Die Emmericher AfD hat in einem Flyer, der an die Haushalte verteilt wurde, der katholischen Einrichtung vorgeworfen, dort werde Missbrauch zugelassen. AfD-Chef Kukulies findet, dass „zuerst Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft“ Hilfe zuteilwerden solle. Dann erst den anderen.
Harald Peschel (SPD) schreibt: „Was hier geschieht, ist keine Sozialpolitik, sondern politisches Kalkül auf dem Rücken der Schwächsten. Menschen in Not werden gegeneinander ausgespielt: Rentner gegen Geflüchtete, Deutsche gegen Ukrainer. Diese Taktik ist durchschaubar – und sie ist brandgefährlich. Wir dürfen nicht zulassen, dass das gesellschaftliche Klima in unserer Stadt durch solche polemischen Angriffe weiter vergiftet wird.“
Die Eltener CDU hat sich ebenfalls zum AfD-Angriff geäußert. Albert Jansen schreibt mit Blick auf die ehrenamtlichen Helfer des Mittagstisches: „Eure Unterstützung und euer Engagement machen einen großen Unterschied für Menschen in Not. Dank euer Hilfe kann bewirkt werden, dass die Gemeinschaft gestärkt wird.“
Die Behauptung der AfD, die Tafel würde Sozialmissbrauch zulassen, sei nicht nur falsch – sie sei zynisch. „Wer Bedürftige unter Generalverdacht stellt und ehrenamtliches Engagement diffamiert, zeigt, wie wenig Verständnis und Mitgefühl hinter der eigenen Politik stehen.“
Die Tafel helfe dort, wo der Staat oft versagt, so Jansen. „Und wer das angreift, will keine Gerechtigkeit, sondern Stimmung machen auf dem Rücken der Schwächsten.“
Die CDU Elten werde weiterhin mit ihrer Aktion „FüreinanderMiteinander!“ einen kleinen Teil für den Mittagstisch sammeln. Die CDU bedanke sich bei der Eltener Bevölkerung für die jährliche tolle Unterstützung.
Der CDU-Stadtverband hat eine Erklärung der ehrenamtlichen Helfer des Mittagstisches, die sich gegen die AfD wehren, auf seiner Homepage veröffentlicht. Von anderen Parteien in Emmerich hat es bislang keine Reaktion gegeben.
(hg)
https://rp-online.de/
Vortrag zum "Schwachkopf"-Fall
Habeck-Rentner hat Honorarvertrag der AfD in der Tasche
Von
t-online
,
law
27.06.2025 - 18:58 Uhr
Lesedauer: 4 Min.
Nicht mit leeren Taschen: Rentner Stefan Niehoff (l.) bekam ein Honorar, durch das Foto wurde es bekannt. (Quelle: Afd_Fraktion im Bundestag/Montage: t-online)
Die AfD lädt sich zum Thema Meinungsfreiheit Rentner Stefan Niehoff ein, der nach einem "Schwachkopf"-Meme die Polizei im Haus hatte. Ein Detail auf dem Foto vom Besuch macht Furore.
Ein voll besetzter Saal, in dem sonst ein Ausschuss des Bundestags tagt. Neben den Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner und Martin Renner sitzt Stefan Niehoff und erzählt vom 12. November 2024: Ein Polizeibesuch machte ihn da bundesweit bekannt. Niehoff ist zu einer Galionsfigur geworden für jene, die eine übergriffige Justiz als willige Vollstreckerin einer politischen Elite sehen, die die Meinungsfreiheit einschränken wolle. AfD-Chefin Alice Weidel ließ sich prompt mit dem Franken fotografieren, als der am Mittwoch zu einer Veranstaltung "Für die Freiheit der Rede" eingeladen war.
Das gemeinsame Foto und ein weiteres Bild mit Brandner verrieten ein Detail, das danach im Netz zum Spott über die AfD diente: Niehoff wurde von der AfD bezahlt. Allerdings ist das gar nichts Ungewöhnliches.
Beim Zoomen in das Foto ist zu erkennen, dass in Niehoffs Brusttasche ein Stück Papier steckt – Aufschrift: "Honorarvereinbarung". Das entdeckte eine Nutzerin im Netzwerk X, wo AfD-Anhänger Bilder von dem Treffen verbreiteten, und postete den vergrößerten Ausschnitt. Dieser zog dann rasch Kreise. So ein Posting sei "einer der Gründe, X und die Findigkeit der X-User, trotz allem zu lieben", meint Andreas Kynast aus dem ZDF-Hauptstadtstudio. Die Findigkeit bekämen alle Parteien zu spüren und "oft genauso zu Recht". Nutzer schauen genau hin, greifen kuriose Details auf – und plötzlich geht es um ganz andere Dinge als vom Politiker im Posting ehemals beabsichtigt.
Empfohlener externer Inhalt
Bezahlung von Referenten bei Fraktionsveranstaltungen üblich
Weidels Sprecher Daniel Tapp kommentiert die Entdeckung auf Anfrage von t-online amüsiert: "In den aktuellen Zeiten ist es doch schön, wenn man auch mal etwas Lustiges findet." In den Vorgang war er nicht eingebunden. Ein Sprecher der AfD-Fraktion bestätigte t-online, dass Niehoff, der mit Tochter und Ehefrau nach Berlin gereist war und seine Kosten erstattet bekam, auch ein Honorar gezahlt wurde.
Ein Aufreger sei das aber nicht, heißt es aus anderen Fraktionen. "Wenn es kein exorbitanter Betrag war – und das ist unwahrscheinlich." Wenn Arbeitskreise Referenten einladen, würden regelmäßig Honorare gezahlt. Ein Formular der Bundestagsverwaltung für eine Honorarvereinbarung gibt es nicht. Die Abwicklung liegt bei der jeweiligen Fraktion.
Bei der Planung solcher Veranstaltungen werden Kostenaufstellungen gemacht, die von Arbeitskreisverantwortlichen oder dem Fraktionsvorstand genehmigt werden müssen. In vielen Fällen bekomme man Referenten für Veranstaltungen gar nicht, wenn man ihnen nicht ein Honorar zahle. Diese Aufwände bewegten sich hierbei im dreistelligen Bereich. Einblick nimmt später möglicherweise der Bundesrechnungshof, der schaue dabei auch genau hin und prüfe die Plausibilität.
Sieben Minuten spricht Niehoff vor der AfD-Fraktion
Wie viel Niehoff gezahlt wurde, will die AfD-Fraktion nicht verraten. Nach Informationen von t-online lag der Betrag im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Niehoffs Auftritt bei der Veranstaltung ist in einer Aufzeichnung zu sehen – er dauert sieben Minuten.
Dort erzählt Niehoff, was bereits durch die Presse ging. Beim Aktionstag gegen Hasskriminalität im November klingelte es morgens um 6.15 Uhr an seiner Tür. Niehoff sprang aus dem Bett, das er sich mit kleinen Kampfhunden teilt, während Frau und Tochter in einem anderen Stock schlafen. Im Schlafanzug öffnete er den zwei Polizisten die Tür.
- Hausdurchsuchung nach Habeck-Beleidigung: Das steckt dahinter
Am Küchentisch mit den Beamten las er den Durchsuchungsbeschluss. Auf der ersten Seite stand etwas von "Paragraf 130 Volksverhetzung", auf der zweiten Seite das, was dann republikweit viel Empörung auslösen sollte: Vorgeworfen wurde ihm eine Straftat nach Paragraf 188. Dieser umfasst gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung. Konkret ging es um ein Bildchen – angelehnt an das Logo der Kosmetikmarke "Schwarzkopf" – aber mit einem Schattenriss von Robert Habeck und dem Text "Schwachkopf". "Wegen dem Schwachsinn steht ihr so früh auf und weckt mich?", habe er den Polizisten gesagt.
"Der PC bleibt hier!"
Die Beamten wollten seine elektronische Geräte mitnehmen als möglichen Beweis, dass er den Kommentar gepostet hatte. "Ich habe gesagt, der PC bleibt da. Das Tablet könnt ihr mitnehmen." Hierauf gewährte er den Beamten Zugriff auf seinen X-Account, in dem er den Beitrag gepostet hatte. Der PC blieb da, die Beamten gingen mit dem Tablet.
Niehoff erzählt ferner, wie er die Medienlawine ins Rollen brachte: "Ich habe die einschlägigen Medien kontaktiert wie 'Epoch Times' und 'Nius'." Die "Welt" sei als Erste bei ihm gewesen. Er habe ausdrücklich mit Namen und Foto erscheinen wollen, damit die Berichte mehr Wirkung entfalteten. Dafür erntete er in der AfD-Veranstaltung kräftigen Applaus.
Habeck hatte zum Zeitpunkt der Durchsuchung noch gar keine Kenntnis von dem Fall gehabt. Und Niehoff wurde später auch nicht deshalb belangt – sondern wegen anderer Postings. Gegen die geringe Geldstrafe möchte er rechtlich vorgehen. Sein Fall hatte aber die Diskussion um den Paragrafen 188 angeheizt. Die AfD fordert in einem Gesetzesantrag seine Abschaffung, Stephan Brandner sticht dabei als Wortführer hervor.
Brander bestätigte vor den Zuhörern zudem Recherchen von t-online, wonach auch Alice Weidel eine Fülle von Strafanträgen wegen Beleidigung nach dem Paragrafen gestellt hatte. Er verteidigte das Vorgehen: "Solang es geltendes Recht ist, und die anderen es nutzen, ist es ein Gebot der Waffengleichheit." Außerdem, so Brandner, "gibt es auch eine Grenze, wo man sagt, das ist wirklich eine üble Beleidigung." Zudem gehe die Initiative meist von der Staatsanwaltschaft aus. "Auch ich bekomme die Post mit der Frage, ob ich Strafantrag stellen will."
Brandner erklärte, der Paragraf sei in guter Absicht entstanden: Er solle "ehrenamtliche Kommunalpolitiker besser schützen". Das sei aber völlig aus dem Ruder gelaufen. Hauptamtliche Politiker, die eigentlich mehr aushalten müssten, nutzten das Gesetz, um ihre Anwaltsfirmen das Internet mittels KI nach Beleidigungen durchforsten zu lassen. Damit spielte Brandner vor allem auf die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann an, die mehr als 2.000 Strafanträge gestellt hatte.
https://www.t-online.de/
Strafanzeigen
„Politiker wollen sich nicht mehr der Kritik der Bürger stellen“
Veröffentlicht am 05.06.2025Lesedauer: 2 Minuten
Alice Weidel soll laut „t-online“ zahlreiche Anzeigen wegen Beleidigung erstattet haben. Beispielsweise, weil sie als Nazi-Schlampe bezeichnet wurde. Weidels Sprecher versucht zu beschwichtigen.
Quelle: WELT TV
Autoplay
Sahra Wagenknecht attackiert Alice Weidel, weil die AfD-Vorsitzende Strafanzeigen wegen Politiker-Beleidigung gestellt habe – obwohl sie den Paragrafen eigentlich abschaffen will. Wagenknecht sieht den Paragraf 188 als Zeichen für einen „autoritären Umbau der Gesellschaft“.
Sahra Wagenknecht kritisiert AfD-Chefin Alice Weidel für das Anzeigen von Beleidigungen. „Etwas politisch abschaffen wollen, es jedoch selbst hundertfach nutzen, ist – gelinde gesagt – inkonsequent. Damit ist Alice Weidel auf Habeck-Niveau“, sagte die BSW-Vorsitzende WELT.
Die AfD bezog sich nach Recherchen von „t-online“ bei ihren Strafanzeigen auf den Paragraf 188 des Strafgesetzbuchs (StGB). Dieser regelt „gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung“. Darin heißt es: Wird eine Person des öffentlichen Lebens wegen jener Stellung beleidigt und „ist die Tat geeignet, sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren“, kann eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.
Eingeführt wurde der Paragraf bereits 1951, beschränkte sich zunächst aber auf „üble Nachrede“ und Verleumdung. Ausgeweitet auf Beleidigungen wurde er 2021.
Lesen Sie auch
Alternative for Germany (AfD) co-leader Alice Weidel speaks during a plenum session of the lower house of parliament, the Bundestag, in Berlin, Germany May 14, 2025. REUTERS/Lisi Niesner
Ressort:Deutschland
Medienbericht
Politikerbeleidigungen – Alice Weidel nutzt umstrittenen Paragrafen 188
Das Brisante daran: Die AfD wettert regelmäßig gegen den Paragrafen und fordert die Abschaffung. Weidels Sprecher verteidigte das Vorgehen der Parteivorsitzenden und sprach von einer „rechtlichen Waffengleichheit“. Man lehne das Gesetz ab, dennoch „wäre es töricht, wenn sich die AfD bis zur Abschaffung nicht zur Wehr setzen würde“.
Im vergangenen Jahr wurde breit über Anzeigen des damaligen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) berichtet. Hintergrund war etwa eine Hausdurchsuchung bei einem Mann, der Habeck im Internet einen „Schwachkopf“ genannt hatte.
Lesen Sie auch
24.05.2025, Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Delegierte verschwinden hinter mobilen Wahlkabinen auf dem Landesparteitag der AfD. Der Landesparteitag der AfD Sachsen-Anhalt wird mit Aufstellung der Landesliste zur Landtagswahl 2026 fortgesetzt. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
AfD-Gutachten
Der zweifelhafte Versuch, die Union als rechtsextrem zu brandmarken
Das BSW fordert die Streichung des Paragrafen. „Allein Karl Lauterbach hätte ich mehrfach wegen wüster Beleidigungen anzeigen können und habe es nicht getan“, so Wagenknecht über den ehemaligen Bundesgesundheitsminister von der SPD. Erst vergangene Woche bezeichnete Lauterbach das BSW auf X als „Partei von Putinknechten“ und nannte den verpassten Bundestagseinzug der Wagenknecht-Partei einen „Segen“.
Wagenknecht lehnt eine explizite Benennung von öffentlichen Personen im Strafgesetzbuch für falsch. „Ein Majestätsbeleidigungs-Paragraf passt nicht zu einem liberalen Land. Er ist Teil eines autoritären Umbaus der Gesellschaft, in der sich Politiker nicht mehr der Kritik der Bürger stellen wollen, sondern Staatsanwaltschaften auf sie loslassen“, so die BSW-Chefin.
Schon im Wahlkampf zur Bundestagswahl im Februar forderte Wagenknecht immer wieder eine Streichung des Paragraf 188. In einem WELT-Interview sagte sie im Dezember 2024: „Damit kann man jede Regierungskritik mundtot machen. Wenn ein Bürger Habeck für einen ‚Schwachkopf‘ hält, ist das in einer liberalen Gesellschaft von der Meinungsfreiheit gedeckt.“
cul
https://www.welt.de/
Doppelmoral der AfD
Alice Weidel erstattet Hunderte Anzeigen wegen Beleidigung im Netz
In der Debatte über die »Schwachkopf«-Beleidigung gegen Robert Habeck spielte sich die AfD als Hüterin der Meinungsfreiheit auf. Nun kommt heraus: Vor allem Parteichefin Weidel macht massiv vom Paragrafen 188 Gebrauch.
02.06.2025, 16.40 Uhr
- AfD-Chefin Alice Weidel
Bild vergrößern
AfD-Chefin Alice Weidel Foto: Bernd Elmenthaler / action press
Im vergangenen Jahr sorgte eine Anzeige von Robert Habeck für Aufsehen: Der ehemalige Wirtschaftsminister und Vizekanzler ging juristisch gegen einen Rentner vor, der ihn auf X als »Schwachkopf PROFESSIONAL« bezeichnet hatte. Vor allem die AfD nutzte die daraufhin aufkeimende Debatte, um gegen den Minister und die Verwendung des umstrittenen Paragrafen 188 Stimmung zu machen. Dabei greift die Partei ihrerseits massiv darauf zurück, wie eine Recherche von »T-Online« ergeben hat. Allen voran Parteichefin Alice Weidel.
Dem Bericht zufolge machten Alice Weidel und andere AfD-Politiker in Hunderten Fällen selbst von dem Paragrafen Gebrauch, wenn sie im Netz beleidigt wurden. Paragraf 188 des Strafgesetzbuches ermöglicht es, »gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung« rechtlich vorzugehen. Paradox daran: Öffentlich fordert die AfD die Abschaffung der Regelung.
AfD spricht von »rechtlicher Waffengleichheit«
Weidels Sprecher Daniel Tapp nannte das Vorgehen »rechtliche Waffengleichheit«. Obwohl man das Gesetz ablehne, »wäre es töricht, wenn sich die AfD bis zur Abschaffung nicht zur Wehr setzen würde«.
Weidel selbst hatte Habecks Anzeige und den damit einhergehenden Durchsuchungsbeschluss scharf angegriffen : Die Hausdurchsuchung sei »ein skandalöser Eingriff in die Meinungsfreiheit, völlig unverhältnismäßig und eines Rechtsstaates unwürdig«, schrieb sie damals auf X. Ihre Partei wolle »eine lebendige Demokratie, in der Bürger wieder ohne Angst jedem #Schwachkopf ihre Meinung sagen können!« Erst später hatte sich herausgestellt, dass die Razzia bei dem Rentner bereits beantragt worden war, bevor der Grünenpolitiker in dem Fall selbst Strafantrag stellte.
In einer Rede im Bundestag sprach Weidel im Dezember zudem von einer »so panischen wie mimosenhaften politischen Klasse«, die die Justiz missbrauche, um »aufsässige Bürger nach einem eigens geschaffenen Majestätsbeleidigungsparagrafen zum Schweigen zu bringen«.
Hass im Netz: Warum kommt die Polizei in die Wohnung eines Mannes, der Robert Habeck einen Schwachkopf nennt? Von Dietmar Hipp, Karlsruhe
Warum kommt die Polizei in die Wohnung eines Mannes, der Robert Habeck einen Schwachkopf nennt?
Durchsuchungsbeschlüsse wegen Internetbeleidigungen: Die Doppelmoral der AfD Von Dietmar Hipp, Karlsruhe
Die Doppelmoral der AfD
Die genaue Anzahl der Anzeigen ist nicht bekannt. Während Weidel-Sprecher Tapp beteuert, eine dreistellige Zahl sei nicht zusammengekommen, zitiert »T-Online« zwei Anwälte, die Betroffene vertreten. Ihnen liegen zusammen rund 300 Anzeigen der AfD gegen beleidigende Aussagen im Netz vor. Ein Großteil davon gehe auf Alice Weidel zurück.
Bereits 2017 hatte die AfD-Chefin Strafanzeige gegen einen Moderator der NDR-Sendung »extra 3« gestellt, der sie als »Nazischlampe« bezeichnet hatte. Der Erlass einer einstweiligen Verfügung wurde allerdings zurückgewiesen.
eru
https://www.spiegel.de/
Nazis attackieren Hausprojekt in Cottbus
Sichere Orte gesucht
Die Cottbuser „Zelle79“ ist erneut von Nazis angegriffen worden. Nun rücken viele links-alternative Projekte in der Lausitz zusammen.
29.05.2025
Hausprojekt in Cottbus So bun wie Cottbus: Das Hausprojekt Zelle 79
Foto: Jonas Wahmkow
Jonas Wahmkow
Cottbus taz | Der Schreck sitzt immer noch tief, als Fabi Buchholz die Spuren des Angriffs zeigt. Die Brandstellen im Hinterhof, wo die Pyro-fackeln niedergegangen sind, der durch den Steinwurf abgeplatzte Putz an der Fassade. „Die wollten mit einem Rammbock ins Haus eindringen“, sie deutet auf das schwere Stahlgeländer, das im Hinterhof liegt. „Es ging nur darum, uns zu zerstören.“
Das Cottbuser Hausprojekt Zelle79, in dem Buchholz wohnt, wurde am vergangenen Wochenende in der Nacht zu Samstag von einer Gruppe vermummter Neonazis angegriffen. Sie riefen rechtsextreme Parolen, versuchten die Haustür aufzubrechen, warfen Steine und verursachten einen Brand im Hinterhof. Es ist die Fortsetzung einer Serie rechter Gewalt gegen linke Strukturen in Südbrandenburg. Die Betroffenen wollen dem mit stärkerer Vernetzung und gegenseitiger Hilfe entgegenwirken.
Die Zelle79 ist eine feste Größe in der alternativen Szene Cottbus. Das 1999 gegründete Wohnprojekt liegt etwas abgeschieden unweit des Hauptbahnhofs und sticht mit seiner bunt bemalten Fassade deutlich heraus. Das Projekt bietet Raum für Workshops, regelmäßige Kochabende und einen Umsonstladen. Wenn etwas Subkulturelles oder Politisches in der 100.000-Einwohner-Stadt passiert, sind Bewohner:innen des Hausprojekts ziemlich sicher beteiligt. Die linke Szene in Cottbus sei klein, aber lebendig, sagt Buchholz. „Es gibt ganz viele tolle Orte, und wir sind einer davon.“
Neu ist die Gewalt nicht. Seit Jahren ist das Haus Zielscheibe und Reizpunkt für Cottbus’ rechtsextreme Szene. Hakenkreuz-Sticker an der Hausfassade, jemand wirft sich nachts gegen die Tür oder ruft „Scheiß Zecken“. Angepöbelt zu werden, weil man die „falsche“ Frisur oder das „falsche“ T-Shirt trägt, ist Alltag in Cottbus. „Das ist das normale Grundrauschen. Da stumpfst du irgendwann ab“, erklärt die Zelle79-Bewohnerin.
Doch in den vergangenen Monaten nahm die Intensität der Angriffe zu. Im Dezember schlugen zwei Personen einen Bewohner vor dem Eingang des Hauses zusammen, als dieser gerade Sticker der extrem rechten Kleinstpartei „Dritter Weg“ entfernte, berichtet Buchholz. Ende Januar versammelten sich mindestens 13 Neonazis vor dem Haus, forderten die Bewohner:innen auf herauszukommen, warfen Bierflaschen und zündeten eine Pyrofackel.
Rechte Hochburg Cottbus
Ende März der nächste Angriff: Eine Gruppe vermummter Jugendlicher warf mehrere Pflastersteine gegen das Haus, die heruntergelassenen Rollos verhinderten Schlimmeres. Ohne sie „hätte jemand auch beim Schlafen einen großen Stein abbekommen können“, sagt Buchholz. Dann der Angriff am vorigen Wochenende. „Wir spüren die Schnelligkeit, mit der die Gewalt eskaliert.“ Der Organisationsgrad der Angriffe sei mit jedem Mal gestiegen. Die Menge an Pyrotechnik und das mitgeschleppte Stahlgeländer deuten auf eine geplante Aktion hin.
Die Stadt hat sich in den letzten Jahrzehnten zur rechten Hochburg entwickelt. Gewaltbereite Hooligans und Neonazi-Kameradschaften stehen im regen Austausch mit der AfD und der rechtspopulistischen Bewegung „Zukunft Heimat“. „Die Rechten sind extrem gut vernetzt und haben gute Strukturen, um Nachwuchs ranzuzüchten“, erklärt Buchholz. Besonders in der rechtsdominierten Fanszene des Drittligisten Energie Cottbus würden sich viele Jugendliche radikalisieren. Auch die Angreifer auf Zelle79 vermuten die Bewohner in diesem Umfeld.
„Die Täter werden immer jünger und immer weniger ängstlich“, sagt Ricarda Budke von der Initiative Sichere Orte. Das vor wenigen Monaten gegründete Bündnis sorgt für erste Hilfe im Falle rechter Angriffe auf linke Projekte. Die Entwicklung sei auch eine Folge des allgemeinen Rechtsrucks, so Budke. „Nazis gewinnen an Boden, wenn es in der Mitte der Gesellschaft bröckelt.“
Die Dynamik macht den Bewohner:innen Angst. „Ich habe verstanden, dass sie uns im Zweifel töten wollen, nur weil wir eine andere Meinung haben“, ist Buchholz sich sicher. Wegziehen und den Nazis das Feld überlassen wollen sie und die anderen Bewohner:innen dennoch nicht. „Ich lebe gerne in Cottbus, ich habe hier einen starken Freundeskreis“, sagt die junge Frau, die im sozialen Bereich arbeitet.
Die Gewalt gegen Zelle79 ist kein Einzelfall. Der Verein Opferperspektive vermeldete 2024 einen starken Anstieg rechter Gewalttaten. Die Zahl der erfassten Fälle erreiche die Extremwerte von 2015. Besonders auffällig sei der Anstieg von Angriffen auf politische Gegner:innen, die sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt hätten.
„Es geht nicht nur um uns, in den umliegenden Kleinstädten ist die Lage viel schlimmer“, sagt Fabi Buchholz. In Senftenberg griffen im März 35 Neonazis, vermutlich ebenfalls aus der Cottbuser Fanszene, einen Jugendklub an. In Altdöbern brannte im vergangenen Oktober ein Kulturhaus, ein geplanter Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Senftenberg konnte vorige Woche durch eine Razzia gegen die neonazistische Gruppierung „Letzte Verteidigungswelle“ verhindert werden.
Angesichts der zunehmenden Intensität rechter Gewalt setzt Südbrandenburgs Zivilgesellschaft auf stärkere Vernetzung, wie in Form der Initiative Sichere Orte. „Ein Angriff auf einen Ort ist ein Angriff auf uns alle“, sagt Ricarda Budke. Gerade für kleinere Projekte „auf dem flachen Land“, stellen rechte Angriffe eine enorme Belastung dar. Das Bündnis will im Fall des Falles Betroffene mit Spenden und praktischer Hilfe unterstützen. „Die klare Botschaft ist, ihr steht nicht alleine da“, so Budke. Aktuell unterstützt sie die Zelle79 bei der Öffentlichkeitsarbeit. Denn Angriffe auf linke Projekte werden oft nicht wahrgenommen, auch weil sich viele Projekte erst spät an die Öffentlichkeit wagen.
Immerhin: Auch sonst macht die Solidarität den Bewohner:innen des Hausprojekts Mut. „Wir haben sehr viel Unterstützung aus der Stadtgesellschaft und der Nachbarschaft erhalten“, sagt Buchholz. Selbst Cottbus’ Bürgermeister Tobias Schick (SPD) und Brandenburgs Innenminister René Wilke (parteilos) haben sich geäußert. Im jahrelang von der CDU regierten Cottbus, wo rechte Gewalt gerne heruntergespielt wurde, keine Selbstverständlichkeit.
https://taz.de/
AfD-Fraktion fragt nach Demonstrationen gegen die AfD
28.05.2025
Inneres — Kleine Anfrage — hib 185/2025
Berlin: (hib/SCR) Die AfD-Fraktion thematisiert in einer Kleinen Anfrage (21/255) die Demonstrationen gegen die AfD am 11. Mai 2025. Wie die Fraktion darin schreibt, hat an diesem Tag ein bundesweiter Aktionstag gegen Rechts stattgefunden, der nach Auffassung der Fragesteller darauf abgezielt habe, „den politischen Druck für ein Verbotsverfahren gegen die Alternative für Deutschland (AfD) zu erhöhen“, obwohl das Bundesamt für Verfassungsschutz die Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ bereits am 8. Mai 2025 - also kurz nach der Bekanntgabe - wieder zurückgenommen beziehungsweise eine Stillhaltezusage abgegeben habe.
Gefragt wird unter anderem, ob Teilnehmer extremistischen Phänomenbereichen zuzuordnen waren. Zudem will die Fraktion wissen, ob die Bundesregierung „Kenntnisse über Unterwanderungen oder Unterwanderungsversuche dieser Proteste durch Links- oder Klimaextremisten“ hat.
Ein weiterer Schwerpunkt der Anfrage liegt auf der möglichen staatlichen Förderung: Die Abgeordneten fragen, ob Organisationen mit Bundesmitteln unterstützt wurden, die an den Protesten beteiligt waren - direkt oder über Länderprogramme. Auch das Engagement der Gruppe „Omas gegen Rechts“ bei den Demonstrationen wird im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit thematisiert.
https://www.bundestag.de/
2.4.1 Online-Artikel zu Angriffen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, mit Beleidigungen und Diffamierungen der "Omas gegen Rechts"
„Omas gegen Rechts" erstatten Anzeige wegen AfD-Plakat
Stand:12.12.2025, 07:00 Uhr
Von: Dieter Priglmeir
Wehren sich gegen Beleidigungen und Diffamierungen: die Omas und Opas gegen Rechts.
Wehren sich gegen Beleidigungen und Diffamierungen: Die Omas und Opas gegen Rechts diskutieren im AWO-Treff, wie sie mit der Situation umgehen. © Dieter Priglmeir
Die Gruppe fühlt sich durch ein Plakat am AfD-Stand diffamiert. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Verleumdung.
Erding - „Wir Omas sind weder für Messerstecher noch für Vergewaltiger.“ Maria Brand war auch Tage später noch völlig außer sich wegen eines Plakats, das am Samstag in der Erdinger Innenstadt am Stand der AfD zu sehen war. Auf 13 Zeilen waren die „Omas gegen Rechts“ (OgR) diffamiert worden – unter anderem als Befürworter von Krieg und Völkermord. Jetzt hat die Gruppierung bei der Polizei Strafanzeige gestellt.
Polizeioberrat Sebastian Pinta bestätigte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Die Polizeiinspektion Erding prüfe derzeit, inwieweit die Inhalte des bekannten Plakats die Tatbestände der Beleidigung und der Verleumdung erfüllen. Die Staatsanwaltschaft Landshut sei eng eingebunden. Die Ermittlungen richteten sich derzeit noch gegen unbekannt.
Das Plakat hat ein AfD-Mitglied mitgebracht. Der Text ist laut Wolfgang Kellermann den sozialen Netzwerken entnommen.
Das Plakat hatte ein AfD-Mitglied mitgebracht. © privat
OMAS_gegen_Rechts_das-plakat-hat-ein-afd-mitglied-mitgebracht-der-text-ist-laut-wolfgang-kellermann-den-sozialen-netzwerken-entnommen-OrBG
„Verlust von komplett jedem Anstand“
Für die OgR, die sich Anfang des Jahres als Erdinger Regionalgruppe gegründet haben, um sich gegen einen Rechtsruck der Gesellschaft zu wehren, ist die Lage klar: „Es sind Beleidigungen, es ist Rufmord gegen jeden, der sich in der Gruppe engagiert“, sagte Brand bei einem Treffen am Montagabend vor rund 40 Mitstreiterinnen und Mitstreitern, denn längst haben sich der Gruppierung auch Opas angeschlossen.
Sie machten eine Verrohung der Sitten aus. „Vor fünf Jahren, wenn so ein Plakat irgendwo bei einer politischen Partei gestanden hätte, hätte sich jeder umgedreht und gesagt: Mit so etwas will ich nichts zu tun haben“, sagte einer aus der Runde. Eine andere bezeichnete dies als typische AfD-Masche: „Mit völlig unglaubwürdigen Aussagen an die Öffentlichkeit zu treten, um irgendjemanden zu diffamieren und zu verleumden. Das sind für mich unlautere Mittel.“ Was dahinterstecke, sei kriminell und verfassungsfeindlich. „Das müssen wir aufzeigen. Dafür sind wir da.“
Etliche Mitglieder der Gruppe zeigten sich zutiefst getroffen: „Wir sind in unserer Würde und Ehre total angegriffen“ – „Das ist Verleumdung“ – „Das ist der Verlust von komplett jedem Anstand.“
Dabei hatten die Omas sogar versucht, die Sache noch am Samstag mit den Leuten am AfD-Stand zu klären, wie ein Mitglied erzählte. „Ich habe sie aufgefordert, das Plakat abzunehmen, aber das ging nicht, weil man mir so auf die Pelle gerückt ist. Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber wenn ein 1,80 Meter großer Mann mit einem spitzen Kugelschreiber auf mich zukommt …“ Statt das Plakat abzunehmen, „haben die auch noch damit herumgewedelt“, berichtete sie.
Warum die Stadt nicht eingreift
„Ist dieses Plakat im Stadtrat bekannt?“, wollte ein weiteres OgR-Mitglied wissen. „Da ist eine AfD-Fraktion, die an ihrem Stand dieses Plakat hat.“
AfD-Stadtrat Wolfgang Kellermann verwies auf Anfrage der Heimatzeitung auf einen Flyer, in dem die OgR die AfD scharf kritisieren, etwa „Hass gegen Menschen anderer Herkunft und Lebensart“ vorwerfen. Das Banner vom Samstag kursiere in den sozialen Netzwerken. „Wer der Urheber ist, weiß ich nicht. In unserem Fall hat ein Bürger und Parteimitglied von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht und das Banner beim Infostand mitgenommen.“
https://www.merkur.de/
Anzeige der „Omas gegen Rechts“
Erdinger Polizei ermittelt wegen Plakats bei AfD-Stand
11.12.2025, 16:02 Uhr|Lesezeit: 2 Min.
Zum Treffen der „Omas gegen Rechts“ am Dienstag in Erding kamen auch einige Opas.
(Foto: Renate Schmidt)
Zusammenfassung
Die „Omas gegen Rechts“ fühlen sich durch ein Plakat verunglimpft, in dem ihnen die Befürwortung von Gewaltverbrechen unterstellt wird. Die Polizei prüft nun, ob es sich um eine Beleidigung handelt. Die AfD droht ihrerseits mit einer Anzeige wegen Verleumdung.
Von Regina Bluhme, Erding
Ein Plakat bei einem AfD-Stand in der Erdinger Innenstadt am vergangenen Samstag könnte ein juristisches Nachspiel haben. Schlagwortartig wurde darauf die Erdinger Gruppierung „Omas gegen Rechts“ mit der Befürwortung von Gewaltverbrechen und Völkermord in Verbindung gebracht. Die „Omas“ wehren sich und haben Anzeige erstattet. Aktuell ermittelt die Polizei Erding wegen des Verdachts der Beleidigung – zunächst noch gegen unbekannt.
„Wir sind betroffen und beleidigt. Das ist Rufmord“, so fasste Maria Brand, eine der Initiatorinnen der Erdinger „Omas gegen Rechts“, bei einem Gruppentreffen am Dienstag zusammen, zu dem etwa 30 Frauen und auch ein paar Männer gekommen waren. „Wir haben das Plakat bei der Polizei gemeldet“, sagt Maria Brand. Die für Plakate übliche Information über den Verfasser im Sinne des Presserechts fehle.
Sebastian Pinta, Leiter der Polizeiinspektion Erding, bestätigt, dass am Sonntagabend eine schriftliche Anzeige erfolgt sei. Daraufhin seien Ermittlungen begonnen worden wegen des Verdachts der Beleidigung, „unter Umständen auch wegen Verleumdung“, bislang gegen unbekannt.
Der Erdinger AfD-Stadt- und Kreisrat Wolfgang Kellermann schreibt auf Nachfrage, das Plakat, das aus den sozialen Medien stamme, habe ein AfD-Mitglied mitgebracht, „ein Bürger“, der sich auf das Grundgesetz beziehe und vom Recht der freien Meinungsäußerung Gebrauch mache. Im Übrigen sei die Polizei an dem Stand gewesen und habe „den Bürger“ nicht aufgefordert, dieses Plakat zu entfernen. Sollte eine Anzeige kommen, dürften die „Omas gegen Rechts“ laut Kellermann im Gegenzug „eine Anzeige wegen Verleumdung von uns erwarten“.
Die Polizei war am Stand, hat aber nicht eingegriffen
Die Frage, warum die Polizei am Samstag nicht das Plakat abnehmen ließ, erklärt Sebastian Pinta damit, dass die Polizei gerade in Wahlkampfzeiten mit größtmöglicher Neutralität und Sensibilität vorgehen und genau abwägen und prüfen müsse, ob Inhalte von der Meinungsfreiheit gedeckt seien oder ob sich um eine mögliche Straftat handle. Beim Erdinger Plakat werde nun „auf rechtsstaatlichem Wege“ diese Frage in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft geklärt.
Von Stadt-Pressesprecher Christian Wanninger ist zu erfahren, dass der AfD-Wahlstand am vergangenen Samstag ordnungsgemäß nach dem Versammlungsgesetz angemeldet und die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet gewesen sei.
Beim Treffen der „Omas gegen Rechts“ am Dienstag waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig, dass sie die Öffentlichkeit wissen lassen wollen, mit welchen Mitteln „hier rechtschaffene Leute verunglimpft werden“, wie es ein Teilnehmer ausdrückte. Geplant ist auch, alle im Erdinger Stadtrat vertretenen Parteien anzuschreiben und über den Inhalt des Plakats informieren.
Erst Ende November hatte ein heftiger Shitstorm die „Omas gegen Rechts“ in Aufregung versetzt. Ein Artikel in einer Lokalzeitung über die Erdinger Initiative hatte auf Facebook innerhalb weniger Stunden mehr als 3500 Kommentare, darunter Verschwörungstheorien, Beleidigungen und kaum verhohlene Drohungen zur Folge.
Zugleich gebe es Unterstützung und Ermutigung, betont Maria Brand. Die Erdinger Kreisgruppe, erst Anfang 2025 gegründet, verfüge inzwischen über 190 E-Mail-Adressen von Unterstützerinnen. Künftig will sich die Gruppe noch besser vernetzen und sie ist auf der Suche nach juristischem Beistand. Vielleicht, so hieß es beim Treffen, finde sich ja eine „Juristenoma gegen rechts“.
https://www.sueddeutsche.de/
Kommunalwahl 2025
AfD attackiert „Omas gegen Rechts“: Rechtliche Schritte geprüft
Düsseldorf. In einem Wahlflyer attackiert die Düsseldorfer AfD Kulturschaffende und NGOs. Darunter sind auch die „Omas gegen Rechts“. Diese wollen sich wehren.
Von Lucas Gangluff
03.09.2025, 08:00 Uhr
„Omas gegen Rechts“ aus Düsseldorf im Februar 2025 am DGB-Haus. Für derartige Protestaktionen kritisiert die AfD die Initiative nun in ihrem Wahlprogramm. (Archivbild)
© NRZ | Stephan Wappner
Ein Flyer der AfD zur Kommunalwahl am 14. September sorgt in Düsseldorf aktuell für Wirbel. In der aufklappbaren Wahlwerbung werden Kulturstätten in Düsseldorf, Vereine und Initiativen als Teile der „linksextremen Szene“ tituliert. Diese würden mit städtischen Geldern finanziert, um Andersdenkende zu „attackieren und kriminalisieren“. Gegen diese Behauptung wehren sich nun die Düsseldorfer „Omas gegen Rechts“, die explizit von der rechtspopulistischen Partei attackiert werden.
AfD Düsseldorf: „Omas gegen Rechts“ sollen Geld von Stadt erhalten haben
„Wir finanzieren uns komplett aus Spenden“, erklärt Christiane May von den Düsseldorfer „Omas gegen Rechts“. Von der Stadt erhielte die Initiative keinerlei finanzielle Unterstützung. Man weise daher die Behauptungen der AfD entschieden zurück. Ebenso lege die etwa vierzigköpfige Gruppe aus Düsseldorf Wert auf Überparteilichkeit sowie friedlichen Protest. „Die Vorstellung, die da geweckt wird, als würden wir die Leute irgendwie körperlich angreifen, ist absurd“, so May. „Wir sind ein paar ältere Frauen, die sich für die Demokratie einsetzen.“
So laute das Credo der Omas: „Wir stehen ein für die Aufrechterhaltung unserer demokratischen Gesellschaft, in der Diskussion ein wichtiges Merkmal für ein friedliches Miteinander ist.“ Dennoch prüfe man aktuell rechtliche Schritte um gegen die Aussagen auf dem AfD-Flyer vorzugehen. „Wir haben Kontakt zu einer Anwältin, mit der wir darüber sprechen, eine Unterlassungserklärung durchzusetzen.“ Damit wolle man eine weiter Verbreitung des Flyers der, so May, ihres Wissens nach in Gerresheim und Grafenberg verteilt worden sei, verhindern. Inzwischen kenne man diese Angriffe allerdings.
Düsseldorf: AfD attackiert Zakk, „Rock gegen Rechts“ und „Omas gegen Rechts“
„Seitdem diese Vorwürfe gegen uns in die Welt gesetzt wurden, haben die sich immer wieder vervielfältigt“, beschreibt May die Erlebnisse der Gruppe. Zwar hätten in der Vergangenheit die „Omas gegen Rechts“ auf Bundesebene einmal Geld für ein Demokratieförderungsprojekt erhalten, aber das habe nicht mit der Initiative in Düsseldorf zu tun. Die Gruppe setze sich aktuell vor der Kommunalwahl bei Mahnwachen „in den Stadtteilen dafür ein, das demokratische Grundrecht der Wahl wahrzunehmen und rufen dazu auf, demokratische Parteien zu wählen“.
In dem Wahlflyer der rechtspopulistischen Partei, nimmt der Punkt „Der linksextremen Szene den Subventionshahn zudrehen!“ nur eine der acht Flyerseiten ein. Die Partei kritisiert hier „Destruktive Kunstformen, ideologische Zentren“ und einen Kulturkampf, der sich „mit unnötigen Straßenumbenennungen beschäftigt.“ Als Lösung dafür wolle man nicht nur „Gendersprache in der städtischen Kommunikation“ sofort untersagen. Sondern man wolle auch NGOs – also Nicht-Regierungs-Organisationen wie den „Omas gegen Rechts“ – kein Geld mehr zukommen lassen. Das gleiche gelte auch für das jährliche Festival „Rock gegen Rechts“. Und auch dem „sogenannten Kulturinstitut Zakk“ wolle man sämtliche städtischen Gelder streichen.
Zakk-Chefin zur AfD-Kritik: „Dann haben wir alles richtig gemacht“
Bei eben diesem „sogenannten Kulturinstitut“ hat man den Flyer ebenfalls bereits zur Kenntnis genommen. „Diese Angriffe der AfD auf uns sind nichts Neues“, erklärt Zakk-Geschäftsführerin Kristin Schwierz. „Das Zakk ist für die AfD hier in Düsseldorf ein rotes Tuch.“ Sie wolle die Situation nicht verharmlosen, schließlich schüre die AfD zumindest auf Landesebene Stimmung gegenüber Kultureinrichtungen. Doch für sie zeigt die Reaktion der Partei: „Dann haben wir alles richtig gemacht.“
Im Gegensatz zu den „Omas gegen Rechts“ wird das Zakk zwar von der Stadt Düsseldorf unterstützt. Dass diese finanziellen Mittel nun jedoch in Gefahr seien könnten, sieht Schwierz nicht. „Wir haben im vergangenen Jahr erst die Finanzierung der Freien Szene für die kommenden Jahre beschlossen. Das war für uns ein deutliches Signal der demokratischen Parteien, dass sie unsere Arbeit unterstützen.“
Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Düsseldorf
Auf eine Anfrage beim Düsseldorfer Kreisverband der AfD erhielt die NRZ Düsseldorf bis zum Redaktionsschluss am Dienstagabend keine Rückmeldung.
https://www.nrz.de/
Nach Regenbogenaktion
Gewaltaufruf und Vergewaltigungsfantasien: Shitstorm gegen Marburgs „Omas gegen rechts“
Teilnehmerinnen einer Demonstration halten Schilder „Omas gegen Rechts“ (Themenfoto).
Es sind ekelhafte Kommentare, die sich in den sozialen Medien wiederfinden: Nach der OP-Berichterstattung erhielten Marburgs „Omas gegen rechts“ einen Shitstorm. Das deckte ein Recherchekollektiv auf.
Tobias Kunz
25.04.2025, 18:26 Uhr
Marburg. Der OP-Artikel zu den „Omas gegen rechts“, die in Marburg Ruhebänke in Regenbogenfarben bemalt haben, wurde im Internet Tausende Male geklickt – zog aber auch etliche Hasskommentare nach sich, wie das Recherchekollektiv „Die Insider“ am Freitag veröffentlichte. „Die Insider“ betreiben einen Instagram- und einen Facebook-Account und enthüllen regelmäßig Hassposts, die in geschlossenen Gruppen oder auf privaten Profilen veröffentlicht werden. Oft handelt es sich dabei um AfD-nahe Seiten, teilweise finden sich Gewaltaufrufe auch auf den Seiten von AfD-Politikern.
So schrieb laut den Insidern etwa ein User „ermordet sie“ unter den geteilten Beitrag auf einer öffentlichen Facebook-Seite. Diesen Kommentar schickte das Recherchekollektiv laut eigener Aussage am Freitagmorgen an die Polizeistation Marburg und die Staatsanwaltschaft Göttingen. Auf OP-Anfrage konnte die Marburger Polizei am Freitagnachmittag dazu keine Auskunft geben.
Auch abseits dieses Mordaufrufs lassen sich reihenweise geschmacklose und ekelhafte Kommentare finden. So schrieb ein weiterer User: „Wegen euch müsste man die Prügelstrafe wieder in Kraft setzen.“ Eine andere Nutzerin schrieb „ab in die Urne mit denen“. Eine weitere Person: „Die sollen Socken und Mützen stricken, damit ihre Enkel im Krieg nicht frieren.“
Am Krekel steht eine der fünf von den „Omas gegen rechts“ gestalteten Regenbogenbänke.
Quelle: Kathrin Thiemann
Auf der Seite einer Frau, die laut den „Insidern“ AfD-Mitglied ist, schrieb ein Nutzer unter den geteilten Beitrag etwa „Hoffendlich (sic!) werden von denen ein paar von den Gästen abgestochen oder richtig beklaut. Das wäre eine Freude“, ein anderer „einschläfern“. In einer geschlossenen Facebook-Gruppe namens „Wir sind der Rechtsruck“ schrieb laut den Insidern eine Frau: „Alle in einen Sack und dann ‚Gib ihm‘ mit den bunten Latten. Man trifft nie die Falsche.“
Lesen Sie auch
- Für Queer-Szene in Marburg: Debatte um Regenbogen auf Schlosstreppe
- Eine Regenbogentreppe für Marburg? So sehen OP-Nutzer den Plan
- Schlosstreppe in Regenbogenfarben? Das sagt Marburgs Queer-Szene
Neben den Aufrufen zu körperlicher Gewalt lassen sich auf den Profilen und in der Gruppe zahlreiche Beleidigungen und derbste Vergewaltigungsfantasien finden.
OP
https://www.op-marburg.de/
"Abgewrackte Schabracken": Ermittlungen gegen AfD-Politiker
24.02.2025, 10:10 Uhr
Weil er Mitglieder der Bewegung "Omas gegen Rechts" als "abgewrackte Schabracken" bezeichnet haben soll, ermittelt die Polizei gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Christian Blex. Das bestätigt ein Sprecher der Dortmunder Polizei auf Anfrage. Wie der Sprecher sagt, hat der Staatsschutz der Dortmunder Polizei den Fall übernommen, der ursprünglich in Lippstadt (Kreis Soest) spielt. Dort hatte es am Samstag eine AfD-Kundgebung und eine Gegendemo gegeben, bei der auch Mitglieder der "Omas gegen Rechts" dabei waren.
Die Staatsanwaltschaft entscheidet nun, wie es weitergeht und ob sie gegebenenfalls die Aufhebung von Blex' Immunität als Abgeordneter beim Landtag beantragt.
Die Staatsanwaltschaft entscheidet nun, wie es weitergeht und ob sie gegebenenfalls die Aufhebung von Blex' Immunität als Abgeordneter beim Landtag beantragt.
(Foto: picture alliance / SvenSimon)
In einem Youtube-Video der Kundgebung ist zu hören, wie Blex am Mikrofon sagt: "Im Gegensatz zu den ekligen Omas gegen Rechts haben wir Kinder. Wir haben Kinder. Das sind nämlich keine Omas, das sind abgewrackte Schabracken, die überhaupt nichts hingekriegt haben in ihrem Leben." Danach führt Blex aus, dass die "Omas gegen Rechts" im Gegensatz zu "normalen Frauen" nicht von Migranten belästigt würden: "Klar, wer will die schon anfassen?" Die Polizei, die vor Ort war, hörte mit und erstattete laut dem Sprecher Anzeige gegen den Abgeordneten wegen des Verdachts der Beleidigung.
Quelle: ntv.de
https://www.n-tv.de/
Bei Wahlkampfveranstaltung
AfD-Politiker beleidigt „Omas gegen Rechts“ – Anzeige erstattet
18.02.2025, 12:33 Uhr • Lesezeit: 1 Minute
Louisa Thönig
Von Louisa Thönig
Demonstration gegen Rechts - Bremen
Zahlreiche Menschen, darunter Teilnehmerinnen der Organisation «Omas gegen Rechts», demonstrieren gegen Rechtsextremismus. (Archivbild)
© DPA Images | Hauke-Christian Dittrich
Berlin. Eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in Lippstadt könnte nun strafrechtliche Konsequenzen haben. Grund ist eine verbal entgleiste Rede.
Am Wochenende hat die AfD in Lippstadt eine Wahlkampfveranstaltung veranstaltet. Zu der erschienen auch zahlreiche Gegendemonstranten. Angeführt wurde der Protest von rund 50 Mitgliedern der Initiative „Omas gegen Rechts“, die sich gegen Rechtsextremismus engagiert. Genau diese Gegendemonstranten nahm sich der AfD-Politiker Christian Blex in seiner Rede zum Ziel.
Der AfD-Abgeordnete diffamierte die Teilnehmerinnen, bezeichnete sie als „abgewrackte Schabracken“ und ließ weitere beleidigende Bemerkungen folgen. Laut Berichten der Tageszeitung „Der Patriot“ äußerte sich der Politiker zudem abfällig über Transpersonen, die er als „Drag/Dreck-Viecher“ titulierte.
Auch interessant
11.01.2025, Sachsen, Riesa: Teilnehmer einer Demonstration gegen den Bundesparteitag der AfD stehen an der Protestbühne vor der WT Energiesysteme Arena. Auf dem Parteitag soll das Bundestagswahlprogramm verabschiedet und die Co-Vorsitzende Weidel als Kanzlerkandidatin aufgestellt werden. Foto: Jan Woitas/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
AfD-Parteitag
Wie eine 74-Jährige in Riesa gegen die AfD demonstriert
Von Christian Unger
Polizei erstattet Strafanzeige gegen AfD-Politiker Christian Blex
Da Blex seine Äußerungen öffentlich und in Anwesenheit der Polizei machte, reagierte diese umgehend: „Wir haben noch am selben Abend eine Strafanzeige gestellt“, erklärte Polizeisprecher Marco Baffa-Scinelli gegenüber „Bild“. Der Fall wurde an den Staatsschutz Dortmund und die Staatsanwaltschaft Paderborn übergeben. Nun wird geprüft, ob die Aussagen strafrechtlich relevant sind.
Sollte es zu einem Strafverfahren gegen Christian Blex kommen, müsste zuvor die Immunität des Abgeordneten aufgehoben werden. Der AfD-Politiker, promovierter Mathematiker und ehemaliger Oberstudienrat, gehört der Partei seit 2013 an und sitzt seit 2017 im Landtag von Nordrhein-Westfalen.
https://www.morgenpost.de/
Polizei ermittelt gegen AfD-Politiker Christian Blex wegen Beleidigung
Stand: 18.02.2025, 18:46 Uhr
Wegen Beleidigung ermittelt die Polizei gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Christian Blex. Der Lehrer hat demnach auf einer AfD-Kundgebung in Lippstadt "Omas gegen Rechts" als "abgewrackte Schabracken" bezeichnet.
Von Detlef Proges
Die AfD-Kundgebung fand laut Polizei am Samstag, 15. Februar, in Lippstadt statt. Daneben habe es eine Gegenkundgebung gegeben, bei der auch Mitglieder der Bewegung "Omas gegen Rechts" dabei waren.
In einem Telefonat mit dem WDR bestätigte Christian Blex am Dienstag, ja, er habe sicher "abgewrackte Schabracken" gesagt. In einem Video auf der Plattform YouTube ist der Auftritt von Christian Blex, dem AfD-Politiker aus Liesborn im Kreis Warendorf offenbar zu sehen.
Staatsschutz in Dortmund hat Ermittlungen übernommen
In dem Video sagt Christian Blex, das seien abgewrackte Schabracken, die überhaupt nichts hinbekommen hätten in ihrem Leben.
Und wörtlich fügte er hinzu: "Sie haben afrikanische, arabische Armutszuwanderung, komplett kulturfremd, Messerzuwanderung in unser Land gelassen. (…) Sie werden nicht mehr begangen. Klar, wer will sie schon anfassen. Aber die normalen Menschen, die normalen Frauen hier werden belästigt bei uns."
Blex beklagt mangelnde Meinungsfreiheit
Demo: Omas gegen RechtsEine Kundgebung der "Omas gegen Rechts" war offenbar Anlass für die Beleidungen
Die Polizei selbst hat Anzeige gegen den AfD-Mann aus dem Kreis Warendorf erstattet, nachdem sie die Äußerungen bei der Kundgebung gehört hatte.
Christian Blex kommentierte im Telefonat mit dem WDR die Ermittlungen gegen ihn nicht. Er betont aber, dass auch AfD-Mitglieder oft als Nazischlampen und Faschisten beschimpft würden.
AfD-Politiker Christian BlexPolizei ermittelt gegen AfD-Politiker Blex wegen BeleidigungWDR Studios NRW 18.02.2025 00:51 Min. Verfügbar bis 18.02.2027 WDR Online
Und dass jetzt links-woke Kreise aufschreien würden, zeige doch nur, dass der US-Vizepräsident J. D. Vance Recht habe, wenn er besorgt darüber sei, wie es um die Meinungsfreiheit hierzulande bestellt sei.
Staatsanwaltschaft über die weiteren Schritte
Die Ermittlungen gegen den Landtagsabgeordneten hat inzwischen der Staatsschutz der Polizei in Dortmund übernommen, der ist zuständig bei politisch motivierten Straftaten. Die Staatsanwaltschaft entscheidet nun, wie es weitergeht und, ob möglicherweise die Immunität des AfD-Landtagsabgeordneten aufgehoben wird.
Unsere Quellen:
- Polizei Dortmund
- dpa
- Telefonat mit Christian Blex
- "Alt sein heißt nicht stumm sein": Die Oberhausener Omas gegen Rechts | mehr
- Zahlreiche Demos "gegen Rechts" in NRW | mehr
- Nach Rauswurf: Christian Blex wieder in NRW-AfD-Fraktion aufgenommen | mehr
„Schabracken“-Entgleisung der AfD: „Omas gegen Rechts“ wehren sich mit offenem Brief
Stand:17.02.2025, 14:43 Uhr
Von: Katja Burgemeister
Mehrere Tausend Menschen demonstrieren in Lippstadt gegen die AfD – die Fotos
Bei der AfD-Kundgebung in Lippstadt hatte die Polizei die Beleidigung gegen die „Omas gegen Rechts“ dokumentiert. © Daniel Schröder
In einem offenen Brief reagieren die „Omas gegen Rechts“ auf die Beleidigung, die ein AfD-Landtagsabgeordneter bei der Kundgebung in Lippstadt geäußert haben soll.
Soest/Lippstadt – Sie marschierte in der ersten Reihe der „Omas gegen Rechts“ bei der Gegendemonstration gegen die AfD-Kungebung am Samstag, 15. Februar, mit. „Gehört habe ich nichts von den unglaublichen Äußerungen“, schildert die Soester „Oma“ ihre persönlichen Eindrücke. „Davon haben wir erst später gehört und waren durchweg alle sehr empört!“, kommentiert sie den von der Polizei dokumentierten Spruch von Dr. Christian Blex auf der Kundgebung, der die „Omas gegen Rechts“ als „abgewrackte Schabracken“ bezeichnet haben soll. „Tatsächlich bekommen wir so etwas häufiger auch im privaten Umfeld und an unseren Ständen zu hören“, sagt die Soesterin. Deshalb sorgt sie jetzt auch dafür, dass der offene Brief ihrer Mitstreiterinnen eine Öffentlichkeit findet.
In diesem offenen Brief wenden sich die „abgewrackten Schabracken“ der „Omas gegen Rechts“ direkt an den AfD-Landtagsabgeordneten Christian Blex und stellen fest: „Wir...müssen Ihnen und Ihrer AfD ja mächtig Angst machen, dass Sie sich als gebildeter Mensch zu so einer Respektlosigkeit hinreißen lassen.“ Sie stellen sein Frauenbild infrage und „fühlen sich geehrt“: „Dann müssen wir ja was bewegen und darauf sind wir stolz!“, interpretieren sie seine verbalen Äußerungen. Zudem verweisen die „Omas gegen Rechts“ in ihrem offenen Brief auf das Grundgesetz, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit als „Zeichen von Freiheit, Unabhängigkeit und Mündigkeit selbstbewusster Bürgerinnen und Bürger“ sowie das Streikrecht und versprechen: „Ja, wir dürfen demonstrieren und wir werden weiter demonstrieren!“ Sie fordern außerdem allgemein dazu auf, am Sonntag zur Wahl zu gehen und „nicht eine Partei“ zu wählen, „die eure liebsten Angehörigen so respektlos behandeln!“
„Omas gegen Rechts“ beleidigt: Staatsschutz ermittelt
Die Äußerung von den „abgewrackten Schabracken“ war von der Polizei im Rahmen der AfD-Kundgebung dokumentiert worden. Inzwischen hat sie Strafanzeige gestellt und der Staatsschutz in Dortmund hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen, bestätigt Polizeisprecher Marco Baffa-Scinelli. Die Äußerungen waren direkt an die „Omas gegen Rechts“ gerichtet worden, die mit einer Gruppe von Frauen unter anderem aus Warstein, Belecke, Soest und anderen Städten des Kreises Soest zur Gegendemonstration angereist waren.
Die Soester „Oma“ hatte ihre Mitstreiterinnen, die mit selbst gestalteten Schildern und Plakaten ihre Auffassung deutlich machten, lautstark mit einer Trommel unterstützt. Damit war sie in den vergangenen Tagen auch in Soest selbst bei verschiedenen Veranstaltungen präsent. Zudem bemüht sie sich, eine eigene Soester Gruppe der „Omas gegen Rechts“ zu etablieren und hat dabei bereits vielfältige Unterstützung etwa bei der Suche nach Räumen für Treffen oder bei ihrem Engagement für den Abbau von Ängsten „gegen alles Fremde“ und für die Wahrung der Demokratie erfahren.
Innerhalb der Gruppe der „Omas gegen Rechts“ haben die Äußerungen hohe Wellen geschlagen, die sich am Montag noch in „vielen Diskussionen“ auf WhatsApp äußerten. Aber auch überregional war die Empörung über die AfD-Äußerungen groß.
https://www.soester-anzeiger.de/
2.4.2 Online-Artikel zu Angriffen gegen die Kirchen und kirchliche Organisationen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD
AfD in Sachsen-Anhalt greift Kirchen offen an
Stand:02.02.2026, 10:32 Uhr
Kommentare
Drucken
Teilen
Logo der AfD. Auf blauem Grund in Weiß steht AfD, darunter ein roter Pfeil.
Logon der AfD. © epd-bild/Peter Jülich
Sieben Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt spricht die AfD in ihrem Programmentwurf davon, staatliche Zahlungen an Kirchen einzustellen. Für die Kirchen wären die Folgen existenziell.
Die AfD in Sachsen-Anhalt bereitet eine Frontalattacke gegen die Kirchen vor. In dem bekannt gewordenen Entwurf des Wahlprogramms für die Landtagswahl am 6. September erklärt die Partei unumwunden: Wir „greifen die Kirchensteuerkirchen an“. So werde man die Staatsleistungen für Kirchen „ohne weitere Kompensation“ einstellen und den Kirchensteuereinzug über die Finanzämter beenden, wenn man in Regierungsverantwortung sei. Zudem fordert die Partei „deutsch denken!“ und eine 180-Grad-Wende in der Migrationspolitik.
Das 156 Seiten umfassende Papier trägt den Titel „Regierungsprogramm“ und liegt dem Evangelischen Pressedienst (epd) vor. Es soll auf dem Landesparteitag im April in Magdeburg beraten und verabschiedet werden.
Die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD in Sachsen-Anhalt liegt bei Umfragen in dem Bundesland seit Monaten stabil bei 39 Prozent. Bliebe es so, dürfte die Partei bei der Landtagswahl in sieben Monaten erstmals in Regierungsverantwortung kommen.
Bischof Kramer: „Kampfansage gegen die Kirchen“
„Die Kirchenfeindschaft und Zerstörungswut der AfD sind ja hinreichend bekannt“, sagte der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, dem epd zu dem Programmentwurf. Da die mitteldeutschen Kirchen seit Jahren vor deren menschenverachtenden Positionen warnten und mit Kampagnen wie „Herz statt Hetze“ oder „Unser Kreuz hat keine Haken“ klar Position bezögen, seien sie zur Zielscheibe der Rechtsaußen-Partei geworden.
Deshalb sei er nicht überrascht, dass „das Programm der AfD eine offene Kampfansage gegen die Kirchen und unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft“ sei. In ähnlicher Weise hatte sich zuvor auch der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Karsten Wolkenhauer, geäußert. Der katholische Bischof des Bistums Magdeburg, Gerhard Feige, sagte: „Handschrift und Duktus des Programmentwurfs machen klar: Wer AfD wählt, wählt die Methoden Donald Trumps für Sachsen-Anhalt.“
Forderungen gefährden Sozialprojekte
Laut Programmentwurf möchte die AfD „die Privilegien der Kirchensteuerkirchen abschaffen“, weil diese angeblich „nicht mehr den christlichen Glauben pflegen, sondern die Regenbogenideologie“ vorantreiben würden. Was die Partei und ihr angriffslustig auftretender Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (AfD) unerwähnt lassen: Kirchen und Diakonie sind wichtige Träger von Kindereinrichtungen und Schulen, Krankenhäusern, Beratungsstellen und Pflegeangeboten - besonders dort, wo es an staatlichen Angeboten mangelt. Die ersatzlose Streichung dieser Gelder hätte somit massive Auswirkungen.
Bischof Feige bezeichnete die AfD-Forderungen als „dramatisch“. Die Staatsleistungen, die die Partei streichen will, sind in Sachsen-Anhalt in den Kirchenstaatsverträgen des Landes festgelegt. Sie werden vor allem als Entschädigungen für die staatliche Enteignung kirchlicher Güter, Wälder und Stiftungen im 19. Jahrhundert sowie während der Bodenreform in den Jahren 1945 bis 1950 geleistet.
Würden diese Leistungen einseitig gekündigt, könnten die Kirchen natürlich klagen. Doch es würde Jahre dauern, bis Gerichte letztinstanzlich den Rechtsbruch korrigieren, meint Feige. Die Folgen wären für das Bistum „existenziell“. Viele soziale Angebote könnten nicht fortgesetzt werden.
Diakonie will nicht schweigen
Auf Konfrontationskurs geht die AfD auch beim Thema Asyl. Die Angriffe gelten besonders den kirchlichen Wohlfahrtsorganisationen Diakonie und Caritas, die als „Asyl- und Integrationsindustrie“ diffamiert werden. Dabei tragen deren Integrationsprojekte und Deutschkurse auch dazu bei, dass sich Asylbewerber für Berufe etwa in der Pflege qualifizieren oder ausländische Ärzte schnellstmöglich die Lücken in Arztpraxen und Krankenhäusern schließen.
Die AfD wittert hingegen den Missbrauch von Steuergeldern und eine Unterwanderung zum Schaden der „einheimischen Bevölkerung“. Deshalb beabsichtigt sie, diesen Projekten „den Geldhahn zuzudrehen“. Zudem fordert ihr Programmentwurf, die Möglichkeit des Kirchenasyls zu „unterbinden“. Dabei gab es nach Auskunft des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt Ende 2025 lediglich 17 Fälle von Kirchenasyl im Land.
Der Chef der Diakonie Mitteldeutschland, Christoph Stolte, machte deshalb schon zu Jahresbeginn deutlich: „Wenn das Zusammenleben zur Debatte steht, weil Gruppen von Menschen ausgegrenzt, weil Lebensweisen diskreditiert oder gesellschaftliche Institutionen zerstört werden, dann schadet das allen.“ Für die diakonischen Einrichtungen im Land blieben Menschlichkeit, Mitgefühl und christliche Nächstenliebe weiterhin die Handlungsmaximen. „Wenn eine Partei sich gegen diese Werte positioniert, können wir dazu nicht schweigen“, ergänzte Stolte. (von Thomas Nawrath)
https://www.az-online.de/
AfD-Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt
Frontangriff gegen die Kirchen
27.01.2026
gepostet von: Online-Redaktion
Landtag von Sachsen-Anhalt |
Foto: epd-bild/Viktoria Kühne
Landtag von Sachsen-AnhaltFoto: epd-bild/Viktoria Kühne
hochgeladen von Online-Redaktion
Magdeburg (KNA) Zur Landtagswahl am 1. September in Sachsen-Anhalt hat die AfD jetzt einen Entwurf für ihr Wahlprogramm vorgelegt. Es sieht für den Fall einer Regierungsübernahme vor, die Zahlung der Staatskirchenleistungen einzustellen, ebenso den staatlichen Kirchensteuereinzug. Zudem will der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Landesverband das Kirchenasyl unterbinden. In Wahlumfragen lag die AfD in Sachsen-Anhalt zuletzt bei 40 Prozent und hätte erstmals eine Chance, einen Ministerpräsidenten zu stellen.
In dem Papier spricht die AfD von "Kirchensteuerkirchen". Da diese sich von ihrer "Kernaufgabe", der Pflege des christlichen Glaubens, entfernt hätten und eine "Regenbogenideologie" propagierten, wolle man "all ihre Privilegien abschaffen". Weiter heißt es: "Gerade weil wir um die Bedeutung des Christentums wissen, greifen wir die Kirchensteuerkirchen an, denn die großen Kirchen schaden dem Glauben."
Staatsleistungen ersatzlos streichen
Die AfD will im Fall einer Regierungsübernahme die Staatsleistungen, die das Land jährlich an die Kirchen zahlt - derzeit rund 43 Millionen Euro, ersatzlos streichen. Ihr zufolge können die Staatsleistungen auch ohne weitere Kompensation eingestellt werden. Das ist juristisch fraglich, da die bestehenden Verträge nicht einseitig aufgekündigt werden können. Die meisten Staatsleistungen gehen zurück auf das Jahr 1803. Damals wurden zahlreiche Kirchengüter enteignet und verstaatlicht. Staatsleistungen sind vergleichbar mit Pacht- und Mietzahlungen. Der staatliche Zuschuss für die Evangelische Akademie in Wittenberg in Höhe von jährlich 70.000 Euro soll ebenfalls unverzüglich gestrichen werden. Die AfD wirft ihr "politische Agitation im Sinne der Altparteien" vor.
Zudem will die AfD den staatlichen Kirchensteuereinzug einstellen. Tatsächlich zieht die staatliche Finanzverwaltung für die Kirchen die Kirchensteuer ein, die sich an der Höhe der Einkommensteuer bemisst. Für diese Dienstleistung erhält der Staat aber auch von den Kirchen einen Anteil von zwei bis vier Prozent.
Kirchenasyl - finanzielle Verantwortung
Das Kirchenasyl verstößt nach Ansicht der AfD gegen geltendes Recht. "Eine AfD-geführte Landesregierung wird in Zusammenarbeit mit den Ausländer- und Polizeibehörden dafür sorgen, dass alle Kirchenasylanten schnellstmöglich aus Sachsen-Anhalt abgeschoben werden", heißt es im Wahlprogramm. Zudem will die AfD in jedem Einzelfall prüfen lassen, ob sich die Kirchen beim Gewähren von Kirchenasyl strafbar gemacht haben, durch "Anstiftung oder Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt". Ferner kündigte die AfD an, wenn Abschiebefristen durch Kirchenasyl verstrichen, zu prüfen, ob man die Kirchengemeinden für die Folgekosten in finanzielle Verantwortung nehmen könnte.
https://www.meine-kirchenzeitung.de/
2.5 Online-Artikel zu Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen staatliche Institutionen, Politiker*innen, Grundgesetz und Demokratie
Thüringen: Das AfD-Theater muss aufhören! Wir sollten jetzt handeln
von Benjamin Pogadl
05.02.2026 - 05:59 Uhr
Das Misstrauensvotum gegen den Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) ist eine Farce. Wie lange wollen wir noch zusehen?
Ein Montagebild des Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt und des AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke
© IMAGO / Bernd Elmenthaler/ Funke Foto Services / Montage: Thueringen24
Ministerpräsident von Thüringen: Das ist Mario Voigt von der CDU
Nächstes AfD-Theater vor dem Thüringer Landtag. Die Hauptdarsteller wurden dabei von der Rechtsaußen-Partei höchstselbst gecastet. Als Bösewicht muss Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hinhalten, gegen den sich jetzt AfD-Fraktionschef Björn Höcke in Szene setzen kann.
Das Drehbuch ist dabei schon erprobt im letzten Misstrauensvotum, das die AfD im Juli 2021 gegen den damaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) ins Rollen brachte. Im Ergebnis wird das auch am Mittwoch (4. Februar) nicht anders ausfallen. In mehr als einer Hinsicht. Zwar wird der Ministerpräsident im Amt bleiben. Aber das Fundament unserer Demokratie in Thüringen bröckelt munter weiter. So kann das nicht weitergehen. Ein Kommentar.
Thüringen: Misstrauensvotum wird zur Farce
Der Vorstoß hat faktisch keine Aussicht auf Erfolg. Um das zu erkennen, muss man nicht mal den Landtagsfraktionen von CDU, BSW, Linke und SPD Glauben schenken, die sich im Vorfeld geschlossen für eine Ablehnung des Misstrauensvotums aussprachen. Man muss sich einfach vor Augen halten, dass es für die Nicht-AfD-Fraktionen machtpolitisch überhaupt keinen Grund geben würde, gegen den amtierenden Ministerpräsidenten zu stimmen. Ein erfolgreiches Misstrauensvotum würde in dieser Form nur der AfD nützen und sonst niemandem. Und mit ihren 32 Sitzen kommt die AfD nicht auf die notwendige Mehrheit (45 von 88 Stimmen).
Genau das macht den Dolch gegen Voigt aber auch so giftig. Denn egal, wie die Abstimmung am Mittwochnachmittag ausgeht – es ist die perfekt ausgestaltete Bühne für die AfD, um sich erneut als vermeintlich „große Anti-Establishment-Partei“ zu inszenieren. Auch wenn bei dem Votum nicht mehr herauskommen wird als heiße Luft. Ein „durchschaubares Spiel“ nannte das SPD-Fraktionschef Lutz Liebscher. Aber leider eines mit Wirkung. Denn auch Symbolpolitik kann die Grenzen des Sagbaren verschieben und uns dem Abgrund der Demokratiefeindlichkeit immer näher bringen.
Zur Erinnerung: Die Thüringer Landesverband der AfD wird vom Verfassungsschutz als „erwiesen rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung“ beobachtet. Die Gründe dafür müssen hier nicht noch einmal im Einzelnen aufgeführt werden und finden sich im derzeit noch aktuellen Verfassungsschutzbericht 2024 für den Freistaat Thüringen.
Unsere Demokratie trägt den Schaden
Es ist paradox: Das Misstrauensvotum wurde in Deutschland als parlamentarisches Instrument eigentlich eingeführt, um die Demokratie zu stabilisieren. Verhältnisse wie damals in der Weimarer Republik sollten mit dem Zwang einer Nachfolgerwahl verhindert werden. Nach dem Vorbild des Grundgesetzartikels 67 wurde die Möglichkeit eines konstruktiven Misstrauensvotums auch in die Thüringer Verfassung aufgenommen. Zum Einsatz kam es – wie bereits erwähnt – nur ein einziges Mal im Juli 2021 ebenfalls auf Antrag der AfD.
Am Mittwoch wird dieses Instrument nun erneut zur politischen Farce. Und die AfD – und ihr Fraktionsvorsitzender Björn Höcke – dominieren wieder einmal die Schlagzeilen. Damit hat die Rechtsaußen-Partei ihr Ziel bereits erreicht. Und den Schaden trägt am Ende unsere Demokratie.
Eine Frage bleibt: Wie geht man mit einem Partei-Landesverband um, der mit allen Mitteln der Demokratie versucht, sie aus ihren Angeln zu heben? Mir fällt auf diese Frage nur eine Antwort ein. Endlich den Antrag auf ein Verbotsverfahren einzureichen. Auch wenn das mit Risiken verbunden ist. Wir können und sollten aber nicht weiter zusehen, wie die AfD unsere Demokratie mit Füßen tritt.
https://www.thueringen24.de/
Rechtsextreme im Parlament
Wie die AfD im Bundestag Angst verbreitet
27.12.2025, 19.39 Uhr
Die AfD tritt im Parlament immer selbstbewusster auf. Die Rechtsextremen stören, pöbeln, drohen. Wo einst eine vertrauensvolle Atmosphäre herrschte, wächst ein hässliches Gefühl. Der SPIEGEL-Report.
Von Florian Gathmann, Fabian Hillebrand, Anna Reimann, Christoph Schult und Christoph Winterbach
aus DER SPIEGEL 1/2026
https://www.spiegel.de/
SPD attackiert AfD
SPD-Chefin kritisiert Demokratieverständnis der AfD
10.11.2025, 16:48 Uhr|Lesezeit: 2 Min.
Die SPD-Partei und Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler kritisiert das Demokratie-Verständnis von Damian Lohr (AfD). (Archivbild)
(Foto: Harald Tittel/dpa)
Die rheinland-pfälzische SPD-Chefin entschuldigt sich als Parlamentarierin bei der Polizei. Dabei geht es um eine Aussage des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD.
Mainz (dpa/lrs) - Ein Gesetzentwurf der AfD-Landtagsfraktion für ein Direkte-Demokratiefördergesetz ist nach Ansicht der SPD-Partei- und Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler „an Heuchelei nicht zu überbieten“. Das Gesetz sei vom Parlamentarischen Geschäftsführer Damian Lohr unterschrieben. Dieser sei laut Polizei jedoch kürzlich losgezogen, „um mit AfD-Schergen Menschen bei Bürgerversammlungen einzuschüchtern“, habe einen Platzverweis kassiert und der Polizei in diesem Zusammenhang Lüge vorgeworfen. „Ist die direkte Demokratie der AfD-Fraktion das Recht des Lauteren und des Gröberen?“, fragte Bätzing-Lichtenthäler.
Platzverweis gegen Lohr in Gauersheim
In Gauersheim im Donnersbergkreis war es jüngst zwischen Bürgern und AfD-Anhängern bei einem öffentlichen Treffen zu Zwischenfällen mit gegenseitigen Vorwürfen gekommen. Ortsbürgermeister Reiner Schlesser (parteilos) sagte, die Veranstaltung sei von AfD-Anhängern massiv gestört worden. Es habe Provokationen, Drohungen und Einschüchterungsversuche gegeben. Die AfD wies die Vorwürfe zurück. Lohr hatte dabei einen Platzverweis bekommen.
Dieser sei eine „Willkürmaßnahme“ gewesen und schnell aufgehoben worden, sagte Lohr auf Anfrage. Der Polizist, der den entsprechenden Bericht verfasst habe, habe gelogen. Deshalb habe er schon vor Tagen Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Beamten eingereicht, sagte Lohr.
Diese sei offenbar nicht per Mail, sondern per Post versendet worden und noch nicht angekommen, hieß es am Montagnachmittag beim zuständigen Polizeipräsidium in Mainz.
Die SPD-Partei und Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler kritisiert das Demokratie-Verständnis von Damian Lohr (AfD). (Archivbild)
(Foto: Harald Tittel/dpa)
SPD-Fraktionschefin entschuldigt sich bei der Polizei
Lohr, gewählter Abgeordneter und Teil der AfD-Fraktionsspitze, „attackiert verbal unseren Rechtsstaat und unsere Polizistinnen und Polizisten“, kritisierte die SPD-Chefin. „Da schäme ich mich als Parlamentarierin, dass das aus unseren Reihen unseres Parlaments gesagt wird und dafür entschuldige ich mich bei unserer Polizei.“
Kritik auch aus der Grünen-Fraktion
Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Carl-Bernhard von Heusinger, hält der AfD vor, staatliche Institutionen schlechtzumachen. (Archivbild)
(Foto: Sebastian Gollnow/dpa)
Bätzing-Lichtenthäler stellte fest: Diese AfD klage zugleich gegen das Abgeordnetengesetz, „weil es angeblich ein Anschlag auf die parlamentarische Demokratie und eine Gesinnungsprüfung wäre“. Damit werde gegen ein Gesetz geklagt, „das ausschließt, dass der Landtag erwiesene Extremisten bezahlt“. „Die AfD-Fraktion kann beschäftigen, wen sie will, es geht nur darum, dass wenn Extremisten dabei sein sollten, diese nicht vom Staat bezahlt werden; von dem Staat, den diese Extremisten bekämpfen.“ Der Name AfD komme in dem Gesetz dabei gar nicht vor.
Landtag berät über AfD-Anträge zu Demokratie und Meldestellen
Der Landtag berät an diesem Mittwoch in zweiter Lesung über den AfD-Gesetzentwurf. Im Innenausschuss haben bereits alle anderen Fraktionen eine Ablehnung empfohlen.
Ein anderer AfD-Antrag für das Plenum fordert die Abschaffung von bestehenden Meldestellen gegen Hass und Hetze. „Meinungsfreiheit schützen, Rechtsstaatlichkeit stärken: Keine politisierten Meldestellen und tendenziösen Anti-Extremismus-Netzwerke in Rheinland-Pfalz fördern“, lautet die Überschrift des Antrags.
https://www.sueddeutsche.de/
AfD klagt gegen Polizei Oldenburg: Verhandlung im November
Stand: 23.10.2025 16:18 Uhr
Dem Verwaltungsgericht Oldenburg liegt eine Klage der AfD Niedersachsen gegen die Polizeidirektion Oldenburg vor. Am 17. November wird laut Gericht verhandelt.
Konkret geht es demnach um ein Interview, das Oldenburgs ehemaliger Polizeipräsident Johann Kühme im August 2023 der "Nordwest-Zeitung" gegeben hat. Darin sprach er unter anderem davon, die AfD täusche die Bürger "bewusst und perfide mit ihrem Lügenkonstrukt" - und werde damit "zur Gefahr für die Innere Sicherheit." Die Partei warf Kühme daraufhin vor, mit den Äußerungen das Mäßigungsgebot und das Neutralitätsgebot missachtet zu haben.
Elf Jahre an der Spitze der Polizeidirektion Oldenburg
Das Gesetz verlangt von Beamten politische Neutralität, aber auch das Einstehen für demokratische Werte - es geht also bei Kühme um den juristischen Einzelfall. Seit März 2024 befindet er sich nach 46 Dienstjahren im Ruhestand. Knapp elf Jahre war er in Oldenburg als Polizeipräsident tätig. Seine Nachfolge trat Andreas Sagehorn an.
Oberstaatsanwalt Thomas Sander (l-r), Polizeipräsident Johann Kühme und Kriminaloberrat Arne Schmidt in Oldenburg.
AfD gegen Polizeipräsident Kühme: Das Warten auf ein Urteil
Kühme hatte der AfD Manipulation von Menschen vorgeworfen. Die Partei klagte vor dem Verwaltungsgericht gegen ihn.
Johann Kühme, Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, blickt in die Kamera.
Beamter mit Haltung: Polizeipräsident Kühme geht in Pension
Polizist, Demokrat, Staatsbürger: Oldenburgs Polizeichef Johann Kühme war immer alles - und deshalb gegen politische Extreme.
Daniela Behrens, Innenministerin von Niedersachsen, steht mit Johann Kühme, Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, in einer Notrufzentrale.
Polizeipräsident Kühme bleibt bis Ende der Dienstzeit im Amt
Darum hatte Innenministerin Behrens den Oldenburger Polizeipräsidenten gebeten. Er hatte die AfD mit Kritik gegen sich aufgebracht.
https://www.ndr.de/
Thüringen
AfD kassiert Niederlage im Streit um erste Landtagssitzung
03.09.2025, 11:59 Uhr
In der chaotischen Sitzung hatte das Verfassungsgericht gegen den AfD-Alterspräsidenten entschieden. Der wollte Ermittlungen gegen die zuständigen Richter. Nun gibt es eine Entscheidung.
Erfurt (dpa/th) - Im juristischen Streit um die chaotisch verlaufende konstituierende Landtagssitzung vor knapp einem Jahr in Thüringen hat die AfD eine weitere Niederlage erlitten. Das Oberlandesgericht (OLG) entschied, dass die Staatsanwaltschaft Erfurt kein Ermittlungsverfahren gegen zwei Verfassungsrichter einleiten muss, wie eine Sprecherin mitteilte. Ein entsprechender Antrag des AfD-Abgeordneten Jürgen Treutler sei als nicht ausreichend begründet zurückgewiesen worden.
Damit seien eigentlich alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft, sagte die Sprecherin. Theoretisch möglich sei noch eine Verfassungsbeschwerde.
Unter anderem die CDU-Landtagsfraktion hatte im Zuge der chaotisch verlaufenden konstituierenden Landtagssitzung Ende September 2024 den Verfassungsgerichtshof angerufen. Die Richter hatten daraufhin entschieden, dass sich AfD-Alterspräsident Jürgen Treutler an die Tagesordnung halten muss. Die AfD warf zwei Richtern danach Rechtsbeugung vor. Einer davon ist der Vater eines CDU-Landtagsabgeordneten.
AfD: Gericht hat sich vor der Entscheidung gedrückt
Der justizpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Sascha Schlösser, warf dem Gericht vor, sich vor einer Entscheidung in der Sache gedrückt zu haben. "Wenn sich ein CDU-Verfassungsrichter in einem Verfahren beteiligt, das unmittelbar die Rechte seines eigenen Sohnes betrifft, dann ist die Rechtslage eindeutig und der Ausschluss vom Richteramt zwingend." Dass das OLG diese Konstellation nicht aufklären wolle, sei "unklug und gefährlich".
Treutler hatte nach OLG-Angaben zunächst Strafanzeige gegen die beiden Richter gestellt. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hatte die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens jedoch abgelehnt. Eine Beschwerde dagegen vor der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft hatte auch keinen Erfolg. Vor dem OLG sollte nun die Aufnahme von Ermittlungen erzwungen werden.
Quelle: dpa
https://www.n-tv.de/
Thüringen
AfD-Beschwerde gegen Thüringer Landtagsdirektor
28.08.2025, 15:57 Uhr
(Foto: Bodo Schackow/dpa)
Die AfD-Fraktion sieht ein Oppositionsrecht im Landtag beschnitten. Verantwortlich macht sie dafür den Landtagsdirektor - und reicht eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein.
Erfurt (dpa/th) - Die AfD-Fraktion hat wie angekündigt eine Fach- und Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landtagsdirektor Jörg Hopfe eingereicht. Das teilte die Fraktion in Erfurt mit. Sie wirft dem Juristen vor, er habe Oppositionsrechte der AfD in Untersuchungsausschüssen beschnitten. Die Landtagsverwaltung hatte das bereits zurückgewiesen.
Der AfD-Abgeordnete Sascha Schlösser warf dem Landtagsdirektor vor, er habe Informationen zur Rechtslage bei Beweisanträgen in Untersuchungsausschüssen unterlassen. Dadurch seien in der Vergangenheit AfD-Anträge von einer Mehrheit im Ausschuss abgelehnt worden. Zudem habe seine Fraktion "schwerwiegende Zweifel an der politischen Neutralität Hopfes". Die AfD-Fraktion fordere eine dienstrechtliche Ahndung der aus ihrer Sicht vorliegenden Verstöße und die Einleitung eines Disziplinarverfahrens.
Schlösser erklärte: "Ein Landtagsdirektor hat neutral und gesetzestreu zu agieren. Wenn zentrale Kommissionsentscheidungen, die der Rechtsdurchsetzung einer qualifizierten Minderheit dienen, durch ihn systematisch verschwiegen werden, ist das kein Versehen, sondern gezielte Rechtsverweigerung."
Die AfD ist neben der Linken eine von zwei Oppositionsfraktionen im Thüringer Parlament. Konkret geht es der AfD um das Recht auf Beweiserhebung, das als Minderheitsrecht die parlamentarische Aufklärungsarbeit durch die Opposition in einem Untersuchungsausschuss sicherstellen soll.
Die AfD-Fraktion beruft sich in ihrer Argumentation auf einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts. Es handele sich laut Landtagsverwaltung jedoch nicht um eine Gerichtsentscheidung, sondern um eine gutachterliche Stellungnahme einer Kommission, die bereits seit Jahren vorliege. Sie habe keine rechtliche Bindung, argumentiert die Verwaltung.
Quelle: dpa
https://www.n-tv.de/
Rathauschefin Steinruck: "Man ist vorsichtiger"
OB-Wahl in Ludwigshafen: Hassmails und Polizeischutz nach AfD-Ausschluss
22.08.2025, 8:16 Uhr
Der Ausschluss des AfD-Politikers Joachim Paul von der OB-Wahl Ludwigshafen hat eine Welle von Anfeindungen ausgelöst. Die amtierende Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck bekommt jetzt Polizeischutz.
Der Wahlausschuss in Ludwigshafen hatte Anfang August mit Mehrheit beschlossen, wegen Zweifeln an der Verfassungstreue, den AfD-Kandidaten Paul nicht als Kandidaten für die Abstimmung am 21. September zuzulassen. Auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) gehört dem Wahlausschuss an. "Mit dem Wahlausschluss hat eine Flut an Hassmails und Drohungen begonnen", sagte Steinruck der Deutschen Presse-Agentur. "Die Drohungen haben wir an Polizei und Staatsanwaltschaft weitergegeben, alles Weitere ist jetzt auf dem Weg." Sie sei nicht panisch. "Aber man ist vorsichtiger. Man schaut genauer hin." Die Politikerin bekommt jetzt bei ausgewählten öffentlichen Terminen und Veranstaltungen Polizeischutz, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte. Das hatten das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) und das Polizeipräsidium mit Sitz in Ludwigshafen wegen der Bedrohungslage entschieden. Um welche Art von Drohungen es sich handelt, hat die Polizei nicht bekanntgegeben.
Joachim Paul, AfD, Landtagsabgeordneter RLP
Verfassungstreue wird angezweifelt
Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen: AfD-Kandidat darf nicht antreten
Mittlerweile seien die E-Mails so umgestellt, dass die Nachrichten sie nicht mehr persönlich erreichten, sagte die Politikerin, die bei der Wahl nicht mehr antritt.
Polizei ermittelt wegen Anfeindung nach Wahlausschluss von AfD-Kandidat Paul
00:0000:38
OB Steinruck: "Haltung zeigen"
Sie wisse, dass auch andere Mitglieder des Wahlausschusses Anfeindungen ausgesetzt seien. "Es gab Beratungsgespräche mit der Polizei." Sie sehe die Anfeindungen auch in einer Reihe von Aggressionen gegen Mandatsträger allgemein, betonte Steinruck. "Ich bin nicht die Einzige, die dem ausgesetzt ist. Da geht es aber auch darum, Haltung zu zeigen."
Jutta Steinruck (parteilos), Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen
Polizei steht in engem Austausch mit den Betroffenen
Das Polizeipräsidium Rheinpfalz bestätigte die Nachrichten. "Im Zusammenhang mit der Nichtzulassung des Kandidaten Joachim Paul zur Oberbürgermeisterwahl ermittelt die Kriminalpolizei Ludwigshafen wegen Beleidigung und Bedrohung", teilte ein Sprecher mit. In mehreren Nachrichten würden die Mitglieder des Wahlausschusses überwiegend beleidigt und in Einzelfällen bedroht. Die Polizei treffe alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Personen. "Hierzu gehört beispielsweise eine fortlaufende Gefährdungsanalyse des Landeskriminalamtes."
Aus der Bewertung würden sich nach derzeitigem Stand keine konkreten Gefahren für die Betroffenen ergeben. Nichtsdestotrotz stehe die Polizei in engem Austausch mit den Betroffenen. Ihnen sei Beratung angeboten worden. "Darüber hinaus stimmen wir uns insbesondere bei öffentlichen Terminen der Oberbürgermeisterin eng mit der Stadt ab." Von den Drohungen hatten zuvor "Die Rheinpfalz" und "Mannheimer Morgen" berichtet.
Kolja Schwartz aus der ARD Rechtsredaktion in Karlsruhe
Gespräch mit Kolja Schwartz aus der SWR-Rechtsredaktion
FAQ: Wie geht’s weiter bei der OB-Wahl in Ludwigshafen?
Landtagspräsident Hering: "Diese Straftaten bedrohen Demokratie"
Landtagspräsident Hendrik Hering hatte sich erschüttert gezeigt. Er stelle sich hinter die Mitglieder des Wahlausschusses, teilte der SPD-Politiker in Mainz mit. Unabhängig davon, ob Paul zur Wahl zugelassen werde oder nicht, dürften Gremien niemals durch Drohungen unter Druck gesetzt werden.
"Diese Straftaten bedrohen die Demokratie. Politikerinnen und Politiker müssen angstfrei entscheiden können. Ansonsten ist unsere Demokratie im Kern gefährdet", hatte Hering betont. "Wer soll sich bei solchen Vorkommnissen, die leider auch andernorts geschehen, denn künftig noch politisch engagieren?"
Beschwerde beim OVG
Unterdessen legte Paul beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts in Neustadt an der Weinstraße ein. Dort war Paul am Montag mit einem Eilantrag gegen seinen Ausschluss von der Wahl gescheitert. "Die Beschwerde enthielt noch keine Begründung", teilte ein OVG-Sprecher in Koblenz mit.
AfD-Politiker Joachim Paul will Oberbürgermeister in Ludwigshafen werden. Er legt nun Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein gegen seinen Ausschluss von der Wahl.
Politiker darf nicht an OB-Wahl in Ludwigshafen teilnehmen
AfD-Kandidat legt Beschwerde bei Oberverwaltungsgericht ein
Sendung vom
Mi., 20.8.2025 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4
https://www.swr.de/
Stuttgart
AfD-Landtagsfraktion scheitert mit Klage gegen Richterwahl
red/afp 13.08.2025 - 15:48 Uhr
Stuttgart: AfD-Landtagsfraktion scheitert mit Klage gegen Richterwahl
Die AfD-Fraktion in Baden-Württemberg ist vor dem Verfassungsgerichtshof in Stuttgart mit einer Klage gegen die Nachwahl eines Richters gescheitert. (Symbolbild) Foto: Carsten Koall/dpa/Carsten Koall
Die AfD-Fraktion scheitert vor dem Verfassungsgerichtshof mit ihrer Klage gegen die Nachwahl eines Richters. Der Posten wurde nach dem Tod ihrer Kandidatin neu besetzt.
Link kopiert
Die Landtagsfraktion der AfD in Baden-Württemberg ist vor dem Verfassungsgerichtshof in Stuttgart mit einer Klage gegen die Nachwahl eines Richters gescheitert. Ihr steht kein alleiniges Vorschlags- und Benennungsrecht zu, das die Freiheit der Wahl durch den Landtag einschränken könnte, wie der Gerichtshof in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil entschied. Der Posten musste nachbesetzt werden, nachdem eine von der AfD vorgeschlagene und vom Landtag gewählte Laienrichterin gestorben war. (Az. 1 GR 105/24)
Der Verfassungsgerichtshof hat die Aufgabe, die Landesverfassung auszulegen und über ihre Einhaltung zu wachen. Sowohl Landtag, Landesregierung und Fraktionen wie auch Bürgerinnen und Bürger können sich an ihn wenden. Er besteht aus neun Mitgliedern, die ehrenamtlich arbeiten und vom Landtag für je neun Jahre gewählt werden.
Unsere Empfehlung für Sie
AfD-Umfragen: Erstmals spürbar vor CDU
SonntagsfrageAfD in neuer Umfrage vor CDU
Wenn eine Richterin oder ein Richter vorzeitig ausscheiden, wird für den Rest der Amtszeit ein Nachfolger gewählt. Drei Mitglieder des Gerichtshofs sind Berufsrichter, drei weitere müssen zumindest die Befähigung zum Richteramt haben. Die drei übrigen Mitglieder müssen das nicht.
Vorgeschlagene Kandidatin verstarb im Januar 2024
Die AfD-Fraktion schlug 2018 die Unternehmensberaterin Sabine Reger vor. Sie wurde gewählt, starb aber im Januar 2024. Im Mai 2024 wurde der Unternehmer Rami Suliman gewählt, der Vorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden und langjähriges Mitglied im Direktorium des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Ihn hatten die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP vorgeschlagen. Ein Vorschlag der AfD-Fraktion fand dagegen keine Mehrheit. Sie sah ihr Vorschlags- und Benennungsrecht verletzt und wandte sich mit einem Organstreitverfahren an den Gerichtshof.
Dort hatte sie aber nun keinen Erfolg. Der Gerichtshof erklärte, dass es ein solches alleiniges Vorschlags- und Benennungsrecht nicht gebe. Das Recht dazu, dem Landtag Wahlvorschläge zu machen, sei weder in der Landesverfassung noch in der Geschäftsordnung des Landesparlaments ausdrücklich geregelt. In der Praxis machten einzelne Fraktionen oder mehrere zusammen Vorschläge.
Die Landesverfassung übertrage dem Landtag die Aufgabe, den Gerichtshof zu besetzen. Die Freiheit der Wahl stärke sogar die demokratische Legitimation einer Personalentscheidung, erklärte der Gerichtshof. Der Antrag der AfD-Fraktion wurde zurückgewiesen.
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/
Das Bundesverfassungsgericht nimmt eine AFD-Klage gegen die frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nicht zur Entscheidung an
Nachrichten aus aller Welt ·
Manfred Schulz
24.07.2025
Das Bundesverfassungsgericht nimmt eine Klage gegen die frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nicht zur Entscheidung an. Der AfD-Landesverband hatte sich damit gegen ein Urteil des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshofs in Koblenz wehren wollen.
Konkret ging es dabei um Aussagen, die Ex-Ministerpräsidentin Dreyer im Januar 2024 unter anderem auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal veröffentlicht hatte. Dort hieß es etwa: »Der Begriff ›Remigration‹ verschleiert, was die AfD und andere rechtsextreme Verfassungsfeinde vorhaben.« Gegenstand des Rechtsstreits war auch ein Aufruf zu einer Demonstration unter dem Titel »Zeichen gegen rechts«, bei der auch die AfD genannt wurde.
Die Landes- und Bundespartei der AfD hatten Dreyer und der Landesregierung wegen dieser Äußerungen eine Verletzung des Neutralitätsgebots vorgeworfen. Danach dürfen Staatsorgane nicht zugunsten oder zulasten einer politischen Partei – sofern sie nicht verboten ist – auf den Parteienwettbewerb einwirken.
Schon in Koblenz konnte sich die AfD damit vor Gericht nicht durchsetzen. Die beklagten Aussagen griffen zwar in das Recht auf Chancengleichheit der Partei ein, entschied der Verfassungsgerichtshof im April. Der Eingriff sei aber zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerechtfertigt.
Gegen dieses Urteil wandte sich die AfD ans Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Sie kritisierte, die Koblenzer Einschätzung weiche von der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ab – und forderte eine Überprüfung des Urteils.
Das Gericht erklärte die Verfassungsbeschwerde jedoch für unzulässig. Die AfD habe eine Verletzung eines in diesem Rahmen rügefähigen Rechts nicht ausreichend dargelegt, hieß es zur Begründung. #MaluDreyer
OMAS GEGEN RECHTS in Deutschland
https://www.facebook.com/groups/145479739453585
Thüringen
Landesregierung verklagt AfD-Fraktion wegen Falschbehauptungen
Die Landesregierung in Thüringen hat beim Verwaltungsgericht Weimar Klage gegen die AfD-Landtagsfraktion eingereicht.
16.07.2025
Ein Schild zeigt das Wappen des Landes Thüringen. Daneben steht "Thüringer Landtag".
Der Thüringer Landtag verklagt AfD-Fraktion. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)
Anlass sei eine Reihe objektiv falscher Behauptungen, die in der Mai-Ausgabe der AfD-Fraktionszeitung zur Umsetzung des 100-Tage-Programms der Landesregierung aufgestellt worden seien, teilte die Staatskanzlei in Erfurt mit. Eine zuvor von der Landesregierung übersandte Unterlassungserklärung habe die AfD-Fraktion nicht unterzeichnet.
Der Chef der Thüringer Staatskanzlei, Gruhner, sagte, die Klage habe zum Ziel, ein klares Zeichen für die Bedeutung von Wahrheit und Verantwortung in der politischen Debatte zu setzen.
Die Zeitung der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag „Blauer Mut“ erscheint bis zu dreimal jährlich mit einer Auflage von 650.000 Stück. Sie wird an Thüringer Haushalte verteilt und ist auch online abrufbar.
Diese Nachricht wurde am 16.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
https://www.deutschlandfunk.de/
Vorwurf Falschbehauptungen: Land verklagt AfD-Fraktion
16.07.2025
Stand: 14:55 UhrLesedauer: 2 Minuten
Thüringens Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU) wirft der AfD-Fraktion Falschbehauptungen zur Arbeit der Landesregierung vor. (Archivbild)
Quelle: Jan Woitas/dpa
Die Brombeer-Landesregierung wirft der oppositionellen AfD-Fraktion etliche Falschbehauptungen vor. Eine Unterlassungserklärung unterzeichnete die AfD von Björn Höcke nicht. Nun gibt es eine Klage.
Die Thüringer Landesregierung wirft der AfD-Fraktion eine Reihe falscher Behauptungen vor und geht dagegen juristisch vor. Eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Weimar bestätigte den Eingang einer entsprechenden Klage. In einer Mittelung dazu erklärte Thüringens Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU): «Wir haben diese Klage nicht leichtfertig eingereicht. Aber wir können es nicht hinnehmen, dass durch bewusst falsche Tatsachenbehauptungen das Vertrauen in staatliches Handeln untergraben wird.»
Die Aussagen der AfD, um die es gehe, seien objektiv widerlegbar und keine Meinungsäußerungen. «Wer die Wahrheit verdreht, schadet nicht nur der politischen Kultur, sondern auch dem gesellschaftlichen Klima in unserem Land», so Gruhner. Er warf der AfD vor, den politischen Diskurs im Land zu vergiften.
Unterlassungserklärung nicht unterzeichnet
Die Thüringer AfD-Fraktion warf Gruhner dagegen vor, er wolle die Opposition im Freistaat Thüringen zum Schweigen bringen, «indem er sie mit haltlosen Klagen überzieht». Die parlamentarische Demokratie lebe vom freien Meinungsaustausch. «Wer die Opposition kriminalisiert, anstatt gute Politik fürs Land abzuliefern, hat nicht die Größe für das Amt des Staatskanzleichefs», erklärte AfD-Fraktionsvize Daniel Haseloff.
Gruhner argumentierte, dass die Meinungsfreiheit den freien Diskurs schütze, nicht aber die Verbreitung objektiv widerlegbarer Falschbehauptungen.
Nach Angaben der Staatskanzlei geht es um Behauptungen in der AfD-Fraktionszeitung, dass mehrere zentrale Vorhaben des 100-Tage-Programms der Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD nicht umgesetzt worden seien. Diese Aussagen seien nachweislich falsch. Eine Unterlassungserklärung sei nicht unterzeichnet worden, weshalb nun Klage eingereicht wurde.
In Thüringen regiert ein Bündnis aus CDU, BSW und SPD in Deutschlands einziger Brombeer-Koalition. Die Linke und die AfD sind in der Opposition.
dpa-infocom GmbH
https://www.welt.de/
Vorfall im Bundestag
AfD-Sicherheitsmänner stellen Fotografen zur Rede – Weidel bittet um Entschuldigung
16.07.2025
Stand: 11:21 UhrLesedauer: 2 Minuten
Alice Weidel, co-leader of the far-right party Alternative for Germany (AfD), sits at the plenary hall as the Bundestag, Germany’s lower house of parliament, is set to vote on three judicial appointments to the Federal Constitutional Court, requiring a two-thirds majority, in Berlin, Germany, July 11, 2025. REUTERS/Nadja Wohlleben
AfD-Vorsitzende Alice Weidel während der Bundestagssitzung am Donnerstag
Quelle: REUTERS/Nadja Wohlleben
Ein freier Fotograf der „FAZ“ schießt am Donnerstag von der Pressetribüne im Bundestag ausgiebig Fotos von Alice Weidel. Das missfällt zwei Mitarbeitern der AfD-Vorsitzenden. Nach der Konfrontation entschuldigt sich Weidel nun.
Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel hat nach einer Konfrontation ihrer Sicherheitsmitarbeiter mit einem Pressefotografen um Entschuldigung gebeten. Der für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ tätige freie Fotograf war am Donnerstag vor der Pressetribüne des Bundestages von Mitarbeitern der AfD-Chefin zur Rede gestellt worden, nachdem er diese von dort aus fotografiert hatte.
Weidels Sprecher versicherte auf Nachfrage der „FAZ“ nun, der ordnungsgemäß akkreditierte Fotograf habe „in der Ausübung seiner Tätigkeit“ nicht durch ihre Mitarbeiter behindert werden sollen. Der Fotograf sei während der Plenarsitzung aufgefallen, weil er „über einen ungewöhnlich langen Zeitraum hinweg Fotos von Frau Weidel anfertigte“.
Das geschah wie üblich von den Presse- und Besuchertribünen des Plenarsaals aus. „Die Sicherheitsmitarbeiter von Frau Weidel wollten aus diesem Grund in Erfahrung bringen, von welchem Medium er beauftragt wurde“, teilte Weidels Sprecher mit.
Lesen Sie auch
dpatopbilder - 11.07.2025, Berlin: Teile der Fraktion der Partei Die Linke und der SPD drehen dem Redner Martin Sichert von der AfD im Plenum des Bundestags bei der Debatte zum 30. Jahrestag des Völkermords von Srebrenica den Rücken zu. Foto: Niklas Treppner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
Ressort:Deutschland
Bundestag
AfD löst bei Völkermord-Debatte Eklat aus – Außenminister tritt ungeplant ans Rednerpult
Der „FAZ“ zufolge stellten zwei Männer den Fotografen zur Rede, obwohl im Bundestag akkreditierte Fotografen Abgeordneten und deren Mitarbeitern keine Rechenschaft für ihre Tätigkeit schulden. Die zwei Männer stellten sich dem Fotografen als Mitarbeiter aus Weidels Büro vor und fragten ihn, wer er sei und warum er so viele Fotos von Weidel mache. Der Fotograf erklärte demnach seine Tätigkeit.
Anzeige
Wie die „FAZ“ berichtet, soll einer der Mitarbeiter versucht haben, Fotos oder Videoaufnahmen von dem Fotografen zu machen. Dies habe er auf dessen Nachfrage jedoch bestritten. Der andere Mitarbeiter habe gefragt, ob er ein Bild vom Bundestagsausweis des Fotografen machen könne.
Weidels Sprecher teilte dazu mit, „zu keiner Zeit“ habe die Absicht bestanden, den Fotografen in der Ausübung seiner Tätigkeit zu behindern. „Sollte fälschlicherweise dieser Eindruck entstanden sein, bedauern wir dies außerordentlich und bitten um Entschuldigung.“ Der Fotograf hat sich nach eigener Aussage in der Ausübung seiner Arbeit bedroht gefühlt.
Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) sagte der „FAZ“: „Der Vorgang ist inakzeptabel. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut. Wir weisen jede Form von Einschüchterung eindeutig zurück. Der Vorfall muss aufgeklärt werden.“ Die Bundestagsverwaltung bestätigte, ein Bundestagspolizist habe Weidels Mitarbeiter nach der Beschwerde des Fotografen darauf hingewiesen, dass dieser alle Regeln eingehalten habe und seine Arbeit fortsetzen könne.
saha
https://www.welt.de/
Zwischenfall im Bundestag: Weidels Sicherheitsmitarbeiter bedrängten offenbar Fotografen der „FAZ“
Ein Fotograf der „FAZ“ beklagt, im Bundestag von zwei Sicherheitsleuten der AfD-Chefin bedrängt worden zu sein. Die AfD lässt verlauten, es habe keine Absicht bestanden, ihn in seiner Arbeit zu behindern.
15.07.2025, 18:29 Uhr
Ein von der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ beauftragter Fotograf ist einem Bericht nach im Bundestag von Sicherheitsmitarbeitern der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel bedrängt worden. Die zwei Mitarbeiter hätten den Mann vor der Pressetribüne zur Rede gestellt, meldete die „FAZ“ am Dienstag.
Der Mann soll ihnen aufgefallen sein, weil er „über einen ungewöhnlich langen Zeitraum hinweg Fotos von Frau Weidel anfertigte“, sagte Weidels Sprecher der Zeitung.
Dabei müssen sich akkreditierte Fotografen im Bundestag weder vor Abgeordneten noch deren Mitarbeitern rechtfertigen. Weidel ließ über ihren Sprecher verlauten, dass „zu keiner Zeit“ die Absicht bestanden habe, den Fotografen in der Ausübung seiner Tätigkeit zu behindern. „Sollte fälschlicherweise dieser Eindruck entstanden sein, bedauern wir dies außerordentlich und bitten um Entschuldigung.“
Der Fotograf sagte demnach, er habe sich bedroht gefühlt. Einer der Mitarbeiter Weidels habe Fotos von ihm zu machen versucht, diese Absicht auf Nachfrage des Fotografen aber bestritten. Der andere Mitarbeiter Weidels habe gefragt, ob er den Bundestagsausweis abfotografieren könne.
Staatsdienst in Rheinland-Pfalz Nun doch kein grundsätzliches Einstellungsverbot für AfD-Mitglieder
Die umstrittene Strategie der Rechten Die AfD will gemäßigter auftreten und schimpft dann über den „Lügenkanzler“
Eklat bei Debatte über Srebrenica AfD stellt Völkermord infrage – und zieht Parallelen zu Deutschland
Laut „FAZ“ war der Mann ordnungsgemäß akkreditiert. Die Bundestagsverwaltung habe bestätigt, dass ein Bundestagspolizist Weidels Mitarbeiter auf die Beschwerde des Fotografen hin darauf hingewiesen habe, dass der Mann alle Regeln eingehalten habe. (Tsp)
https://www.tagesspiegel.de/
AFD-seitige Diffamierung der Befürworter eines AFD-Parteiverbotsverfahrens als Nazis
Thüringen: Warum die AfD-Blockade Richter nicht verhindern kann
von Gastbeitrag | 23.06.2025 | Aktuelles
Dieser Gastbeitrag erschien zuerst bei Verfassungsblog.de und wurde von Julia Nebel, Robert Kaliner und Jonathan Schramm verfasst. Überschriften teilweise ergänzt durch Volksverpetzer.
Mit ihrer Sperrminorität blockiert die Thüringer AfD-Fraktion die Neubesetzung des Richterwahlausschusses. Im Gegenzug für die Mitwahl der Kandidat:innen anderer Parteien fordert die AfD-Fraktion nun das bereits besetzte Amt des Landtagspräsidenten und Sitze in der G10-Kommission sowie der Parlamentarischen Kontrollkommission, die u.a. für die Kontrolle des Landesamtes für Verfassungsschutz zuständig ist, das die AfD als gesichert rechtsextremistisch beobachtet. Aber existiert ihr Druckmittel überhaupt? Muss der Richterwahlausschuss tatsächlich erst neu besetzt oder sonst eine Übergangsregelung geschaffen werden (siehe dazu Wittreck/Talg), bevor neue Richter:innen ernannt werden können? Die Vorschriften des DRiG eröffnen einen Ausweg. Denn danach ist eine aktive Zustimmung des Richterwahlausschusses gar nicht zwingend erforderlich, um Richter:innen rechtmäßig auf Lebenszeit zu ernennen.
Thüringens Richterwahlausschuss heute
In Thüringen bildet der Landtag gemeinsam mit den Vertreter:innen der Richterschaft im Landesdienst gemäß Art. 89 Abs. 2 VerfTH i.V.m. §§ 50 ff. ThürRiStAG einen Richterwahlausschuss. Das Gremium setzt sich in Thüringen gemäß § 51 Nr. 1 ThürRiStAG aus fünf richterlichen Mitgliedern und zehn Abgeordneten des Landtages zusammen. Die parlamentarischen Mitglieder des Gremiums wählt der Landtag gemäß § 52 Abs. 1 ThürRiStAG zu Beginn jeder Wahlperiode mit Zweidrittelmehrheit. Beschlussfähig ist der Richterwahlausschuss gemäß § 60 Abs. 1 ThürRiStAG, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Gegenwärtig ist der Richterwahlausschuss mit Abgeordneten und deren Stellvertreter:innen besetzt, die der Landtag in der vergangenen Legislatur wählte. Der Richterwahlausschuss sei nach Auffassung des Justizministeriums deshalb – auf Grundlage eines aktuellen Rechtsgutachtens des Jenaer Juraprofessors Dr. Michael Brenner – weiterhin handlungsfähig und könne Ernennungsentscheidungen treffen.
Die bisherige Debatte legte nahe, dass die Handlungsfähigkeit des Richterwahlausschusses maßgeblich dafür sei, ob die Justizministerin anstehende Ernennungen auf Lebenszeit überhaupt umsetzen kann und sie so lange auf Eis legen muss, bis die Handlungsfähigkeit des Gremiums hergestellt ist. Diese Ansicht hätte zur Folge, dass die Ernennungsverfahren ins Stocken gerieten, während offene Stellen an Richter:innen auf Lebenszeit in der Justiz zunehmend zu organisatorischen Problemen führten, weil nicht mehr als eine Proberichter:in an Entscheidungen der Gerichte mitwirken darf ( § 29 Abs. 1 DRiG).
Nicht mehr als ein Vetorecht
Einige Länder haben sich ganz grundsätzlich dagegen entschieden, einen Richterwahlausschuss einzurichten. Ihre Justizminister:innen können Richter:innen von vornherein eigenständig und ohne Beteiligung des Landtages ernennen. Doch selbst wenn sich ein Land wie Thüringen dafür entschieden hat, einen Richterwahlausschuss zu beteiligen, ist dessen Zustimmung nicht konstitutiv, um Richter:innen auf Lebenszeit zu ernennen. Vielmehr ist der Richterwahlausschuss allein Vertretungsorgan eines parlamentarischen Vetorechts.
An zentraler Stelle bestimmt § 12 Abs. 2 S. 1 DRiG, dass ein Richter auf Probe spätestens fünf Jahre nach seiner Ernennung zum Richter auf Lebenszeit zu ernennen ist. Das Gesetz spricht jeder Richter:in auf Probe mit Ablauf von fünf Jahren einen Anspruch auf Lebenszeiternennung zu (Staats, Deutsches Richtergesetz, 2012, § 12 Rn. 2.). Ob ein Richterwahlausschuss der Ernennung zugestimmt hat oder ob die betreffende Personalie in dem Gremium überhaupt besprochen wurde, spielt dafür keine Rolle.
Ein weiteres Argument für diese Ansicht – quasi als andere Seite der Medaille – lässt sich auf die Vorschrift stützen, welche die Entlassung der Richter:in auf Probe regelt: Will sich die Justiz von einer Richter:in auf Probe trennen, kann sie die Richter:in nur bis zum 24. Monat nach ihrer Ernennung „einfach so“ entlassen (§ 22 Abs. 1 DRiG).
nach 24 Monaten Probezeit erhöhen sich die anforderungen schlagartig
Davon abgesehen erhöhen sich die Anforderungen an eine Entlassung nach 24 Monaten Probezeit schlagartig. Nun kann eine Richter:in auf Probe nur noch zum Ablauf des dritten oder vierten Jahres entlassen werden und auch nur dann, wenn sie entweder „für das Richteramt nicht geeignet ist“ (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 DRiG) oder „wenn ein Richterwahlausschuss seine Übernahme in das Richterverhältnis auf Lebenszeit oder auf Zeit ablehnt“ (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 DRiG).
Erst hier kommt der Richterwahlausschuss ins Spiel. Seine ablehnende Entscheidung gibt dem Justizministerium einen weiteren, neuen Entlassungsgrund an die Hand (§ 62 Abs. 2 ThürRiStAG). Zumindest das Deutsche Richtergesetz bindet die Justizminister:in ausweislich seines Wortlauts („kann […] entlassen werden“) jedoch nicht einmal an die Entscheidung des Gremiums, sondern erweitert allein den Handlungsspielraum des Justizministeriums.
Statt eines Vetorechtes stünde dem Richterwahlausschuss dann – geht man, was naheliegend ist, in diesen Fällen nicht regelmäßig von einer Ermessensreduzierung auf Null aus – sogar nur ein Einspruchs- statt Vetorecht zu. Im Übrigen ist auch sonst an keiner Stelle ersichtlich, dass der Richterwahlausschuss einer Lebenszeiternennung zustimmen muss.
Anders ausgedrückt: Mit Ernennung einer Person zur Richter:in auf Probe setzt ein Automatismus ein. Sofern niemand die Richter:in auf Probe innerhalb von fünf Jahren seit ihrer Ernennung entlässt, erwirbt sie einen (fast uneingeschränkten, § 22 Abs. 3 DRiG) Anspruch auf die Ernennung zur Richter:in auf Lebenszeit. Entlassen werden kann eine Richter:in auf Probe – außer bei disziplinarrechtlich relevantem Verhalten – nur bis zum Ablauf des vierten Jahres ihrer Ernennung. Die ablehnende Entscheidung eines Richterwahlausschusses ermöglicht der Justizministerin vor Erreichen der Vierjahresgrenze lediglich, die Richter:in zu entlassen, ohne ihre Nichteignung begründen zu müssen.
Bundeseinheitlichkeit des Ernennungsverfahrens – unabhängig von der Einrichtung von Richterwahlausschüssen durch einzelne Länder
Die Rechtsstellung der Richter:innen auf Probe in allen Ländern einheitlich zu regeln, war auch Ansinnen des Rechtsausschusses des Bundestags, als er den Regierungsentwurf des Deutschen Richtergesetzes diskutierte. Der Kabinettsentwurf sah in seiner ursprünglichen Fassung vor, dass die Entscheidung des Richterwahlausschusses in Ländern, die diese Gremien eingerichtet hatten, konstitutiv für die Ernennung sein sollte. („Spätestens sechs Jahre nach seiner Ernennung ist der Richter auf Probe zum Richter auf Lebenszeit zu ernennen oder einem Richterwahlausschuß zur Wahl vorzuschlagen […].“ (§ 11 Abs. 2 des Entwurfs eines Deutschen Richtergesetzes vom 9. Juli 1958, BT-Drs. Nr. 3/516).)
Hiervon wich der Rechtsausschuss bewusst ab, um Wartezeiten mit ungewisser Länge bis zu einer endgültigen Entscheidung durch den Wahlausschuss für die Proberichter:innen zu vermeiden, und entwarf die später vom Bundestag schließlich auch beschlossene Regelung, wonach Proberichter:innen nach Ablauf einer bestimmten Zeit zu Richter:innen auf Lebenszeit zu ernennen sind – unabhängig davon, ob der Richterwahlausschuss sich mit der jeweiligen Richter:in in der Zwischenzeit schon einmal befasst hat: „Wird er zu diesem letzten Zeitpunkt nicht entlassen, hat der Richter auf Probe auch in den Ländern, die einen Richterwahlausschuß an der Anstellung beteiligen, […] einen Anspruch auf Anstellung“. (Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Deutschen Richtergesetzes – Drs. 516 –, BT-Drs. Nr. 3/2785, S. 11.)
Nur scheinbar ein Dilemma
Insoweit lässt sich eine „Lösung“ für die Blockade von Richterernennungen bereits auf Ebene des einfachen Rechts finden. Die Frage nach der aktuellen Legitimation des Richterwahlausschusses – wie in dem oben genannten Rechtsgutachten thematisiert – kann dahinstehen. Nur ein handlungsfähiger, nicht ein handlungsunfähiger Richterwahlausschuss kann Ernennungen verhindern:
Die Lösung dieser nur vermeintlichen „Blockade“ ergibt sich aus dem oben dargelegten Zusammenspiel von § 12 und § 22 DRiG: Nach Ablauf von vier Jahren (§ 22 Abs. 2 DRiG) und spätestens nach fünf Jahren (§ 12 Abs. 2 S. 1 DRiG) hat die jeweilige Richter:in auf Probe einen uneingeschränkten Anspruch auf Lebenszeiternennung (mit Ausnahme des § 22 Abs. 3 DRiG). Diesen Anspruch kann sie klageweise geltend machen, sodass die Justizministerin die Ernennung vornehmen muss – wozu diese jedoch gemäß § 113 Abs. 5 S. 1 VwGO lediglich zu verpflichten, die Handlung indes nicht gerichtlich zu ersetzen ist. Für den Ernennungsakt als solchen ist die Justizministerin gemäß § 62 Abs. 1 ThürRiStAG allein zuständig.
Unerheblich ist nach der hier vertretenen Ansicht also, dass nach Art. 89 Abs. 2 VerfTH (i.V.m. § 62 Abs. 1 ThürRiStAG) keine aktive „Zustimmung“ des Richterwahlausschusses erfolgt ist. Eine „Zustimmung“ im Sinne einer positiv erforderlichen und damit konstitutiven Voraussetzung der Ernennung enthält das DRiG eben nicht. Die Regelung des § 62 Abs. 1 ThürRiStAG ist stattdessen dahingehend zu verstehen, dass die „Zustimmung“ im Rahmen des § 22 Abs. 2 DRiG als Verzicht auf ein dort vorgesehenes „Veto“ gilt. Eine positive Zustimmung des Richterwahlausschusses für die Ernennung auf Lebenszeit ist zu keinem Zeitpunkt erforderlich – erst recht nicht mehr nach dem Ablauf von vier Jahren.
Blockade zulasten des parlamentarischen Einflusses statt der Proberichter:in
Das Vetorecht des Richterwahlausschusses im ThürRiStaG und der Verfassung des Freistaates Thüringen steigert zwar die demokratische Legitimation der Richterernennung. (Siehe zu diesem Aspekt, aber auch zur Prüfung der „demokratischen Zuverlässigkeit“ Dürig/Herzog/Scholz/Hillgruber, 106. EL Oktober 2024, GG Art. 98 Rn. 65.)
Konstitutive Ernennungsvoraussetzung ist die Zustimmung des Gremiums indes wegen des Vorrangs der bundesrechtlichen Regelungen (auch gegenüber der Landesverfassung) nicht. (Auch Art. 98 Abs. 5 S. 2 GG führt zu keiner anderen Betrachtung. Dieser gilt, wie sich aus der inneren Systematik des Abs. 5 ergibt, nur für die Regelungen der Richteranklage.)
Solange der Richterwahlausschuss eine Bewerber:in nicht ablehnt, fehlt es an den Voraussetzungen für eine Entlassung nach § 22 Abs. 2 DRiG und es besteht spiegelbildlich ein Anspruch auf Ernennung nach fünf Jahren Probezeit. Dem steht auch nicht der insoweit offene Wortlaut des Art. 98 Abs. 4 GG entgegen, der von einer gemeinsamen Entscheidung von Justizminister und Richterwahlausschuss spricht. Die Norm statuiert allein eine Kompetenzbestimmung und Garantie für die Länder, „ob“ sie Richterwahlausschüsse schaffen und „wie“ sie ihre Tätigkeit gestalten können. (Vgl. bloß Dreier/Schulze-Fielitz, 3. Aufl. 2018, GG Art. 98 Rn. 42.) Insbesondere soll sie die Länder davor schützen, „dass der Bund […] durch Bundesgesetz das Recht der Länder zur Errichtung von Wahlausschüssen aushebelt“. (Dreier/Schulze-Fielitz, 3. Aufl. 2018, GG Art. 98 Rn. 42.)
Arbeitsunfähigkeit des Gremiums schadet allein seinem eigenen Einfluss
Das DRiG hebelt dieses Recht aber gerade nicht aus, sondern gibt über § 22 DRiG die verfassungsrechtliche Abwägungsentscheidung zwischen Art. 33 Abs. 2 GG und Art. 98 Abs. 4 GG wieder. Die Richterwahlausschüsse können effektiv durch § 22 Abs. 2 Nr. 2 DRiG an der Ernennungsentscheidung mitwirken. Zugleich verhindert das zeitlich befristete Veto- gegenüber dem Blockaderecht, dass es zu potenziell langen Schwebelagen kommt. Die Bildung oder Betätigung der Richterwahlausschüsse wird damit nicht eingeschränkt. Allein das Risiko, dass sie nicht arbeitsfähig sind, geht nach der hier vertretenen Ansicht nicht auf Kosten der Möglichkeit, Richter:innen auf Lebenszeit zu ernennen.
In diese Richtung gingen schon die oben angeführten Ausführungen des Rechtsausschusses zum DRiG-E: „Die Richterwahlausschüsse müssen jedoch ihre Entscheidungen so rechtzeitig treffen, daß im Falle der Ablehnung die obersten Dienstbehörden die Entlassung spätestens zum Ablauf des vierten Jahres nach der Ernennung zum Richter auf Probe aussprechen können. Wird er zu diesem letzten Zeitpunkt nicht entlassen, hat der Richter auf Probe […] einen Anspruch auf Anstellung.“ (Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Deutschen Richtergesetzes – Drs. 516 –, BT-Drs. Nr. 3/2785, S. 11.)
Die Arbeitsunfähigkeit des Gremiums schadet danach allein seinem eigenen Einfluss. Insoweit ist auch die Schaffung einer neuen Notkompetenz der Justizministerin für die Lebenszeiternennung bei Untätigkeit des Richterwahlausschusses oder bei dessen Nichtbildung nicht erforderlich (vgl. Wittreck/Talg), weil diese Kompetenz bereits jetzt (zumindest nach Ablauf von vier Jahren der Probezeit) besteht. Eben das entspricht der historischen Konzeption des DRiG, die dem Richterwahlausschuss ein Veto-, aber kein Blockaderecht der Exekutivernennung zugestehen wollte. Anders ausgedrückt: in dubio pro Richternennung.
https://www.volksverpetzer.de/
Thüringen
AfD-Fraktion beschwert sich über Landtagsdirektor
13.06.2025, 16:39 Uhr
(Foto: Martin Schutt/dpa)
Die AfD-Fraktion sieht ein Oppositionsrecht im Landtag beschnitten. Verantwortlich macht sie dafür den Landtagsdirektor.
Erfurt (dpa/th) - AfD-Fraktionschef Björn Höcke sieht Oppositionsrechte seiner Fraktion in Untersuchungsausschüssen des Thüringer Landtags beschnitten. Seine Fraktion strenge eine Fach- und Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landtagsdirektor Jörg Hopfe an, erklärte Höcke in Erfurt. Grund sei eine nach Meinung der AfD-Fraktion gegen die Thüringer Verfassung gerichtete Amtsführung von Hopfe.
Von der Landtagsverwaltung gab es zunächst keine Reaktion. Die AfD ist neben der Linken eine von zwei Oppositionsfraktionen im Thüringer Parlament.
Konkret gehe es um das Recht auf Beweiserhebung, das als Minderheitsrecht die parlamentarische Aufklärungsarbeit durch die Opposition in einem Untersuchungsausschuss sicherstellen solle. Es sei der AfD-Fraktion "über Jahre hinweg entzogen" worden. Für die korrekten Abläufe im Thüringer Landtag trage Landtagsdirektor Hopfe die Verantwortung. Der Jurist gehört der Parlamentsverwaltung seit vielen Jahren an. Höcke erklärte: "Wenn er den Rechtsbruch in den Ausschüssen nicht kannte, dann ist er offensichtlich der falsche Mann für solch einen verantwortungsvollen Posten."
Quelle: dpa
https://www.n-tv.de/
Gefährliches „Gutachten“ im Auftrag der AfD
Ist die CDU/CSU verfassungsfeindlich?
05.06.2025, 07:00 Uhr
Lesezeit 4 Minuten
Friedrich Merz (CDU) legt am 6. Mai 2025 im Bundestag seinen Amtseid als Bundeskanzler ab.
Copyright: Michael Kappeler/dpa
Die AfD hat von einer bekannten Kölner Kanzlei ein Gutachten zur Verfassungstreue von CDU und CSU erstellen lassen. Unser Kolumnist Markus Ogorek, Professor für Öffentliches Recht an der Universität zu Köln, bewertet das Papier...
https://www.ksta.de/
Maulkorb vom AfD-Anwalt – Gedenkstätte Ahlem geschändet: Wie die AfD die Polizei zum Schweigen bringen wollte
Published by dokmz on 05.06.2025
Ein polizeibekannter Neonazi soll die Holocaust-Gedenkstätte in Hannover-Ahlem geschändet haben – er war zum Tatzeitpunkt in der AfD. Mit einer Abmahnung wollte die Partei verhindern, dass die Polizei das öffentlich macht.Mit einem juristischen Maulkorb für die Polizeidirektion Hannover hat die AfD versucht, ein für sie unangenehmes Detail der Schändung der Gedenkstätte in Hannover-Ahlem zu unterdrücken. Eine Abmahnung sollte dafür sorgen, dass niemand erfährt, dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tat in der AfD war. Nach Informationen dieser Redaktion sollte Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten eine solche Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung gegenüber der AfD abgeben. Eine Sprecherin bestätigte das. Dass eine Partei eine Polizeibehörde per Anwalt zum Schweigen bringen will, ist ungewöhnlich. Auch der NDR sollte eine Unterlassungserklärung abgeben. Mittlerweile bestreitet die AfD nicht mehr, dass der polizeibekannte Neonazi zum Zeitpunkt der Schändung der Gedenkstätte ihr Mitglied war. Ein bei einer Wohnungsdurchsuchung gefundenes Dokument bestätigt das. Die AfD wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. (…) Bei einer Wohnungsdurchsuchung Anfang Februar entdeckten Ermittler des Staatsschutzes das Dokument: einen Brief der Niedersachsen-AfD, unterzeichnet vom Landesvorsitzenden Ansgar Schledde. Darin bestätigt die AfD am 20. Januar eine zu dem Zeitpunkt seit einigen Wochen bestehende Mitgliedschaft im Landesverband. Damit nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen L. von dieser Redaktion konfrontiert, annullierte die AfD die Mitgliedschaft. AfD fordert Unterlassung Bis dahin hatte die AfD behauptet, sie kenne den Beschuldigten nicht. Über einen für die Partei regelmäßig tätigen Anwalt forderte sie von der Polizeidirektion die Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung. Eine Sprecherin der Behörde bestätigte die Abmahnung durch die Kanzlei Höcker in Köln. Das Innenministerium in Hannover erhielt eine Kopie. Die Abmahnung blieb erfolglos. „Die Polizeidirektion Hannover hat den Vorwurf einer unwahren Tatsachenbehauptung zurückgewiesen und die Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgelehnt“, sagte die Sprecherin. Auch der NDR hat nicht unterzeichnet.
https://dokmz.com/
Frankenthal
Berufungsverfahren: AfD-Stadtrat wegen Facebook-Post vorm Landgericht
Der Angeklagte soll im Zusammenhang mit einem Bericht zur Nord-Stream-Pipeline zu verstehen gegeben haben, er würde eine Tötung des Ex-Kanzlers Olaf Scholz (SPD) billigen.
Archivfoto: dpa
Sonja Weiher
02.06.2025 - 19:05 Uhr
Wegen Billigung von Straftaten hat das Amtsgericht Frankenthal im Dezember 2024 den Frankenthaler AfD-Kreisvorsitzenden und Stadtrat Frank Marx zu einer Geldstrafe in Höhe von 4200 Euro verurteilt. Ob der Richterspruch Bestand hat, muss das Landgericht Frankenthal als nächsthöhere Instanz in einem Berufungsverfahren klären. Als Termin nennt ein Sprecher des Gerichts Donnerstag, 14. August, 9 Uhr. Die ursprünglich für 10. Juni angekündigte Verhandlung müsse wegen des Urlaubs eines Beteiligten verlegt werden. Marx soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft in einem Facebook-Kommentar zu verstehen gegeben haben, dass er eine Tötung des damaligen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) befürworten würde. Er hat laut Anklage im Juni 2023 auf der öffentlich einsehbaren Facebook-Seite des Senders Servus TV einen Betrag mit den Worten kommentiert: „Scholz wusste dass wohl auch – der Typ muss sofort als Kanzler abtreten und im Innenhof des Bendlerblocks ersch…. werden.“ Hintergrund der Äußerung war ein Bericht des Senders über eine mögliche Verbindung in die Ukraine im Zusammenhang mit dem Sprengstoffanschlag auf die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 im September 2022. Der AfD-Politiker aus Frankenthal bestreitet, Urheber des Posts zu sein.
https://www.rheinpfalz.de/
50 Seiten Vorwürfe
Kritik an Union: AfD verfasst "Gegen-Gutachten"
Von
t-online
,
pri
02.06.2025
Lesedauer: 2 Min.
Alice Weidel, Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidatin der AfD, und Björn Höcke (AfD).Vergrößern des Bildes
Alice Weidel, Bundesvorsitzende der AfD, und Björn Höcke von der AfD in Thüringen. (Quelle: Sören Stache/dpa)
In der AfD kursiert ein "Gegen-Gutachten" zur Einstufung der Partei als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz. Das Ziel: Die Unionsparteien.
"Entwurf" steht in Großbuchstaben und in roter Schrift gleich auf Seite 1 des Papiers. "Entwurf" ist auch auf jeder Seite der Schrift hinterlegt. Ediert ist die gegenwärtige Fassung am 23. Mai – dem Jahrestag der Verabschiedung des deutschen Grundgesetzes. Die AfD hat ein sogenanntes Gegen-Gutachten zur Studie des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) vorgelegt, welche die Partei als gesichert rechtsextremistisch einstuft.
Die AfD hat gegen die Einstufung geklagt. Der Verfassungsschutz verpflichtete sich daraufhin zu einem Stillhalteabkommen. Die Einschätzung wird vorerst öffentlich nicht weiter erhoben.
- Konsequenzen: Das droht den Mitgliedern der rechtsextremen AfD
- Erklärung: AfD "gesichert rechtsextremistisch" – was das bedeutet
Die AfD hat nun selbst ein Gutachten erstellen lassen. Intern kursiert ein Papier des Kölner Anwalts Christian Conrad. Es ist mit knapp fünfzig Seiten deutlich dünner als die umfassende Studie des Verfassungsschutzes. Diese hatte auf gut 1.100 Seiten öffentlich zugängliche Zitate von AfD-Kadern zusammengestellt. Das Magazin "Cicero" stellte das Dokument online.
Berufungsverfahren zur Einstufung der AfD durch Verfassungsschutz
Vergrößern des Bildes
Anwalt Christian Conrad (r) mit seinem Kollegen Michael Fengler als Rechtsbeistand der AfD in einem Verfahren in Münster (Archivbild). (Quelle: Guido Kirchner/dpa/dpa-bilder)
Die AfD hat nun einen ähnlichen Ansatz gewählt. Von B wie Dorothea Bär (CSU) bis W wie Dr. Johannes Wadephul (CDU) sind Zitate führender Unions-Politiker aufgelistet. Die "Berliner Zeitung" veröffentlichte das Dokument im Netz.
- Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird mit früheren Aussagen zu Leitkultur und Migration zitiert wie: "Wir dürfen unsere Augen nicht davor verschließen, dass bei uns zunehmend Parallelgesellschaften entstehen und durch solche Entwicklungen noch gefördert werden." So müsse das Nachzugsalter für Kinder "sehr niedrig angesetzt werden".
- Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) wird unter anderem mit dem Zitat wiedergegeben: "Auf die linke Revolution der 68er und die Dominanz der Eliten muss eine konservative Revolution der Bürger folgen."
- Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) taucht mit Worten aus dem Jahr 2015 auf: "Entweder beendet die demokratische Mitte die illegale Migration – oder die illegale Migration beendet die moralische Mitte"
Die Bilanz des Papiers ist wenig überraschend: Von einer "Vielzahl und Beharrlichkeit der Äußerungen von Funktionärinnen und Funktionären" der Union spricht der Entwurf. Das Fazit: "Die vorstehenden Zitate haben gezeigt, dass Funktionärinnen und Funktionäre der CDU/CSU Äußerungen und Positionen vertreten, mit denen sie das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip grundlegend in Frage stellen." Das ist auch der zentrale Vorwurf gegen die Alternative für Deutschland.
https://www.t-online.de/
„Gegen-Gutachten“ der AfD: Wie verfassungsfeindlich sind CDU und CSU?
Ein internes Papier soll zeigen, dass – gemessen an den Maßstäben des Verfassungsschutzes – auch die Union ins Visier geraten müsste. Der Text offenbart eine neue Verteidigungslinie der AfD.
Maximilian Beer
,
Niklas Liebetrau
02.06.2025 12:43 Uhr
Die Fraktionsvorsitzenden der AfD, Tino Chrupalla und Alice Weidel.
Bernd von Jutrczenka/dpa
In der AfD-Bundesspitze kursiert ein juristisches Gutachten, das die Regierungsparteien CDU und CSU ins Visier nimmt. Die zentrale These: Nach den Maßstäben, die das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) bei der Hochstufung der AfD als „gesichert rechtsextrem“ anlegte, müsse auch die Union als verfassungsfeindlich gelten...
https://www.berliner-zeitung.de/
Bayerischer Landtag
Der AfD-Mann und die „Parasiten“
30.05.2025, 14:57 Uhr
Lesezeit: 2 Min.
Im Landtag geht es immer wieder hoch her. Besonders häufig, seit die AfD dort eingezogen ist.
(Foto: Sven Hoppe/dpa)
Ralf Stadler von der AfD zeigt den Grünen-Abgeordneten Toni Schuberl wegen Verleumdung an – nachdem dieser ihm im Landtag „eine Brandschneise aus Hass und Hetze“ vorgeworfen hatte.
Von Johann Osel
Es ist hitzig zugegangen im bayerischen Landtag, als die AfD im April mit einem Antrag über den Schutz der Meinungsfreiheit diskutieren wollte. AfD-Fraktionsvize Martin Böhm begründete das damit, dass die Bundesregierung, die alte wie die neue, angeblich im Verbund mit der Justiz, mit „links-grünen Demagogen“ und dem „EU-Moloch“ die Meinungen „freiheitsliebender Bürger einfach so unterdrücken“. Toni Schuberl (Grüne) platzte da der Kragen: „Die AfD und Meinungsfreiheit – was für ein Witz“, sagte er. „Sie schlagen eine Brandschneise aus Hass und Hetze durch unser Land, und dann reden Sie von der Meinungsfreiheit“. Die AfD wolle doch nur, dass es keine Kritik an deren „Hass“ geben dürfe. Als Beispiel führte Schuberl just den AfD-Abgeordneten Ralf Stadler auf: Dieser „nennt Flüchtlinge Parasiten. Er will eine Geburtenkontrolle für Muslime. Er nennt Menschen mit dunkler Hautfarbe kriminelle Zuhälter“.
Daraufhin gab Stadler eine Erklärung ab. Schuberl habe „Verfolgungswahn“, sei ein „verkappter Nazi-Jäger“. Er habe „zu keiner Zeit jemanden als Parasit bezeichnet“. Jetzt hat Stadler nach eigener Aussage Strafanzeige gegen Schuberl bei der Generalstaatsanwaltschaft München gestellt – wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung. Die „ehrverletzenden Äußerungen“ würden ihn als Person des politischen Lebens in der öffentlichen Meinung verächtlich machen.
Außerdem zeigte Stadler schon einen Leserbriefschreiber in einer Zeitung sowie Kommentatoren auf seinem Facebook-Profil an, auch diese hatten ihm Rechtsextremismus vorgeworfen. Kuriose Vorgeschichte: Schuberl hatte sich vor einiger Zeit mit dem Verfasser des Leserbriefs solidarisiert und öffentlich gefordert: „Zeigen Sie doch mich an!“
Zu dem, was Schuberl im Landtag über Stadler sagte, gibt es Zitate. Nur, dass Stadler behauptet, sie seien aus dem Kontext gerissen. Beispiel Parasiten, ein bereits älterer Facebook-Post von Stadler lautete: „Der Krieg gegen Deutschland hat längst begonnen, anstatt Militär wird Deutschland mit fremden nicht integrierbaren Kulturen kontaminiert. PARASITEN: Schmarotzer, Lebewesen, die dauernd oder vorübergehend auf (Ektoparasiten) oder in (Endoparasiten) einem andersartigen Organismus, dem Wirt, leben und diesen schädigen, ihn aber höchstens zu einem späteren Zeitpunkt töten.“
Mit dieser wissenschaftlichen Definition seien doch gar nicht Migranten gemeint, sagt Stadler. Dass der Post schon mal bei der Staatsanwaltschaft Deggendorf lag und diese ihn nicht angeklagt habe, unterstreiche das. Was er dann mit dem Parasiten-Zitat bezweckt hat? So ganz genau kann Stadler das auf Nachfrage nicht erklären. Für Schuberl indes ist klar: Sprachlich bezögen sich die Parasiten auf die fremden Kulturen. Und in der „Gesamtschau“ von Stadlers Facebook-Aktivitäten werde klar, dass damit Migranten gemeint seien, schreibt er an die Generalstaatsanwaltschaft. Damit behaupte er aber nicht, Stadler würde alle Migranten als Parasiten bezeichnen. Stadlers Strafantrag wie Schuberls Brief liegen der SZ vor. Noch ist offen, ob die Staatsanwaltschaft in der Sache aktiv wird.
https://www.sueddeutsche.de/
Partei setzt Taktik fort
Anfrage-Welle der AfD sprengt die Rekorde
Jonas Mueller-Töwe
29.05.2025
Lesedauer: 2 Min.
imago images 0820589262Vergrößern des Bildes
Die AfD-Fraktions- und Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla: Keine Fraktion im Bundestag stellt mehr Kleine Anfragen als ihre. (Quelle: IMAGO/imago)
Die AfD-Bundestagsfraktion ist offenbar gut vorbereitet in die neue Legislaturperiode gestartet. Kritiker vermuten hinter der Anfragen-Offensive seit Langem ein Kalkül.
Die AfD setzt ihren Kurs fort, im Bundestag möglichst viele Kleine Anfragen an die Bundesregierung zu stellen. Seit der konstituierenden Sitzung des Bundestags am 25. März hat die Fraktion bereits 114 Kleine Anfragen eingereicht. Das sind weit mehr als die Fraktion der Linken (26) und die Grünen-Fraktion (4), die ebenfalls in der Opposition sind.
Kleine Anfragen sind ein Instrument der parlamentarischen Kontrolle des Parlaments. Fraktionen und Abgeordnete können so schriftlich Auskunft zu bestimmten Sachverhalten verlangen. Die Regierung beziehungsweise ihre Ministerien müssen diese Anfragen binnen einer Frist von vier Wochen beantworten. Einzelne Abgeordnete der AfD-Fraktion tun sich dabei besonders hervor: Kay-Uwe Ziegler war an 52 der Kleinen Anfragen beteiligt, Christina Baum und Christoph Birghan an jeweils 48 .
Rekord bereits in der vorherigen Periode
Bereits in der vergangenen Legislaturperiode war die AfD mit Abstand für die meisten Anfragen im Bundestag verantwortlich. In knapp vier Jahren verfasste sie 2.033 Kleine Anfragen, fast doppelt so viele wie die wesentlich größere Fraktion von CDU/CSU. Die Fraktion der Linken kam auf 1.333, das BSW auf 64, die FDP während ihrer kurzen Zeit in der Opposition auf 65.
Kritiker vermuten hinter den Anfragen seit Langem eine Strategie, die Ministerien in der täglichen Arbeit zu überlasten. In mehreren Ressorts klagten schon in der vergangenen Legislaturperioden Sachbearbeiter über die zunehmende Anzahl und den Umfang der Auskunftsverlangen. Ähnliches berichteten Regionalmedien über die Entwicklung in den Landtagen.
Die ausufernde Nutzung des wichtigen Kontrollinstruments ist allerdings nicht ohne Beispiel: Erstmals trat die Fraktion der Linken in den Jahren 2013 bis 2017 damit in Erscheinung. Damals verdreifachte sich die Zahl der gestellten Kleinen Anfragen, wie n-tv berichtete. Über die Hälfte der fast 4.000 Kleinen Anfragen gingen auf die Fraktion zurück.
https://www.t-online.de/
Rechtsextremismus
Prozess um Angriff auf SPD-Leute: Polizei spricht von "kampfbereiter Gruppe"
28.05.2025, 17:33 Uhr
Im Prozess um einen Angriff auf SPD-Mitglieder im Bundestagswahlkampf haben mehrere Polizisten ausgesagt. Demnach war die jugendliche Gruppe aus Sachsen-Anhalt "kampfbereit" und in Berlin, "um Linke zu prügeln". Die jungen Männer zwischen 17 und 20 Jahren müssen sich unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.
von MDR SACHSEN-ANHALT
Teilen
- Im Prozess schildern Polizisten die Angeklagten als gewaltbereite Gruppe.
- Im Dezember waren eine Kommunalpolitikerin und ihr Mann von den jungen Männern attackiert und verletzt worden.
- Zwei der vier Angeklagten bedauern ihre Tat.
Nach einem Angriff auf SPD-Mitglieder im Bundestagswahlkampf in Berlin haben im Prozess gegen vier mutmaßliche Neonazis aus Sachsen-Anhalt mehrere Polizeibeamte ausgesagt. Es sei eine "kampfbereite Gruppe" gewesen, schilderte eine Beamtin. Einer der Männer habe gerufen, er sei "stolz, ein Rechter zu sein". Sie seien nach Berlin gekommen, "um Linke zu prügeln". In den Augen habe sie Hass und Wut wahrgenommen, berichtete die Beamtin am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tiergarten.
Drei Angeklagte in Untersuchungshaft
Den Angeklagten im Alter zwischen 17 und 20 Jahren wird unter anderem gefährliche Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Polizisten zur Last gelegt. Ein SPD-Mitglied sei bei dem Angriff am 14. Dezember 2024 gegen 12 Uhr an einer Bushaltestelle in Berlin-Lichterfelde geschlagen und durch Tritte mit Springerstiefeln auch gegen den Kopf verletzt worden. Die Angeklagten wurden am Tatort festgenommen. Drei von ihnen befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.
Video
Rechtsextreme Straftaten sprunghaft angestiegen
Rote Mützen abgezogen und getreten
Betroffen von der mutmaßlich rechtsextremen Gewalt waren eine SPD-Kommunalpolitikerin und ihr Ehemann, die von einem Wahlkampfstand kamen und auf einen Bus warteten. "Uns wurden erst die roten Mützen abgezogen", schilderte die SPD-Fraktionsvorsitzende in der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf, Carolyn Macmillan, am ersten Prozesstag vor drei Wochen. Ihr Mann sei zu Boden gebracht worden, vier Leute hätten ihn attackiert. Auch sie sei geschubst worden.
Der 50-jährige Ehemann erlitt Schürfwunden und schmerzhafte Prellungen. Als Polizeibeamte eintrafen, seien auch sie angegriffen worden. "Als wir kamen, bauten sie sich vor uns auf", schilderte eine 29 Jahre alte Beamtin. Die Männer seien maskiert gewesen, mehrere hätten Springerstiefel getragen. Pöbeleien und rassistische Beleidigungen seien gerufen worden. Einer der Angeklagten habe die Gruppe weiter aufgeheizt. Ein Beamter erlitt im Handgemenge laut Anklage einen Mittelhandbruch, ein weiterer Polizist eine Platzwunde durch eine zerbrochene Fensterscheibe.
Zwei Angeklagte äußern Bedauern
Ein 19-Jähriger hatte zu Prozessbeginn vor drei Wochen gestanden. Er habe seine Gesinnung "auch mit Gewalt zum Ausdruck bringen wollen", erklärte der junge Mann über einen seiner Verteidiger. Es tue ihm leid, er habe sich auf einem "Irrweg" befunden. Ein 20-Jähriger äußerte nun am zweiten Verhandlungstag Bedauern. "Es war nicht geplant, es hätte nicht dazu kommen dürfen", hieß es in der Erklärung. Er bitte um Entschuldigung.
Teilnehmer einer rechtsextreme Versammlung halten eine Kriegsflagge des Deutschen Reiches im Hauptbahnhof hoch.
03:52
Junge Rechtsextreme
Steigende Zahlen rechter Gewalttaten überfordern Präventionsarbeit
Die jungen Männer sollen aus Sachsen-Anhalt nach Berlin gereist sein, um an einer rechten Demonstration teilzunehmen. Laut Ermittlungen sind sie einer gewaltbereiten Jugendszene zuzuordnen, die sich an einer rechtsextremen Ideologie orientiert. Sie hätten sich durch "offen zur Schau gestellte rechtsextreme Weltanschauung verbunden gefühlt", heißt es in der Anklage. Die vier Männer seien sich einig gewesen, "bei Gelegenheit" gegen politische Andersdenkende vorzugehen. Der Prozess wird am 4. Juni fortgesetzt.
Mehr zum Thema rechtsextreme Gewalt
Handschellen werden einen Angeklagten abgenommen.
00:32
Gerichtsverfahren beantragt
Angriff auf SPD-Mitglieder: Anklage gegen mutmaßliche Neonazis erhoben
Polizei-Aktion gegen mutmaßliche rechtsextreme Terrorzelle in Neubukow Mecklenburg-Vorpommern
Bundesanwaltschaft
Nach Razzia gegen rechtsextreme Terrorzelle: Alle Festgenommenen in U-Haft
Kommentar Torben Lehning zu Razzia und Schlag gegen Terrorgruppe "Letzte Verteidigungswelle"
Meinung
Kommentar zu rechtsextremer Terrorzelle: Wegsehen hilft nicht
Teilnehmende einer rechtsextremen Versammlung im Hauptbahnhof zeigen das neonazistische Symbol von white power (dt. "weiße macht") mit den Händen.mit Video
Fast 50 Prozent mehr
Zahl rechtsextremer Straf- und Gewalttaten deutlich gestiegen
Teilnehmende einer rechtsextremen Versammlung im Hauptbahnhof zeigen das neonazistische Symbol von white power (dt. "weiße macht") mit den Händen.
02:51
Kriminalstatistik Sachsen-Anhalt
Rekord bei politisch motivierten Straftaten – rechte Delikte nehmen deutlich zu
dpa, MDR (Anne Gehn-Zeller)
Dieses Thema im Programm:
MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 28. Mai 2025 | 19:00 Uhr
https://www.mdr.de/
Nach Morddrohung
Zwickaus Oberbürgermeisterin erhält Personenschutz
In einer Mail mit Bezug auf den NSU, Hitler und Walter Lübcke wurde Constance Arndt mit dem Tod gedroht. Jetzt steht die Zwickauer Oberbürgermeisterin unter Polizeischutz. Beim mutmaßlichen Absender fand die Polizei eine Bockflinte.
28.05.2025, 15.57 Uhr
Oberbürgermeisterin von Zwickau: Constance Arndt von der lokalen Wählervereinigung Bürger für Zwickau
- Bild vergrößern
Oberbürgermeisterin von Zwickau: Constance Arndt von der lokalen Wählervereinigung Bürger für Zwickau Foto: Jan Woitas / dpa-Zentralbild / dpa
Die Oberbürgermeisterin von Zwickau, Constance Arndt, steht nach einer Morddrohung bei Veranstaltungen unter Personenschutz. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) unter Berufung auf das Landeskriminalamt Sachsen und die Stadt Zwickau berichtet, wurden entsprechende Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Über den konkreten Umfang der polizeilichen Maßnahmen machten die Behörden keine Angaben.
Laut Stadtverwaltung zeigte sich Arndt dankbar für die aktuell eingeleiteten Schutzmaßnahmen. Es sei ein »wichtiges Signal, dass der Staat solche Drohungen ernst nimmt und Verantwortungsträger auf kommunaler Ebene schützt«.
Ermittlungen gegen 19-jährigen Tatverdächtigen
Arndt hatte Mitte April per E-Mail eine Morddrohung erhalten, die sie veröffentlichte. Inzwischen wurde ein 19-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern als möglicher Absender identifiziert. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.
In der Wohnung des Tatverdächtigen im Landkreis Ludwigslust-Parchim hatten Ermittler seinen Jagdschein sowie eine Bockflinte und eine Schreckschusswaffe gefunden. Der Mann war vorher polizeilich nicht aufgefallen.
»Immer schön aufpassen«
In der Drohmail an die Oberbürgermeisterin wird auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Bezug genommen, der 2019 von einem Rechtsextremisten mit einem Kopfschuss getötet wurde. »Denken Sie an Walter Lübke. Immer schön aufpassen«, heißt es in dem Schreiben, in dem der Nachname des Ermordeten Lübcke falsch geschrieben ist. Der Verfasser nennt als Absender Adolf Hitler. Zudem trägt die Drohmail das Kürzel NSU im Namen.
- Zugriff in Mecklenburg-Vorpommern: Zwickaus Oberbürgermeisterin rechtsextrem bedroht – 19-Jähriger tatverdächtig Zwickaus Oberbürgermeisterin rechtsextrem bedroht – 19-Jähriger tatverdächtig
- Absender »nsu@gmail.com«: Oberbürgermeisterin von Zwickau veröffentlicht rechtsextremes Drohschreiben Oberbürgermeisterin von Zwickau veröffentlicht rechtsextremes Drohschreiben
- Umstrittener Wahlkampfauftritt des Unionskanzlerkandidaten: Lübcke-Witwe kritisiert Merz scharf
- Lübcke-Witwe kritisiert Merz scharf
Der »Nationalsozialistische Untergrund« war eine rechtsextreme Terrorzelle, deren Führungstrio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe unter anderem in Zwickau im Untergrund lebte. Sie sind verantwortlich für den Mord an neun Migranten und einer Polizistin. Weitere Mordversuche, Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle gehen auf das Konto der neonazistischen Vereinigung.
ala
https://www.spiegel.de/
Berlin & Brandenburg
AfD kündigt Verfassungsklage zu Geheimdienst-Anfrage an
27.05.2025, 16:26 Uhr
(Foto: Michael Bahlo/dpa)
Der Verfassungsschutz Brandenburg betreibt laut Innenministerium 287 sogenannte Fake-Accounts in sozialen Netzwerken. Die AfD im Landtag fordert noch mehr Infos und will das juristisch durchsetzen.
Potsdam (dpa/bb) - Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag plant eine weitere Verfassungsklage gegen die Landesregierung wegen einer aus ihrer Sicht unzureichenden Antwort zur Arbeit des Verfassungsschutzes. Das kündigte der Parlamentarische Geschäftsführer Dennis Hohloch an. Die Fraktion wollte vom Innenministerium unter anderem wissen, wie viele sogenannte Fake-Accounts der Verfassungsschutz in sozialen Netzwerken betreibt.
Das Innenministerium antwortete zunächst, eine vollständige Beantwortung sämtlicher hier vorliegenden Fragen könne aus Gründen des Staatswohls nicht erfolgen. Mit der Antwort auf die Frage, welche Netzwerke und Chatgruppen und wie viele Accounts die Verfassungsschutzbehörde betreibe, würden zum Beispiel spezifische Informationen zur Tätigkeit, zum Erkenntnisstand und zu Aufklärungsschwerpunkten offengelegt.
AfD wollte mehr Informationen
Die AfD-Fraktion forderte weitere Auskunft und verwies auf ein Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofs von 2024, bei der es um eine Anfrage der Thüringer AfD im Landtag zu Aktivitäten des Verfassungsschutzes Thüringen in sozialen Netzwerken und Chat-Gruppen ging. Darin heißt es unter anderem, die Mitteilung der Zahl der vom Verfassungsschutz erstellten und genutzten virtuellen Accounts - aufgeschlüsselt nach Phänomenbereichen - unterliege keinem Auskunftsverweigerungsrecht.
Das Brandenburger Innenministerium antwortete erneut und schrieb darin, der Verfassungsschutz betreibe insgesamt 287 Accounts auf entsprechenden Plattformen. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die AfD-Fraktion will nun wissen, auf welchen Plattformen und in welchem Bereich - Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus - sie angesiedelt sind. Weil ihr die bisherigen Informationen nicht ausreichen, kündigte sie ein Organstreitverfahren vor dem Verfassungsgericht an. Es ist nicht die erste Verfassungsklage der AfD-Fraktion.
Verfassungsschutz setzt AfD-Hochstufung vorerst aus
Der Verfassungsschutz Brandenburg hatte den AfD-Landesverband vom Verdachtsfall zur "gesichert rechtsextremistischen Bestrebung" hochgestuft. Weil die AfD dagegen eine Klage und einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht einreichte und dies noch nicht entschieden ist, setzte der Verfassungsschutz diese Einstufung aber vorerst aus. Die damalige Innenministerin Katrin Lange (SPD) hatte Verfassungsschutzchef Jörg Müller im Mai entlassen, weil er sie über die Hochstufung zu spät unterrichtet haben soll. Lange trat im Zuge eines darauffolgenden Streits zurück, ihr Nachfolger wurde René Wilke.
Quelle: dpa
https://www.n-tv.de/
Zugriff in Mecklenburg-Vorpommern
Zwickaus Oberbürgermeisterin rechtsextrem bedroht – 19-Jähriger tatverdächtig
Per Mail drohte ein anonymer Verfasser der Oberbürgermeisterin von Zwickau, Constance Arndt. Dabei spielte er auch auf die Ermordung des CDU-Politikers Walter Lübcke an. Nun hat das LKA Sachsen einen Verdächtigen ermittelt.
23.05.2025, 16.21 Uhr
- Kommunalpolitikerin Arndt: »Einschüchtern lasse ich mich nicht«
- Absender »nsu@gmail.com«: Oberbürgermeisterin von Zwickau veröffentlicht rechtsextremes Drohschreiben Oberbürgermeisterin von Zwickau veröffentlicht rechtsextremes Drohschreiben
Bild vergrößern
Kommunalpolitikerin Arndt: »Einschüchtern lasse ich mich nicht« Foto: Jan Woitas / dpa
Nach der Morddrohung gegen Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt ermittelt die Polizei gegen einen 19-Jährigen in Mecklenburg-Vorpommern.
Die digitalen Spuren des im April elektronisch verschickten Schreibens ließen auf ihn als Tatverdächtigen schließen, teilte das Landeskriminalamt Sachsen mit . Nun wurde seine Wohnung im Landkreis Ludwigslust-Parchim durchsucht.
Dabei seien sein Jagdschein sowie eine Bockflinte und eine Schreckschusswaffe eingezogen worden, hieß es. Der Deutsche sei bisher nicht polizeibekannt.
Absender benennt sich als Adolf Hitler
Die Kommunalpolitikerin der lokalen Wählervereinigung »Bürger für Zwickau« hatte im April ein Schreiben erhalten, in dem auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Bezug genommen wird.
»Denken Sie an Walter Lübke. Immer schön aufpassen.« Als Absender der Zeilen mit der falschen Schreibweise des Politikers war Adolf Hitler angegeben. Die E-Mail-Adresse spielte auf die rechtsextreme Zelle »Nationalsozialistischer Untergrund« (»NSU«) an – jene rechtsextreme Terrorzelle, die einst in Zwickau im Untergrund lebte.
Der NSU ermordete acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie eine Polizistin.
Unbekannte Aussagen der NSU-Terroristin: Das verrät Beate Zschäpe über ihre 14 Jahre im Untergrund Von Wiebke Ramm, Sven Röbel und Wolf Wiedmann-Schmidt
Das verrät Beate Zschäpe über ihre 14 Jahre im Untergrund
Rechtsruck in Deutschland: Früher habe ich auch mal einen Hitlergruß gemacht, heute werde ich von Neonazis bedroht
Ein Gastbeitrag von Jakob Springfeld
Früher habe ich auch mal einen Hitlergruß gemacht, heute werde ich von Neonazis bedroht
Arndt machte das Schreiben damals öffentlich. In einem Beitrag auf der Plattform Instagram schrieb sie dazu: »Einschüchtern lasse ich mich nicht«.
Die Nachricht wurde über das Kontaktformular der Stadt Zwickau versandt, wie das LKA weiter mitteilte. Es übernahm die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Zwickau. Ermittelt wird gegen den 19-Jährigen den Angaben zufolge wegen Bedrohung.
aeh/AFP/dpa
https://www.spiegel.de/
"Rechtskampf" der AfD
Höcke lässt sich 62-seitigen Persilschein ausstellen
Von Hubertus Volmer
12.05.2025, 16:15 Uhr
Artikel anhören
Geht es nach Björn Höcke, so darf er als Abgeordneter gegen Paragraf 86a des Strafgesetzbuchs verstoßen.
(Foto: IMAGO/Mauersberger)
In Berlin stellt der Thüringer AfD-Chef Höcke ein Gutachten vor, das sowohl die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz als auch alle Prozesse gegen ihn beenden soll. Zugleich droht er Richtern und Staatsanwälten.
Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke sieht sich und seinen Landesverband zu Unrecht politisch verfolgt. Das allein wäre keine Nachricht - die AfD sieht sich seit Jahren als Opfer. Neu ist: Zusammen mit dem sächsischen AfD-Chef Jörg Urban hat Höcke in Berlin ein Gutachten vorgestellt, das den Vorwurf juristisch untermauern soll.
Dem Gutachten zufolge verbietet Artikel 55 der Thüringer Landesverfassung "alle die Mandatsausübung beeinträchtigenden Maßnahmen". Darunter fassen die AfD und ihr Gutachter, der Staatsrechtler Michael Elicker, vor allem die Beobachtung durch den Verfassungsschutz sowie dessen Einstufung der AfD als rechtsextremistisch. Für Sachsen gilt das Gutachten analog: Auch die sächsische Landesverfassung enthält eine sogenannte Indemnitätsklausel, die praktisch identisch mit der thüringischen Regelung ist.
524525645 (1).jpg
13:24 min
Politik
12.05.25
AfD zieht neue Verteidigungslinie
"Höcke will das Recht, zu sagen, was er möchte"
Die Indemnität von Abgeordneten bedeutet, dass sie "zu keiner Zeit wegen ihrer Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die sie im Landtag, in einem seiner Ausschüsse oder sonst in Ausübung ihres Mandats getan haben, gerichtlich oder dienstlich verfolgt" werden dürfen, wie es in Artikel 55 der Thüringer Landesverfassung heißt. Hier liegt der Unterschied zur Immunität: Sie kann aufgehoben werden, damit Abgeordnete vor Gericht angeklagt werden können.
"Sämtliche Verfahren gegen mich sind einzustellen"
Höcke sagte bei der Pressekonferenz in Berlin, die Indemnität diene dem Schutz der Gewaltenteilung und damit dem Schutz der Demokratie. Die AfD als "einzige Opposition" werde auf eine Art angegriffen, "dass es mittlerweile die Demokratie gefährdet".
Aus dem 62-seitigen Gutachten leitet Höcke mehrere Forderungen ab, die er und die AfD ohnehin seit Jahren stellen. So stehe "der Verdacht der Rechtsbeugung im Raum". Der Verfassungsschutz betreibe "Gesinnungsschnüffelei" gegen Oppositionsparteien, die "völlig friedlich unterwegs sind, die nur eine andere Meinung haben", behauptete er. Dies sei in Thüringen und Sachsen "sofort einzustellen".
318431630.jpg
Politik
10.07.24
Vorwurf: Staat verunglimpft
Thüringer Landtag hebt Höckes Immunität erneut auf
Gleiches forderte Höcke für alle Prozesse, die gegen ihn geführt werden: "Sämtliche Verfahren gegen mich sind einzustellen, denn der Indemnitätsschutz gilt für jeden Abgeordneten zu jeder Zeit." Auch müsse geprüft werden, "inwiefern" sich die Staatsanwälte und Richter in den Verfahren gegen ihn strafbar gemacht hätten. Im vergangenen Jahr wurde Höcke vom Landgericht Halle zwei Mal wegen der Verwendung einer SA-Losung verurteilt; Höcke hat gegen beide Urteile Revision eingelegt. Sein AfD-Landesverband wird vom Thüringer Verfassungsschutz seit 2021 als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.
Nicht die erste Drohung - die aber keine sein soll
Höcke stieß Drohungen dieser Art nicht zum ersten Mal aus. Man könne den Angestellten des Verfassungsschutzes "nur dringend raten, sich eine neue Arbeit zu suchen", schrieb er unlängst auf X, nachdem das Bundesamt die AfD auf "gesichert rechtsextremistisch" hochgestuft hatte. "Am Ende wird es wie immer in der Geschichte heißen: Mitgehangen – mitgefangen."
Auf der Pressekonferenz fragte ein Journalist, warum Höcke diesen Eintrag kurz nach seiner Veröffentlichung gelöscht hatte. Das sei "eine Unregelmäßigkeit in meiner Abteilung gewesen", die er nicht weiter ausführen wolle, sagte Höcke. Inhaltlich stehe er aber dazu. Beamte hätten die Pflicht, "ungesetzmäßiges Handeln" zurückzuweisen, führte er aus. Es sei "ein zum Nachdenken anregender Satz" gewesen, soll heißen: keine Drohung. Auf die Frage, welche Konsequenzen die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes denn befürchten müssten, antwortete er lächelnd: "Gar keine, sie sind ihren Gewissen gegenüber verpflichtet."
470579770.jpg
Politik
01.07.24
Prozess in Halle
Björn Höcke wegen NS-Parole zu Geldstrafe verurteilt
Höcke ist der Kopf des völkischen Flügels der AfD. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main entschied vor zwei Jahren, die Aussage "Björn Höcke ist ein Nazi" sei keine Beleidigung, sondern "ein an Tatsachen anknüpfendes Werturteil". Selbst der AfD-Vorstand kam 2015 zu dem Schluss, Höcke habe unter Pseudonym für eine neonazistische Zeitschrift geschrieben. Darin sprach er unter anderem über eine "identitäre Systemopposition", die in der anstehenden Revolution ihren "Führungsanspruch" durchsetzen müsse. 2017 attestierte die AfD-Spitze dem Thüringer Landeschef "eine übergroße Nähe zum Nationalsozialismus". Dennoch hat Höcke die großen Machtkämpfe in der AfD stets gewonnen. Einige Beobachter bezeichnen ihn seit Jahren als wahres Machtzentrum der Partei.
Grenze oder keine Grenze?
In der Pressekonferenz bezog sich Höcke ausdrücklich auf die Urteile von Halle: "Nein, die Indemnität zieht keine Grenze", sagt er auf eine entsprechende Frage. Gutachter Elicker assistierte: Auch "moderne Formen der Pressearbeit", also etwa Wahlkampfreden, seien vom Indemnitätsschutz betroffen. Das würde bedeuten, dass Höcke, da er nicht nur AfD-Landeschef ist, sondern auch Abgeordneter des Thüringer Landtags, ungestraft gegen Paragraf 86a des Strafgesetzbuches verstoßen dürfte. Der Paragraf verbietet das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen - das Landgericht Halle hatte Höcke auf dieser Basis verurteilt, weil er mehrfach eine SA-Parole verwendet hatte.
Das ist offenbar einer der Hauptzwecke des Gutachtens. Der sächsische AfD-Fraktionsvize Joachim Keiler sagte, die Verfahren gegen Höcke würden "natürlich vor das Verfassungsgericht" gebracht, wenn sie nicht "vor einem ordentlichen Gericht enden", sprich: wenn Höcke nicht freigesprochen wird. Keiler räumte indessen ein, dass die Indemnität eine Grenze habe. Diese liege dort, wo "in aggressiv-kämpferischer Weise" gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgegangen werde. Aber "das tun wir ja nicht", sagte er.
afddemo.jpg
00:48 min
Politik
11.05.25
Proteste von Bremen bis München
Demos ziehen für AfD-Verbot durch deutsche Städte
Bei der Pressekonferenz blieb unklar, ob Höckes und Urbans Vorstoß mit der Bundespartei abgesprochen war. Er gehe davon aus, "dass das Gutachten im Rechtskampf auf Bundesebene Verwendung finden wird", sagte Höcke. Heute Abend befasse sich der AfD-Bundesvorstand mit dem weiteren Vorgehen im Rechtsstreit mit dem Verfassungsschutz.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die AfD am 2. Mai als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Dagegen hat die AfD mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Köln reagiert. Bis zu einer Entscheidung hat der Verfassungsschutz die neue Einstufung ausgesetzt - ein normaler juristischer Vorgang. Offiziell wird die AfD weiter nur als Verdachtsfall geführt. Neben Thüringen und Sachsen stufen die jeweiligen Landesverfassungsämter auch die AfD in Sachsen-Anhalt und Brandenburg als gesichert rechtsextremistisch ein.
Quelle: ntv.de
https://www.n-tv.de/
Nach Hochstufung durch Verfassungsschutz: AfD-Funktionäre reagieren mit Wut und Drohungen
Was bedeutet die Hochstufung der AfD für die Partei? Immer mehr Mitglieder nehmen Stellung – zum Teil mit brachialen Worten.
Von Sebastian Leber
07.05.2025, 09:10 Uhr
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Renner spricht von einer „neu-marxistischen Herrschaftssucht des Altparteien-Kartells“. Sein Fraktionskollege Peter Boehringer bezeichnet das Amt der Bundesinnenministerin als „gesichert linksextrem“.
Die Entscheidung des Verfassungsschutzes, die AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ und damit verfassungsfeindlich einzustufen, hat in der Partei eine Empörungswelle ausgelöst. Dabei verbreiten Funktionäre der Partei auch Fake News und Beschimpfungen...
https://www.tagesspiegel.de/
+++
Bedeutungsgeschichte: mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen
Die ursprüngliche Reihenfolge von mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen – also: beim Verbrechen zugegen sein, gemeinsam mit den Schuldigen ergriffen werden, was schließlich die gemeinsame Bestrafung (Erhängen) zur Folge hat –, wird in den verkürzten Wendungen gelegentlich vertauscht: mitgehangen, mitgefangen. Offenbar wird mitgehangen bisweilen im Sinne von ‘mitbeteiligt sein’ (‘in etwas mit drinhängen’) verstanden.
https://www.dwds.de/
Woher kommt der Spruch Mitgehangen, mitgefangen ?
Die Redewendung „Mitgehangen, mitgefangen“ ist tief in der deutschen Kultur verwurzelt und hat einen faszinierenden Ursprung. Doch was macht dieses Sprichwort so besonders und woher stammt es eigentlich? Unsere Recherche zeigt, dass der Ausdruck bereits seit mindestens 1716 existiert, wie aus dem Werk „Teutsch-juristischer Sprichwörterschatz“ von Pistorius hervorgeht. Interessanterweise findet der Spruch in vielen Bereichen des täglichen Lebens Anwendung, sei es im rechtlichen, politischen oder sportlichen Kontext. Dies spiegelt die breite und vielfältige Nutzung dieser Redewendung in Deutschland wider. In der Geschichte und Literatur lässt sich der Ursprung und die Bedeutung des Sprichworts „Mitgehangen, mitgefangen“ immer wieder nachverfolgen.
Um ein anschauliches Bild zu vermitteln, warum die Redewendung „Mitgehangen, mitgefangen“ auch heute noch von Bedeutung ist, betrachten wir die Verwendung in verschiedenen Kontexten. Zum Beispiel wird der Satz in rechtlichen Szenarien oft genutzt, um kollektive Verantwortung zu betonen.
Von strafrechtlichen Urteilen bis hin zu politischen Diskussionen über die Übernahme von Verantwortung bietet die Redewendung „Mitgehangen, mitgefangen“ einen wertvollen Einblick in die deutsche Kultur und deren Verständnis von Kollektivität und Verantwortung. In den kommenden Abschnitten werden wir weiter auf die historische Bedeutung, den Ursprung und die unterschiedlichen Kontexte der Nutzung dieses Sprichworts eingehen.
https://lexicanum.de/
++
Nach neuer AfD-Einstufung beim Verfassungsschutz: Höcke zeigt wahres Gesicht
Stand:10.05.2025, 04:51 Uhr
Von: Christoph Gschoßmann
«Gesichert rechtsextremistisch»: AfD will gegen Verfassungsschutz klagen
0:05
Die Einordnung der gesamten AfD als rechtsextremistisch verursacht starke Reaktionen. Höcke löscht seinen X-Eintrag zügig.
Frankfurt – Die gesamte AfD ist rechtsextremistisch. Zu dieser Einschätzung kam der Verfassungsschutz, was neue Diskussionen um ein Verbotsverfahren der Partei ins Leben rief. Die AfD will jedoch gegen die Einstufung klagen, und auch Björn Höcke äußerte sich nun. Allerdings löschte er einen kontroversen Beitrag sofort wieder.
Höcke schießt gegen Verfassungsschutz: „Neue Arbeit suchen“
„Man kann den Angestellten des Verfassungsschutzes nur dringend raten, sich eine neue Arbeit zu suchen. Am Ende wird es wie immer in der Geschichte heißen: Mitgehangen – mitgefangen“, gab Höcke auf X zu Protokoll.
Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, kritisierte die Äußerung des thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Höcke als „widerlich“. Kopelke sagte der Rheinischen Post, die Arbeit des Verfassungsschutzes sei unerlässlich für die Sicherheit und Stabilität Deutschlands. Seine Organisation verurteile die versuchte Einschüchterung und Mobilisierung gegen diese Institution auf das Schärfste. Höckes Beitrag zog weitere erschrockene Reaktionen nach sich, so schrieb etwa der Historiker Jens-Christian Wagner auf X: „#Höcke lässt keinerlei Zweifel daran, dass die Einstufung der #AfD als gesichert rechtsextrem überfällig war.“
AfD-Verbot? Union skeptisch: „Man muss sie wegregieren“
Führende Unionspolitiker bleiben auch nach der Einstufung der AfD als rechtsextremistisch bei ihrer ablehnenden Haltung zu einem Verbotsverfahren. „Ich bin da sehr skeptisch“, sagte der designierte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“.
„Ich glaube nicht, dass man eine AfD einfach wegverbieten kann, sondern man muss sie wegregieren.“ CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte der Bild: „Ich halte da nichts von. Die meisten Wähler wählen die AfD aus Protest. Und Protest kann man nicht verbieten.“ Ein Verbotsverfahren sei „Wasser auf die Mühlen der AfD und ihre Geschichtserzählung, dass man sich nicht mehr politisch mit ihr auseinandersetzen will, sondern nur noch juristisch“, erklärte Dobrindt. „Und das würde ich der AfD ungern gönnen.“
SPD vorsichtig, Verdi-Chef fordert Verbotsverfahren für AfD
Dobrindts Vorgängerin, die scheidende Ministerin Nancy Faeser (SPD), hatte zu einer sehr vorsichtigen Prüfung eines Verbotsverfahrens geraten. „Es gibt jedenfalls keinerlei Automatismus“, sagte sie nach der Verfassungsschutz-Einstufung. Die Grünen dagegen wollen schnell vorgehen: Parteichef Felix Banaszak rief die Union auf, sich gemeinsam auf ein AfD-Verbotsverfahren zu verständigen. „Ich lade CDU und CSU ausdrücklich und aufrichtig ein: Herr Merz, Herr Söder – lassen Sie uns gemeinsam darüber reden, lassen Sie uns aktiv werden. Nicht aus parteipolitischem Kalkül, sondern weil unsere Demokratie es wert ist. Bevor es zu spät ist“, schrieb er auf X. Auch die Linke sprach sich für ein Verbotsverfahren aus.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat die AfD mit ihren Parteigrößen wie Björn Höcke als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa
Für ein Verbotsverfahren sprach sich etwa Verdi-Chef Frank Werneke aus. Ein Verbotsverfahren ersetze „nicht die tägliche politische Auseinandersetzung mit der AfD und das Zurückdrängen ihres gesellschaftlichen Einflusses“, sagte Werneke den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagausgaben). Nach der AfD-Einstufung als gesichert rechtsextremistisch sei es „dennoch an der Zeit, ein Verbotsverfahren vorzubereiten, das erwarte ich von den Ländern und vom Bund“.
AfD klagt gegen Verfassungsschutz-Entscheidung
Am Montagmorgen (5. Mai 2025) reichte der AfD-Bundesverband vor dem Verwaltungsgericht Köln Klage gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz per Eilantrag ein. Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla erklärten, dass die Partei mit der Klage „ein klares Zeichen gegen den Missbrauch staatlicher Macht zur Bekämpfung und Ausgrenzung der Opposition“ setze.
Eine Partei verbieten kann nur das Bundesverfassungsgericht. Beantragen können dies Bundestag, Bundesregierung oder Bundesrat. Im Falle der rechtsextremistischen früheren NPD – heute unter dem Namen Die Heimat – waren zwei Verbotsverfahren gescheitert. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, gegen die Partei vorzugehen. (cgsc mit dpa)
https://www.hna.de/
AfD: Höcke und Urban nehmen Verfassungsschutz ins Visier
09.05.2025, 06:30 Uhr • Lesezeit: 3 Minuten
Fabian Klaus
Reporter Thüringen
Björn Höcke im Thüringer Landtag
© dpa | Martin Schutt
Berlin/Erfurt. In Berlin wollen die Fraktionschefs der AfD aus Thüringen und Sachsen ein neues Gutachten vorstellen. So eng ist der Gutachter mit der AfD verbunden.
https://www.thueringer-allgemeine.de/
Einstufung als rechtsextrem
AfD reicht Klage gegen Verfassungsschutz ein – Höcke droht dessen Mitarbeitern
Stand: 05.05.2025 Lesedauer: 4 Minuten
AfD reicht wegen Hochstufung Klage gegen Verfassungsschutz ein
Nachdem der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft hat, gibt es Kritik an der Art und Weise der Veröffentlichung dieser Entscheidung. Jetzt reicht die AfD laut einem Parteisprecher Klage gegen den Verfassungsschutz ein.
Quelle: WELT TV
Laut Verfassungsschutz ist die AfD gesichert rechtsextrem. Gegen die Einstufung geht die Partei nun per Klage vor. Björn Höcke hatte seiner Wut via X Luft gemacht, den Post aber später wieder gelöscht.
Die AfD hat nach eigenen Angaben Klage gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) eingereicht. Ein entsprechendes Schreiben sei an das zuständige Verwaltungsgericht Köln verschickt worden, bestätigte der Sprecher von Parteichefin Alice Weidel, Daniel Tapp. In Köln hat das BfV seinen Sitz.
Das Bundesamt hatte am Freitag mitgeteilt, die Partei fortan als gesichert rechtsextremistisch einzustufen. Die AfD hatte die Behörde per Abmahnung bis heute, 8.00 Uhr, aufgefordert, dies zurückzunehmen und eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Anderenfalls werde eine schon vorbereitete Klage mit Eilantrag eingereicht. Der Verfassungsschutz antwortete nach AfD-Angaben nicht darauf.
Alice Weidel, Bundes- und Fraktionsvorsitzende der AfD, und Tino Chrupalla, AfD-Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der AfD, geben eine Pressekonferenz. Alice Weidel und Tino Chrupalla stehen an der Spitze der AfD. (zu dpa: «Chrupalla: Vielleicht müssen wir aus Fehlern lernen») +++ dpa-Bildfunk +++
Einstufung als rechtsextrem
Die Klage zum Nachlesen – So wehrt sich die AfD gegen den Verfassungsschutz
Mit der Klage versucht die Partei der Behörde nun gerichtlich zu untersagen, die AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einzuordnen, zu beobachten, zu behandeln, zu prüfen und/oder zu führen. In dem Abmahnungsschreiben hieß es, man halte sowohl diese Einstufung als auch die Bekanntgabe dieses Umstands für offensichtlich rechtswidrig.
Lesen Sie auch
ARD-Moderatorin
Trotz „so viel Vielfalt“ nicht „ALLE“ überzeugt – Moderatorin Reschke wirbt für AfD-Verbot
Björn Höcke hatte nach der Mitteilung des BfV einen Wutpost abgesetzt und den Mitarbeitern der Behörde gedroht. Bei X schrieb der thüringische AfD-Landesvorsitzende: „Man kann den Angestellten des VS nur dringend raten, sich eine neue Arbeit zu suchen. Am Ende wird es wie immer in der Geschichte heißen: Mitgehangen – mitgefangen.“
Inzwischen hat Höcke den Tweet gelöscht.
Die Gewerkschaft der Polizei hat die Äußerungen Höckes als „widerlich“ kritisiert. Der GDP-Vorsitzende Jochen Kopelke sagte der „Rheinische Post“, seine Gewerkschaft verurteile die versuchte Einschüchterung und Mobilisierung gegen diese Institution auf das Schärfste. Die Arbeit des Verfassungsschutzes sei unerlässlich für die Sicherheit und Stabilität Deutschlands.
Dobrindt skeptisch hinsichtlich AfD-Verbotsverfahren
Die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch durch den Bundesverfassungsschutz sei nicht überraschend, sagte der künftige Bundesinnenminister Alexander Dobrindt am Sonntag im ARD-Fernsehen. Aber ein Verbot einer Partei sei noch mal etwas ganz anderes. „Ich bin da skeptisch, weil das Aggressiv-Kämpferische gegen unsere Demokratie, das muss dann da noch ein Wesensmerkmal sein.“
Es gebe zu Recht hohe Hürden für ein Verbot einer Partei. „Deswegen bin ich der Überzeugung, man muss die AfD nicht wegverbieten, man muss sie wegregieren und sich deswegen über die Themen unterhalten, die die AfD groß gemacht haben“, fügte Dobrindt hinzu.
Teilnehmer einer linken Demonstration forderten im September ein AfD-Verbot
Quelle: Sebastian Willnow/dpa
Durch die Einstufung des BfV kann der Inlandsgeheimdienst alle nachrichtendienstlichen Mittel bei der weiteren Beobachtung der Partei einsetzen, die mittlerweile zweitstärkste Fraktion im Bundestag ist und damit die Opposition anführt. Für ein Partei-Verbot gelten aber weitaus höhere Hürden. Dafür reichen verfassungsfeindliche Bestrebungen, wie der Verfassungsschutz sie der AfD bescheinigt, nicht aus. Der Partei müsste auch nachgewiesen werden, dass sie „kämpferisch-aggressiv“ an der Umsetzung ihrer Ziele arbeitet. Ein AfD-Verbotsverfahren können nur die Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat anstrengen.
Dobrindt rechnet nicht damit, dass die AfD in Ausschüssen des Bundestages Mehrheiten für einen Vorsitzendenposten findet. „Ich zumindest werde unseren Mitgliedern im Deutschen Bundestag nicht empfehlen, für Ausschussvorsitzende der AfD zu votieren“, sagte Dobrindt. „Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die AfD sich schwertut, Mehrheiten zu finden.“ Den Vorsitz könnte die AfD als größte Oppositionsfraktion unter anderem für den wichtigen Haushaltsausschuss beanspruchen.
Ressort:Deutschland
Frank Werneke
Verdi-Chef fordert von Bund und Ländern Vorbereitung von AfD-Verbotsverfahren
Auch der künftige Unions-Fraktionschef Jens Spahn stellte klar, dass die AfD nicht mit Stimmen aus der Union rechnen könne. Zum Umgang mit der AfD in den parlamentarischen Abläufen würden Union und SPD in allen Fragen gemeinsam vorgehen, erklärte der CDU-Politiker über die Kurzmitteilungsplattform X: „Eine Empfehlung, AfD-Abgeordnete zu Ausschussvorsitzenden zu wählen, wird es von unserer Seite nicht geben.“ Spahn hatte jüngst noch gesagt, man solle mit der AfD wie mit jeder anderen Oppositionsfraktion umgehen.
Die AfD hält laut ihrer Fraktions- und Parteivorsitzenden Alice Weidel an ihrem Anspruch auf Posten fest. „Die AfD-Bundestagsfraktion wird weiterhin ihre Rechte einfordern und darauf bestehen, alle ihr zustehenden Ämter und Positionen zu besetzen“, sagte Weidel zu WELT.
Wüst: Verbot muss niet- und nagelfest sein
NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will die AfD vor allem politisch stellen. Nur mit einer „besseren Politik“ könne man Wähler von der AfD wegbekommen, den Einfluss der Partei langfristig verringern und den demokratischen Zusammenhalt stärken, sagte der Regierungschef dem WDR-Magazin „Westpol“. In der neu aufgeflammten Debatte um ein Verbotsverfahren betonte Wüst, das komme grundsätzlich nur in Betracht, wenn eindeutig feststehe, dass eine Partei freiheitliche demokratische Grundordnung aktiv bekämpfe. Im Vordergrund müssten die politischen Antworten stehen. Ein Verbotsverfahren dauere ohnehin Jahre. Entscheidend sei, was die Politik bis dahin mache.
dpa/Reuters/cvb
https://www.welt.de/
Update AfD reicht Klage gegen Verfassungsschutz ein: Höcke droht Behörden-Mitarbeitern – „mitgehangen – mitgefangen“
Björn Höcke hat Angestellten des Inlandsgeheimdienstes vor Konsequenzen gewarnt – und seinen X-Beitrag kurz darauf wieder gelöscht. Die AfD klagt gegen die Behörde.
05.05.2025, 10:30 Uhr
Die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz kommt in der Partei nicht gut an. Der Bundesvorstand will gegen das Bundesamt klagen. Björn Höcke, Chef des Landesverbands in Thüringen, hingegen drohte den Mitarbeitenden des Inlandsgeheimdienstes.
„Man kann den Angestellten des VS nur dringend raten, sich eine neue Arbeit zu suchen. Am Ende wird es wie immer in der Geschichte heißen: Mitgehangen – mitgefangen“, schrieb Höcke auf X, der Onlineplattform des Tech-Milliardärs Elon Musk. Kurze Zeit später löschte er seinen Beitrag allerdings wieder.
Im gleichen Beitrag zitierte Höcke zudem die Kritik des US-Außenministers Marco Rubio an der Einstufung der AfD. Dieser hatte am Freitag ebenfalls auf X geschrieben, Deutschland habe seiner Spionagebehörde gerade neue Befugnisse zur Überwachung der Opposition erteilt. „Das ist keine Demokratie – es ist eine verdeckte Tyrannei.“ Das Auswärtige Amt konterte unter dessen Beitrag: „Das ist Demokratie.“
AfD reicht nach eigenen Angaben Klage ein
Die AfD reichte inzwischen nach eigenen Angaben Klage gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) ein. Ein entsprechendes Schreiben sei an das zuständige Verwaltungsgericht Köln verschickt worden, bestätigte der Sprecher von Parteichefin Alice Weidel, Daniel Tapp. In Köln hat das BfV seinen Sitz.
Mit der Klage versucht die Partei der Behörde nun gerichtlich zu untersagen, die AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einzuordnen, zu beobachten, zu behandeln, zu prüfen und/oder zu führen.
In dem Abmahnungsschreiben heißt es, man halte sowohl die Einstufung als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ als auch die Bekanntgabe dieses Umstands für offensichtlich rechtswidrig. Das BfV bestätigte den Eingang des Schreibens, wollte dies aber nicht kommentieren.
Weidel kritisiert Innenministerin Faeser
Ungeachtet der Neubewertung der AfD durch den Verfassungsschutz hält die Bundespartei an ihrem Anspruch auf die Besetzung parlamentarischer Ämter fest. „Die AfD-Bundestagsfraktion wird weiterhin ihre Rechte einfordern und darauf bestehen, alle ihr zustehenden Ämter und Positionen zu besetzen“, sagte Ko-Chefin Alice Weidel der „Welt“ vom Montag mit Blick etwa auf die Besetzung von Ausschüssen. „Das gebietet schon der Respekt vor unseren Wählern.“
Lesermeinungen zum Artikel
„Auf jeden Fall ein weiterer Beweis dafür, dass diese Truppe niemals in eine Position gelangen darf, in der sie entscheiden kann, wer gefangen und/oder gehangen wird.“ Diskutieren Sie über folgenden Link mit derschoeneberger
„Interessant ist doch, dass sich aus der AfD zwar alle lautstark gegen die Entscheidung wenden, aber keiner die eigene Verfassungstreue unterstreicht.“ Diskutieren Sie über folgenden Link mit JohnDoe13
Weidel warb für „Fairness und Rechtstreue im Umgang mit der AfD-Fraktion“. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) kritisierte sie angesichts der am Freitag vorgelegten Einstufung der gesamten AfD als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz scharf.
Weidel sprach von „haltlosen Manövern und Behauptungen“. Das Vorgehen sei ein „Vorwand“, um die stärkste Oppositionsfraktion zu diskriminieren und ihr wesentliche parlamentarische Rechte vorzuenthalten und werde weder „rechtlich noch politisch dauerhaft durchzuhalten sein“, sagte Weidel.
Das könnte Sie auch interessieren:
„Angesichts der Einstufung als gesichert rechtsextrem“ Bundestagsabgeordneter tritt aus AfD aus
„Anti-etatistisch“ und „kulturelle Westbindung“ Frauke Petry kündigt Gründung neuer Partei an
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte am Freitag in Köln mitgeteilt, die AfD werde nun auch auf Bundesebene als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die Behörde begründete dies mit „der die Menschenwürde missachtenden, extremistischen Prägung der Gesamtpartei“. Das in der Partei vorherrschende Volksverständnis konkretisiere sich in einer insgesamt migranten- und muslimfeindlichen Haltung der Partei.(Tsp/AFP/dpa)
https://www.tagesspiegel.de/
Kommentar: Es gibt keine Alternative zur Geschichte
04.05.2025, 19:00 Uhr
Bildbeitrag
Politiker, die die NS-Zeit abhaken wollen, führen Deutschland in den Ruin. Sie zerstören das Fundament, auf dem die Demokratie entstanden ist. Aus der Geschichte lernen, heißt Deutschland schützen, kommentiert BR-Chefredakteur Christian Nitsche.
Von
Christian Nitsche
Über dieses Thema berichtet: Nachrichten am 04.05.2025 um 20:00 Uhr.
Sie wurden verhaftet, gedemütigt, gefoltert, vergast. Sie starben bei Todesmärschen. Sie wurden erschossen, auch sehr viele Kinder. Ihnen wurde, als sie ins Konzentrationslager gebracht wurden, als erstes gesagt: Hier kommt ihr hinein und dort geht ihr raus. Der Finger des Nazi-Teufels zeigte auf den Schlot. All das ist nicht vergangene Geschichte. Überlebende der KZ erzählen es Gott sei Dank immer wieder, auch heute in Dachau. Das Konzentrationslager wurde vor 80 Jahren befreit.
Aber nie hat Deutschland die menschenverachtende Ideologie der Nazis ganz abstreifen können. Sie wird bis heute immer wieder aktiviert und gepflegt. Und sie wird politisch gezielt verharmlost. 2018 sagte der AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland: "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte." Ein Vogelschiss? Wie hört sich das für die an, deren Familien vergast, erschossen und erschlagen wurden, die in grauenhaften Menschenversuchen ermordet wurden, die sich zu Tode schuften mussten und die man absichtlich an Hunger, Krankheiten und Seuchen zugrunde gehen ließ? Wenn man schon die lange Geschichte bemüht: Das war gestern! Unsere Geschichte kann man nicht abhaken. Sie bleibt.
Prüfen wir unsere Haltung
Wenn etwa 40 Prozent der 18- bis 29-Jährigen in einer Umfrage Anfang des Jahres allerdings angeben, nicht gewusst zu haben, dass etwa sechs Millionen Jüdinnen und Juden in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden, dann ist das eine ernste Mahnung. Und nicht nur der Geschichtsunterricht scheint zu wenig zu leisten. Sich heute noch bewusst zu erinnern, ist eine Sache der Einstellung. Anlässlich von 80 Jahren Kriegsende ist es auch Sache der Eltern und Großeltern, mit den Kindern über das zu reden, was geschehen ist.
Und die, die bei Wahlen und in Umfragen ihren Protest gegenüber einer Regierung ausdrucken wollen, sollten sich fragen, welchen Weg des Protestes sie gehen wollen? Eine Partei unterstützen, die nun vom Verfassungsschutz insgesamt als rechtsextremistisch eingestuft wird?
Erinnerung an NS-Zeit
Die AfD duldet Faschisten in ihren Reihen. Der AfD-Partei- und -Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla wich am Freitag im ARD-Brennpunkt der Frage aus, warum die AfD Matthias Helferich in ihre Bundestags-Fraktion aufgenommen hat. Ein Mann, der sich selbst als "das freundliche Gesicht des NS" bezeichnet hat. Auch in der Fraktion ist Maximilian Krah, der in einer italienischen Zeitung SS-verharmlosende Aussagen gemacht hatte. Die SS bewachte und führte unter anderem die Konzentrationslager. Eine Organisation von Verbrechern der niederträchtigsten und unmenschlichsten Sorte. Und Björn Höcke, der AfD-Landeschef in Thüringen, droht unverhohlen den Mitarbeitern des Verfassungsschutzes, "am Ende wird es wie immer in der Geschichte heißen: Mitgehangen – mitgefangen". Das erinnert sehr an die NS-Zeit.
Versäumnis demokratischer Parteien
Die AfD hat den Misserfolg der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung genutzt, sich als Anwalt der Menschen zu präsentieren. Zwar sagten zur Bundestagswahl 74 Prozent der Deutschen, die AfD distanziere sich nicht genug von rechtsextremen Positionen. Aber 55 Prozent sagten auch, die Partei habe besser als andere Parteien verstanden, dass sich viele Menschen nicht mehr sicher fühlen. Ein Versäumnis demokratischer Parteien, ja. Aber wenn wir anfangen, rechts- oder linksextreme Positionen zu schlucken, wenn wir wegsehen, gehen wir einen extrem gefährlichen Weg.
In den Ruin
Die AfD versucht immer wieder, den Eindruck entstehen zu lassen, sie sei der Retter der Demokratie. Das ist sie beileibe nicht. Wer in seinen Reihen Menschen duldet und schützt, die die deutsche Geschichte verharmlosen, der schützt nicht die Demokratie, die als Lehre aus der Machtergreifung der Nazis und als Konsequenz aus dem Holocaust entstanden ist. Solche Politiker versündigen sich an Deutschland, weil sie in die Gesellschaft eine Saat einbringen, die zurück in die dunkelste Zeit führt. Wir sahen ein zerstörtes Deutschland. Lernen wir daraus. Unser Land hat Millionen Menschen auf dem Gewissen. Vergessen wir das nie! Es gibt keine Alternative zur deutschen Geschichtsschreibung. Und es gibt auch keine andere Alternative für ein sicheres und wohlhabendes Deutschland als: Demokratie. Der Geist, den die AfD durchs Land wehen lässt, ist vergiftet. Er führt in den Ruin.
https://www.br.de/
Höcke tobt nach AfD-Einstufung – dann macht er kleinlaut einen Rückzieher
von Alexander Riechelmann
03.05.2025 - 20:57 Uhr
Björn Höcke wettert nach der AfD-Einstufung gegen den Verfassungsschutz. Doch dann zieht er sich schnurstracks zurück.
Alice Weidel: Das ist über ihre Partnerin Sarah Bossard bekannt
Mit ihrer Partei vertritt Alice Weidel antifeministische, nationalistische, homophobe und fremdenfeindliche Positionen - doch privat ist Weidel mit Sarah Bossard liiert. Das ist über sie bekannt.
Der Verfassungsschutz stuft die AfD bundesweit als gesichert rechtsextremistisch ein. Das bringt die Partei in Rage. Nicht nur die Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla beschwerten sich, auch der Thüringer Chef Björn Höcke meldete sich zu Wort. Seinen Beitrag in den sozialen Medien hat er zwar schnell wieder gelöscht, doch vergisst das Internet nichts.
AfD beschwert sich über Einstufung
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat bekannt gegeben, dass es die AfD nun als gesichert rechtsextremistisch einstuft. In einer ersten Reaktion kündigten die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla juristische Schritte an. Man werde sich gegen die „demokratiegefährdenden Diffamierungen weiter juristisch zur Wehr setzen“, hieß es in einer Mitteilung.
++ Dazu wichtig: AfD-Einstufung: Trump-Regime springt ihr bei – „Tyrannei“ ++
Auch Björn Höcke, Landeschef der AfD in Thüringen, schaltete sich ein. Auf der Plattform X zitierte er zunächst den US-Außenminister Marco Rubio, der die Einstufung aus Washington heraus kritisiert hatte: „Der US-amerikanische Außenminister äußert sich deutlich zur Zerstörung der deutschen Demokratie durch den Geheimdienst: Das ist keine Demokratie – es ist Tyrannei in Verkleidung.“
Höcke mit skandalösem Nachsatz
Doch damit nicht genug. Höcke legte in seinem Beitrag noch einen Satz nach, der für Empörung sorgte: „P.S.: Man kann den Angestellten des VS (Verfassungsschutz, Anm. der Red.) nur dringend raten, sich eine neue Arbeit zu suchen. Am Ende wird es wie immer in der Geschichte heißen: Mitgehangen – mitgefangen.“
Mehr News:
Klartext mit Beats: Carolin Kebekus macht Ernst – ihr Song „Blau“ ist mehr als nur Satire gegen die AfD.
Anti-AfD-Song: Kebekus kassiert Absagen von Schlager-Stars
AfD-Gutachten: Brisante Enthüllungen – auch Weidel kommt vor
Tino Chrupalla vor AfD-Banner am Rednerpult.
Tino Chrupalla privat: So lebt der AfD-Chef
Im Netz sorgte der letzte Satz des ehemaligen Geschichtslehrers für Wirbel. Viele User werteten die Formulierung als versteckte Drohung gegen Mitarbeitende des Verfassungsschutzes. Die Diskussion ging wohl auch am AfD-Mann nicht vorbei – er löschte wenig später seinen Beitrag. Dennoch kursieren weiterhin Screenshots seines Tweets.
https://www.derwesten.de/
Rechtsextremismus:
Höcke will den Bürgerkrieg
Ein "Zuchtmeister", der den "Stall ausmistet" mit "wohltemperierter Grausamkeit". Die Sprache des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke offenbart seine Gefährlichkeit.
Ein Gastbeitrag von Hajo Funke
24. Oktober 2019, 12:27 Uhr
Rechtsextremismus: Björn Höcke bei einem Wahlkampftermin in Brandenburg im August
Björn Höcke bei einem Wahlkampftermin in Brandenburg im August © John Macdougall/AFP/Getty Images
Höcke will den Bürgerkrieg – Seite 1
Aus Worten können Taten werden, daran haben Politiker wie Angela Merkel und Heiko Maas in der Diskussion über den Rechtsextremismus in Deutschland zuletzt immer wieder erinnert. Auch die Rhetorik des Thüringer AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke sollte an dieser Gefahr gemessen werden, mahnt der Berliner Rechtsextremismus-Forscher Hajo Funke. Im Gastbeitrag erläutert er, was er damit meint.
Vor etwas mehr als einem Jahr, am 1. September 2018, hat erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine im Bundestag vertretene Partei gemeinsame Sache mit Rechtsextremen und gewalttätigen Hooligans gemacht. Damals posierten die AfD-Politiker Björn Höcke und Andreas Kalbitz bei einem "Trauermarsch" für den in Chemnitz von einem Asylbewerber erstochenen Daniel H. Unmittelbar danach bildete sich die terroristische Vereinigung Revolution Chemnitz. Sie sollen im September 2018 in Chemnitz Menschen attackiert haben, die sie für Migranten hielten, und zudem einen Anschlag am Tag der Deutschen Einheit in Berlin geplant haben.
Hajo Funke
75, ist Rechtsextremismusforscher. Bis zu seiner Emeritierung 2010 lehrte er am Institut für Politische Wissenschaften der Freien Universität Berlin.
Am 2. Juni dieses Jahres ist dann der erste politische Mord von ganz rechts verübt worden: Ein in der Szene bekannter Rechtsextremist erschoss den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.
Am 9. Oktober wollte der Attentäter von Halle viele Gläubige in der jüdischen Synagoge erschießen. Als ihm das nicht gelang, tötete er wahllos zwei Passanten und sagt nun, er habe "die Falschen getroffen". Sein Anschlag auf die Synagoge hat die jüdische Nachkriegsgemeinschaft in Deutschland an ihrem höchsten jüdischen Feiertag erschüttert wie nie seit 1945. Wenn die Tür nicht gehalten hätte, wäre nichts mehr, wie es vor dem 9. Oktober war.
AfD und Nationalismus
Mehr zum Thema
AfD
:
Keine Scheu vor antisemitischen Positionen
AfD-Bilanz
:
Hauptsache Applaus
AfD-Beamte
:
Beamter und in der AfD – geht das?
Die Sicherheitsbehörden sind angesichts dieser Ereignisse inzwischen erkennbar erschüttert. Können sie noch ausreichend für Sicherheit sorgen? Und fast drei Viertel der bundesdeutschen Bevölkerung machen die Hetzer von rechts, aus der AfD, für diese Entwicklung mitverantwortlich.
Ich finde: zu Recht. Dies gilt – zuallererst – für Björn Höcke, den AfD-Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in Thüringen an diesem Sonntag, und dem von ihm geführten Flügel der Partei. Man muss sich seine Rhetorik nur einmal genau anschauen.
"Wohltemperierte Grausamkeit": Das Programm Björn Höckes
In seinem Buch Nie zweimal in denselben Fluss, das Mitte 2018 erschien, beschwört Höcke einen "Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch" und damit die zentrale Verschwörungstheorie der Neuen Rechten um Götz Kubitschek und die Identitären. Als zentrales Ziel seiner Partei fordert Höcke eine Säuberung Deutschlands von "kulturfremden" Menschen. Darunter versteht er, in aller Pauschalität, Asiaten und Afrikaner. Höcke schreibt: "Neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein." Er will also Millionen Bürger aus dem Land verbannen.
Dieses "Remigrationsprojekt", so schreibt es Höcke, sei wohl nur mit Gewalt zu schaffen: "In der erhofften Wendephase", (offenkundig meint er einen Machtantritt der AfD), "stünden uns harte Zeiten bevor, denn umso länger ein Patient die drängende Operation verweigert, desto härter werden zwangsläufig die erforderlichen Schnitte werden, wenn sonst nichts mehr hilft." Und: "Vor allem eine neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannungen auszuhalten haben: Sie ist den Interessen der autochthonen Bevölkerung verpflichtet und muss aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen." Man werde – so heißt es bei Höcke weiter wörtlich –, "so fürchte ich, nicht um eine Politik der 'wohltemperierten Grausamkeit' herumkommen. Existenzbedrohende Krisen erfordern außergewöhnliches Handeln. Die Verantwortung dafür tragen dann diejenigen, die die Notwendigkeit dieser Maßnahmen mit ihrer unsäglichen Politik herbeigeführt haben." (Seite 254 ff.)
Rechtsextremismus: Höcke will den Bürgerkrieg
Newsletter
Was jetzt? – Der tägliche Morgenüberblick
Starten Sie mit unserem kurzen Nachrichten-Newsletter in den Tag. Erhalten Sie zudem freitags den US-Sonderletter "Was jetzt, America?" sowie das digitale Magazin ZEIT am Wochenende.
Registrieren
Höcke erklärte schon 2014, was er meint, wenn er Friedrich Hegel zitiert: "Brandige Glieder könnten nicht mit Lavendelwasser kuriert" werden: Seine Regierung sei lediglich und allein der autochthonen, übersetzt also der ethnisch-deutschen Bevölkerung verpflichtet. Es handelt sich um eine Vorstellung ethnischer Homogenität, die wie die Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz Anfang dieses Jahres zum Flügel der AfD betont, verfassungsfeindlich und rassistisch ist. Höcke will dieses Weltbild notfalls mit Grausamkeit durchsetzen. Sollte seine Partei in Thüringen regieren, würde das bedeuten, der Parole zu folgen, die Alexander Gauland nach der Bundestagswahl 2017 ausgerufen hat: "Wir werden sie jagen."
Die "nicht willfährigen" Deutschen
In seinem Buch stellt Höcke auch fest, dass "wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind" mitzumachen." Er denke an einen "Aderlass". Diejenigen Deutschen, die seinen politischen Zielen nicht zustimmten, würden aus seinem Deutschland ausgeschlossen werden. Er trete für die Reinigung Deutschlands ein. Mit "starkem Besen" sollten eine "feste Hand" und ein "Zuchtmeister" den "Saustall ausmisten".
Schon in der Weimarer Republik wurde aus Sprache Gewalt
Aktuell befinden wir uns nach Höcke "im letzten Degenerationsstadium" der Demokratie, der Pöbelherrschaft einer sogenannten "Ochlokratie". Durch das "multikulturelle Großprojekt" sei Deutschland zerrüttet und dem Untergang ausgeliefert und die gegenwärtige liberale politische Verfassung ein "freiheitsfeindliches Machtgebilde". Diesem "Verhängnis" will Höcke nach eigenen Worten Einhalt gebieten. Ansonsten sei ein neuer Karl Martell (der Verteidiger Europas gegen den Islam in einer Schlacht vor 1.200 Jahren) und eine (militärische) "Rückeroberung" aus einer "Ausfallstellung" heraus nötig, um Europa zu retten.
Konsequenterweise antwortet Höcke auf die Frage, ob ein Volk sich selber aus dem Sumpf ziehen könne, mit Machiavelli: Ein "Uomo virtuoso" könne "als alleiniger Inhaber der Staatsmacht ein zerrüttetes Gemeinwesen wieder in Ordnung bringen" (Seite 286 seines Buchs).
Landtagswahl in Thüringen
Mehr zur
Morddrohungen im Wahlkampf
:
E-Mails voller Hass
Mike Mohring
:
Auf die Mütze
Bodo Ramelow
:
Bloß nicht zu links rüberkommen
Wenn wir Höcke also an seiner Sprache messen, so geht es ihm um eine nicht nur ethnische, sondern auch politische "Säuberung" und um das Einsetzen staatlicher Gewalt gegen beliebig definierte Feinde. Er suggeriert mit dieser Sprache auch einen künftigen Kampf zwischen denen, die anders denken und seinen Anhängern, er will offensichtlich den Bürgerkrieg in Dörfern und Städten in Deutschland. Es ist eine Strategie der Entfesselung und der Aufschaukelung von Ressentiments und Gewalt.
Erinnerung an Weimar
Worte können zu Gewalt führen. Wir wissen aus den Krisen der frühen Weimarer Republik, welche Gewalt in der Sprache enthalten ist, wenn sie sich programmatisch gegen "Andere" richtet. Vor genau 100 Jahren, lange vor der Abfassung von Mein Kampf durch Adolf Hitler 1924, hatte der politische Agitator in einem Brief an Adolf Gemlich sein programmatisches Ziel einer antijüdischen Politik definiert: Kurzfristig müssten die Juden ihrer Bürgerrechte beraubt werden. "Das letzte Ziel aber muss unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein." (Vgl. Saul Friedländer: Das Dritte Reich und die Juden, Bd. I, 2006: 86)
Ob Rückblicke auf die Epoche des Faschismus zur Kennzeichnung der Vorstellungen des Flügels der AfD dienlich sind, mag umstritten sein. Wir verstehen unter Faschismus ein mythisches Nationsverständnis, das eine Massenbewegung mit allen Mitteln – auch denen der Gewalt und damit jenseits demokratisch-rechtsstaatlicher Verfahren – durchsetzen will und hierzu auf eine autoritäre beziehungsweise totalitäre politische Strategie (Führerprinzip) zurückgreift. Einem solchen Verständnis folgt, nachzulesen in seinen eigenen Worten, Björn Höcke.
https://www.zeit.de/
+++
Das ZDF und Björn Höcke: der richtige Umgang?
von Nils Altland & Inga Mathwig
Stand: 18.09.2019 19:00 Uhr
Ein Interview des ZDF mit Björn Höcke macht in dieser Woche Schlagzeilen: Es sollte "fester Bestandteil des Lehrplans in allen Journalistenschulen sein", fordert "SZ"-Redakteur Simon Hurtz auf Twitter:
Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.
Gleichzeitig gibt es scharfe Kritik von AfD-Mitgliedern: "Da trickst der Journalist, da führt der Sender seine Zuschauer gezielt hinters Licht", moniert der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl.
Dabei verlief das Interview anders als geplant: Eigentlich wollte der ZDF-Autor mit Björn Höcke über dessen Sprache und Demokratieverständnis sprechen. Doch nach etwa zehn Minuten bricht der Sprecher des Thüringer AfD-Chefs das Interview unvermittelt ab. Höcke sei durch die Fragen "emotionalisiert worden".
Zu Beginn des Interviews spielte das ZDF Björn Höcke eine Umfrage vor. Die Journalisten hatten AfD-Politikern im Bundestag Zitate vorgelesen und gefragt, ob diese Zitate von ihrem Parteikollegen Höcke oder von Adolf Hitler seien. Die Politiker konnten oder wollten diese Zitate nicht einordnen. Dabei stammen alle aus Björn Höckes Buch "Nie zweimal in denselben Fluss".
"Der Vergleich muss erlaubt sein"
Shakuntala Banerjee, Redakteurin der Sendung "Berlin direkt", hat das Interview mitverantwortet. Der Einstieg sei hart, räumt sie ein. Aber besonders freundlich zu sein, sei nicht Aufgabe der Journalisten: "Wir setzen uns mit einem Aspekt von Höckes Politik und Politikstil auseinander, den er persönlich immer wieder wählt. Und den er persönlich immer wieder vorträgt. Der Vergleich muss erlaubt sein."
Ob Höckes Pressesprecher, Günther Lachmann, das Interview nach etwa zehn Minuten abbrach, weil ihm schon die Umfrage nicht ins Konzept passte, bleibt bislang offen. Ein Interview lehnte er ab. Auch schriftliche Fragen von ZAPP ließ Lachmann unbeantwortet.
Journalistik-Professor Bernd Gäbler beschäftigt sich wissenschaftlich mit der AfD und deren Medienstrategie. Er meint, Lachmann habe einen Vorwand gesucht, um das Gespräch abzubrechen: "Ich glaube, Lachmann merkte, dass das in eine Richtung lief, die er insgesamt nicht haben wollte - also: 'Du bist jetzt mehr oder weniger einer, der parallele Überschneidungen zur NS-Ideologie zulässt'".
Erst am Ende außer Fassung
Höckes Pressesprecher hatte den ZDF-Reporter aufgefordert, das Interview zu wiederholen, was dieser verweigerte. Während Pressesprecher und ZDF-Reporter hinter der Kamera miteinander diskutieren, bleibt das Bild auf Höcke, der ruhig dasitzt und Lachmann vorerst machen lässt. Als der Abbruch des Interviews aber beschlossen ist, droht Höcke dem ZDF-Mann: "Passen Sie auf. Wir beenden das Interview, nur, dann ist klar … Wir wissen nicht, was kommt … Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird ... Vielleicht werde ich auch mal eine interessante politische Person in diesem Land - könnte doch sein."
ZDF stellt ganzes Interview online
Das ZDF entschied sich, das Interview zu senden und ins Netz zu stellen, obwohl Höckes Pressesprecher das untersagt hatte. Banerjee: "Das ist nicht selbstverständlich, dass man dieses Material verwenden kann, nachdem jemand gesagt hat, lassen Sie uns hier unterbrechen. Da muss schon ein besonderes Informationsbedürfnis vorliegen. Wir sind der Ansicht, dass dieses besondere Informationsbedürfnis vorlag." Es verdeutliche nämlich Björn Höckes Verhältnis zur Pressefreiheit.
Trotzdem gelingt es dem ZDF nicht, dass die Transparenz auch zu einem Verständnis bei allen Zuschauern führt. "Es ist nicht unsere Aufgabe, bestimmte Leute von einer bestimmten Haltung zu überzeugen", so Banerjee. "Und die Polarisierung, die entsteht natürlich in der Gesellschaft, die ist zum Teil schon da." Komplett auf Interviews mit AfD-Politikern zu verzichten kommt allerdings nicht infrage. Auch Gäbler meint, es werde künftig immer schwieriger, mit der Polarisierung umzugehen: "Aber es gibt keine andere Möglichkeit, als da gründlich zu argumentieren."
Während der ZDF-Liveübertragung von den Landtagswahlen halten Menschen ein Plakat mit der Aufschrift "Rassisten sind keine Alternative" in die Kamera. © ZDF
Wahlabend im ZDF: Ein Plakat für Millionen
"Rassismus ist keine Alternative" - so lautete die Botschaft der 19-jährigen Hanna. Mit einem Plakat vor dem ZDF-Wahlstudio, erreichte sie ein Millionenpublikum.
Kanzlerin Merkel sitzt auf einer Bühne.
Stralsund: Merkels Antwort auf Rechtsaußen
Bundeskanzlerin Merkel konterte neulich bei einer Fragerunde überzeugend die Vorwürfe eines AfD-Politikers. Eine Kommunikationsstrategie, die Experten loben.
Dieses Thema im Programm:
ZAPP | 18.09.2019 | 23:20 Uhr'
https://www.ndr.de/
Update Björn Höcke bricht ZDF-Interview ab: Erst gibt er das Opfer, dann droht er dem Journalisten
Ein konfrontatives Interview im ZDF endet so, wie es dem thüringischen AfD-Rechtsaußen passen dürfte: mit dem, was man Eklat nennt. Eine Analyse.
Von Ingo Salmen
16.09.2019, 10:45 Uhr
Provozieren, austeilen und harmlos dabei wirken, in bürgerlichem Gewand: Das ist ein Rezept, mit dem AfD immer wieder Erfolg hat und Unterstützer sammelt. Das, was aus guten Gründen seit Jahrzehnten nicht mehr gesagt wird, doch aussprechen und trotzdem bieder daherkommen – darauf versteht sich auch Björn Höcke.
Der thüringische Rechtsaußen innerhalb der Rechtsaußen-Partei AfD hat das jetzt wieder bewiesen: In einem ZDF-Interview, in dem er erst das Opfer und dann die Stimme der Vernunft gab - um danach dem Journalisten, der ihm gegenüber saß, zu drohen und schließlich das Gespräch vorzeitig zu beenden. Schon ist von einem Eklat die Rede.
Björn Höcke dürfte das gefallen. Denn in Thüringen ist am 27. Oktober Landtagswahl, Höcke der Spitzenkandidat der AfD. Und wenn es gegen „die Medien“ ging, haben sich die Reihen auf der Rechten meist noch geschlossen. Ein Skandälchen kommt da gerade passend.
Das ZDF hat das Interview am Sonntagabend in der Sendung "Berlin direkt" ausgestrahlt (hier Video und Wortlaut). Geführt wurde es bereits am Mittwoch in Erfurt.
Es begann gleich konfrontativ: Redakteur David Gebhard hatte Parteifreunde Höckes mit einem Zitat konfrontiert: "Ein paar Korrekturen und Reförmchen werden nicht ausreichen, aber die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen, dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt." Damit verband er die Frage: "Ist das aus 'Mein Kampf' oder von Herrn Höcke?"
Jens Maier, Bundestagsabgeordneter und Mitglied des völkischen "Flügels" der Partei, lachte auf, als er das hörte. Und sagte dann: "Wenn, eher aus 'Mein Kampf', würde ich sagen, aber nicht von Herrn Höcke." Gebhard konfrontierte noch weitere AfD-Politiker mit diesem und einem weiteren Zitat. So recht festlegen wollten sie sich nicht. Beide Zitate stammten tatsächlich aus einem Buch Höckes. Damit war das Thema gesetzt: der Sprachgebrauch des Spitzenkandidaten, der immer wieder auf Bilder und Formulierungen aus der Nazi-Zeit zurückgreift.
Höcke selbst nannte das im Gespräch "originell". Politiker müssten "auch eine Sprache verwenden, die manchmal vielleicht etwas zu sehr ins Poetische geht". Gebhard erinnerte den Geschichtslehrer Höcke daran, dass das, was er "poetisch" findet, oft Begriffe mit direkten NS-Bezügen seien, wie "Lebensraum", "Keimzelle des Volkes", "entartet" oder "Volksverderber". Selbst ein Gutachten seiner eigenen Partei habe Höcke "Wesensverwandtschaften mit dem Nationalsozialismus" attestiert.
Das Verharmlosen erreichte jetzt seinen Höhepunkt: "Also, dieses permanente Rekurrieren auf den NS ist etwas abwegig in dem Zusammenhang, muss man sagen", wandte Höcke ein. "Ja, was ist alles NS? Wer definiert, was NS ist? Ich glaube nicht, dass es eine allgemein gültige Definition dessen gibt, was NS-Diktion, was NS-Sprache ist, ja." Schließlich habe sich die deutsche Sprache "in den letzten 75 Jahren auch weiterentwickelt".
Höcke nahm die Begriffe damit aus ihrem Kontext: Es habe sie vor der Zeit des Nationalsozialismus und danach gegeben. Inzwischen seien es "das alles Kampfbegriffe, die von einem politisch-medialen Establishment so definiert werden und damit – ja – dem Sprachgebrauch entzogen werden sollen, um ein politisches Ziel zu erreichen", sagte der AfD-Politiker. Es gebe eine Tendenz in Deutschland, "die Sprach- und Meinungskorridore immer weiter zu verengen".
Was er nicht sagte: dass Ausdrücke wie "Lebensraum" und "entartet" seit Jahrzehnten völlig selbstverständlich als nationalsozialistischer Sprachgebrauch gelten. Die von Höcke postulierte "Weiterentwicklung" von Sprache ist hier tatsächlich eine Rückentwicklung.
Zehn Minuten drehte sich das Interview um dieses Thema. Als Gebhard auf Höckes Demokratieverständnis zu sprechen kommen wollte, ging der AfD-Sprecher hinter der Kamera dazwischen. "Das geht so nicht. Sie haben jetzt Herrn Höcke mit Fragen konfrontiert, die ihn stark emotionalisiert haben", wandte Günther Lachmann, ein Ex-Journalist, ein. Diese Emotionen "sollte man so nicht im Fernsehen bringen". Sein Vorschlag: alles noch mal von vorn. Und außerdem sei das alles nicht so abgesprochen gewesen – was Gebhard bestritt: "Ich hatte gesagt, es geht nicht um Thüringen. Es geht um die bundespolitische Bedeutung von Herrn Höcke. Es geht um seine Sprache und sein Politikverständnis. Und da sind wir gerade dabei."
Ausgerechnet Höcke ruft zur Mäßigung
Höcke, anscheinend von seinem Sprecher falsch gebrieft, gebärdete sich jetzt in staatsmännischer Vernunft. "Das ist nicht seriös", schaltete er sich wieder ein. "Ich bin auch gerne bereit, unangenehme Fragen zu beantworten, aber das geht so nicht." Ausgerechnet der AfD-Politiker mahnte nun zur Mäßigung in einer gespaltenen Gesellschaft. "Wissen Sie, wir leben doch in einer Lage, die sowieso schon polarisiert ist. Wollen Sie da wirklich so'n Ding noch raushauen?" Auch eine Anspielung auf die "Lügenpresse"-Rufe ließ er nicht aus: "Ich meine, Sie sind doch als öffentlich-rechtlicher Sender auch stark in der Kritik. Sie spüren doch, wie in diesem Land gerade was erodiert."
Der ZDF-Journalist lehnte eine Wiederholung des Gesprächs jedoch als unüblich ab. Wenn Höcke das Gespräch beenden wolle, dann könne man es beenden. Womit die nächste Phase begann: die der Drohungen. "Passen Sie auf, dann haben wir ein manifestes Problem", sagte der AfD-Politiker. "Und dann wird das entsprechende Konsequenzen haben. Ich kann Ihnen sagen, dass das massive Konsequenzen hat - in der vertraulichen Zusammenarbeit zwischen Politiker und Journalist." Der AfD gegenüber seien Journalisten nicht neutral, sondern hätten anscheinend einen "politischen Auftrag". Höcke beklagte eine "typische Verhörsituation". ZDF-Journalist Gebhard darauf: "Das ist keine Verhörsituation, das ist ein Interview."
Das ist es offenbar nur so lange, wie die Fragen dem Politiker genehm sind. "Sie hätten doch eigentlich mit schönen Sachfragen zur Landespolitik einsteigen können und Sie hätten ja die Fragen dann am Ende, wenn wir im Laufen waren, noch mal vielleicht stellen dürfen", sagte Höcke. "Aber direkt wieder diese alte Chose, ich kann's auch nicht mehr hören, ich kann's nicht mehr hören."
Für den Journalisten gab es nun zwei Möglichkeiten: das Gespräch zu beenden oder an der abgebrochenen Stelle fortzusetzen. "Wir beenden das Interview", entschied Höcke. "Nur dann ist klar - wir wissen nicht, was kommt -, dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird."
Ob das eine Drohung sei, wollte Gebhard wissen. "Nein, das ist nur eine Aussage, weil ich auch nur ein Mensch bin. Ich bin auch nur ein Mensch, verstehen Sie?", erklärte Höcke. Und was "kommen" könnte? "Vielleicht werde ich auch mal eine interessante politische Person in diesem Land, könnte doch sein." Am Ende blieb Höcke wolkig. Seine Anhänger dürfen sich ausmalen, was er da gemeint hat.
Unterstützung vom Journalistenverband
Gebhard bekam für sein Vorgehen Rückendeckung vom Journalistenverband DJV. Höcke habe "ein weiteres dunkles Kapitel des gestörten Umgangs der AfD mit der Pressefreiheit im Allgemeinen und kritischen Journalistinnen und Journalisten im Besonderen aufgeschlagen", sagte DJV-Chef Frank Überall. Es sei völlig richtig gewesen, dass sich Gebhard nicht darauf eingelassen habe, das Interview in Höckes Sinn weichzuspülen.
Soziologe Wilhelm Heitmeyer „Die AfD ist ein Meister der emotionalen Ausbeutung“
"Der Abbruch des Gesprächs durch den Interviewten zeigt, dass er auf kritische Fragen keine intelligenten Antworten hat", sagte Überall: "Herr Höcke hat die Schwelle von der Demokratie zu faschistischen Fantasien überschritten."
https://www.tagesspiegel.de/
AfD-Mann Höcke bricht ZDF-Interview ab – mit einer Drohung
Dem AfD-Mann Björn Höcke haben die Fragen in einem ZDF-Interview nicht gefallen.
Das ZDF konfrontiert den AfD-Mann Björn Höcke in einem Interview mit eigenen Zitaten. Das Gepräch endet im Eklat und mit einer Drohung von Höcke.
15.09.2019, 20:22 Uhr
Berlin. „Noch Höcke oder schon Hitler“ – diese provokante Frage stellte ein Interviewer der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ mehreren AfD-Parteifreunden von Björn Höcke. Die wollen sich angesichts von Zitaten nicht festlegen, die tatsächlich aus „Mein Kampf“ stammen könnten – es aber nicht tun. Zum Beispiel: „Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen, dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt.“ Mit diesen Einspielern beginnt das Interview mit Björn Höcke, dem thüringischen AfD-Chef, das später im Eklat endet.
Das Gespräch wurde am vergangenen Mittwoch in Erfurt geführt. Das ZDF hat das komplette Interview und den Wortlaut online gestellt.
Das komplette Interview ist in der ZDF-Mediathek zu sehen.
Im Gespräch selbst verteidigt Höcke zunächst seine Sprache. Viele Deutsche trauten sich nicht mehr, ihre Meinung zu bestimmten Themen öffentlich zu äußern – er wolle das ändern. „Dieses Land leidet unter der Herrschaft der politischen Korrektheit.“
Höcke will nicht über seine eigene Sprache reden
Kurz darauf ist aus dem Off eine Stimme zu hören, die den Interviewer kritisiert – offenbar von einem Mitarbeiter Höckes. Die Fragen seien zu emotionalisiert, „das geht so nicht“. Höcke selbst nennt daraufhin den Einspieler mit seinen Zitaten „nicht redlich“. Die beiden Männer fordern einen Neustart für das Interview, der ZDF-Mitarbeiter lehnt das ab. Es folgt ein Streit über die Inhalte des Interviews und Absprachen, die zuvor getroffen worden seien. Den AfD-Männern gefällt nicht, dass zu lange über die Sprache und Zitate Höckes geredet wird. „Das ist nicht seriös“, meint Höcke, bevor er zu einer generellen Kritik an den öffentlich-rechtlichen Sendern ausholt.
Mehr lesen: Gauland wirft Steinmeier vor, AfD ausgrenzen zu wollen
Der Interviewer schlägt schließlich vor, das Gespräch an dieser Stelle zu beenden. „Dann haben wir ein manifestes Problem – und dann wird das massive Konsequenzen haben“, antwortet Höcke: für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Politikern und Journalisten, meint Höcke danach. Verlässliche Absprachen über Inhalte eines Interviews seien nötig, damit er sich ordentlich vorbereiten könne – er habe gerade eine anstrengende, fünf Stunden lange Sitzung hinter sich und sei nicht bereit für eine solche „Verhörsituation“.
Höcke: „Wir beenden das Interview“
Den Hinweis, dass dies kein Verhör, sondern ein Interview sei, lassen die AfD-Männer nicht gelten. Stattdessen schlagen sie ein weiteres Mal einen Neustart für das Gespräch vor, was der ZDF-Mitarbeiter erneut ablehnt, stattdessen möchte er das Interview an dieser Stelle weiterführen.
Dann reicht es Höcke: „Wir beenden das Interview.“ Und dann folgt etwas, was kaum anders als eine Drohung zu verstehen ist: „Wir wissen nicht, was kommt“, sagt Höcke. „Aber dann ist klar, dass es für Sie mit mir kein Interview mehr geben wird.“
Auf die Frage „Ist das eine Drohung?“ antwortet Höcke: „Nein, das ist eine Aussage. Vielleicht werde ich auch mal eine interessante politische Person in diesem Lande.“
Damit endet das Gespräch. Höcke steht auf und verabschiedet sich mit Handschlag und vermutlich nicht ganz ernst gemeinten Glückwünschen für die weitere Karriere des Journalisten.
Sophie Mühlmann, NDR, Zu politischen Themen auf dem Evangelischen Kirchentag in Hannover
03.05.2025, 18:23 Uhr
Mehr lesen: Grönemeyer poltert gegen rechts – AfD vergleicht ihn mit Goebbels
pach/RND
https://www.rnd.de/
+++
Prozess gegen Björn Höcke
Höcke habe eine „Säuberung der Rechtspflege“ angedroht, sagt der Staatsanwalt
Autorenprofilbild von Frederik Schindler
Politikredakteur
Veröffentlicht am 29.06.2024Lesedauer: 5 Minuten
Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke steht erneut wegen der Verwendung einer verbotenen Nazi-Parole vor Gericht. Wieder geht es um den Spruch der Sturmabteilung (SA) aus der NS-Zeit. WELT-Reporter Lutz Stordel begleitet den Prozess in Halle.
Quelle: WELT TV
Die Staatsanwaltschaft wirft Björn Höcke vor, das Prinzip der Gewaltenteilung abzulehnen. Der AfD-Landeschef wiederum behauptet einen „Schauprozess“ gegen sich. Seine Verteidiger wollen das Gutachten eines Historikers verlesen lassen, der in rechtsextremen Verlagen publiziert.
In einem Schauprozess zur Verfolgung politischer Gegner steht eine Verurteilung des Angeklagten bereits vorher fest. Er wird für Zwecke der Propaganda durchgeführt und dient zur Ausschaltung missliebiger Dissidenten. Die Angeklagten solcher Prozesse haben keine Möglichkeit zur Verteidigung und werden oft unter Folter zu Geständnissen gezwungen. Ein Schauprozess dient nicht der Herstellung von Gerechtigkeit, sondern der Sicherung von Herrschaft.
Die historische Forschung nennt unter anderem Prozesse des nationalsozialistischen Volksgerichtshofs sowie Prozesse gegen die politischen Gegner Stalins in der Sowjetunion und deren Satellitenstaaten als Beispiele.
Mit dem Gerichtsverfahren gegen den AfD-Politiker Björn Höcke, das am Mittwoch vor dem Landgericht Halle fortgesetzt wurde, haben diese Beispiele nichts zu tun. Höcke hat mehrere Verteidiger, muss sich nicht selbst belasten, kann Einsicht in die Ermittlungsakten nehmen, Zeugen befragen, Beweisanträge stellen, sich zu jedem Zeitpunkt erklären und das Urteil durch ein höheres Gericht überprüfen lassen.
Bericht vom Prozessauftakt
Björn Höcke (AfD)
AfD-Landeschef vor Gericht
„Ich möchte Sie bitten, Ihre Worte besser zu wägen“, sagt Höcke zum Staatsanwalt
Höcke schwört seine Anhänger dennoch darauf ein, dass die Verhandlung in Halle nicht rechtsstaatlich sei. „Wenn die AfD an der Regierung ist, werden diese politischen Schauprozesse aufgearbeitet werden, dann wird es wieder eine neutrale Justiz geben“, kündigte er in einem am Montagabend auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Video an. In dem „ach so freien Deutschland“ gebe es „Maulkorbparagrafen, die uns als Oppositionelle mehr oder weniger den Einsatz für dieses Land unmöglich machen“, behauptet er dann.
Anzeige
Am Mittwochmorgen kommt Höcke dann mit zwei Verteidigern in den Saal, die von ihren Rechten den ganzen Tag über umfangreich Gebrauch machen werden. Im selben Saal war Höcke bereits im Mai zu einer Geldstrafe verurteilt worden, da er am Schluss einer Wahlkampfrede die Losung „Alles für Deutschland“ verwendet hatte, die auch die NSDAP-Kampforganisation SA zur Selbstdarstellung nutzte.
Erster Prozess
Björn Höcke vor dem Landgericht Halle: „Ich habe ein reines Gewissen“
Urteil gegen Björn Höcke
„Der augenscheinlich fundierte NS-Wortschatz des Angeklagten deutet auf Täterwissen hin“
Bereits in den Jahren zuvor hatte der Thüringer AfD-Chef in zahlreichen Reden nationalsozialistisches Vokabular verwendet. „Sie sind ein redegewandter und intelligenter Mann, der weiß, was er sagt“, hatte der Vorsitzende Richter Jan Stengel bei der Urteilsbegründung im Mai ausgeführt.
In diesem Prozess wird Höcke vorgeworfen, das Publikum einer AfD-Veranstaltung in Gera im Dezember 2023 durch eine auffordernde Handbewegung „veranlasst“ zu haben, „den Wahlspruch der nationalsozialistischen SA“ zu vollenden, wie es in der am Montag verlesenen Anklage heißt.
Das auf Telegram veröffentlichte Video hält ihm am Montag der Staatsanwalt Benedikt Bernzen vor. „Statt Einsicht und Reue zu zeigen, kündigt der Angeklagte einen persönlichen Rachefeldzug gegen die an den Strafverfahren beteiligten Justizangehörigen an“, sagt er während der Begründung eines Beweisantrags. Höcke habe eine „Säuberung der Rechtspflege“ angedroht sowie verdeutlicht, dass er das Prinzip der Gewaltenteilung ablehne und damit ein Demokratieverständnis zum Ausdruck gebracht, „das sich mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung schlechterdings nicht vereinbaren lässt“.
„Diese Interpretation war infam“, sagt Höcke
Höckes Verteidiger Ralf Hornemann reagiert deutlich. „Dieser Vorwurf ist für mich eine Schweinerei, unjuristisch gesprochen“, sagt er. Und auch Höcke selbst reagiert: „Diese Interpretation aus Ihrem Munde war infam“, sagt er. In seinem Video sei es lediglich darum gegangen, ähnlich wie der Deutsche Richterbund die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften zu kritisieren.
Beweisanträge stellen am Montag auch Höckes Anwälte Hornemann und Florian Gempe. Mit einem historischen Gutachten wollen sie beweisen, dass die Losung „Alles für Deutschland“ von verschiedenen politischen Strömungen genutzt worden sei, auch von Sozialdemokraten, Nationalliberalen „sowie in Mitteldeutschland von der SED“ (Hornemann).
Höcke-Verteidiger Florian Gempe (l.) und Ralf Hornemann
Quelle: Getty Images/Jens Schlueter
Zudem beantragen sie, den NS-Propagandafilm „Triumph des Willens“ von Leni Riefenstahl in Augenschein zu nehmen. Dadurch solle bewiesen werden, dass die Parole zwar eine sichtbare Aufschrift beim NSDAP-Reichsparteitag 1934 gewesen, aber „keineswegs ein Symbol der SA“ gewesen sei. Die Parole „Alles für Deutschland“ war auf der Klinge des SA-Dienstdolchs eingraviert, der Teil der SA-Uniform war. In der NSDAP-Zeitschrift „Der SA-Führer“ wurde sie als „hohes und heiliges Gesetz der SA“ bezeichnet. In der Neonazi-Szene ist sie bis heute präsent.
Lesen Sie auch
Ressort:Literatur
Dietrich & Riefenstahl
Marlene folgte den US-Truppen, Leni umgarnte Hitler
„Ob die Parole auch vor Gründung der SA oder gar von NS-Gegnern verwendet wurde, ist aus Rechtsgründen für den Sachverhalt bedeutungslos“, erwidert die Staatsanwältin Viola Knatz.
Die Verteidiger beantragen außerdem die Verlesung mehrerer Bücher, darunter das Werk „Vokabular des Nationalsozialismus“ von Cornelia Schmitz-Berning. Darin werde die Formel nicht erwähnt und deshalb sei bewiesen, dass diese im NS-Vokabular keine Rolle gespielt habe. Dass in dem Buch auch etwa die Losungen „Arbeit macht frei“ sowie „Jedem das Seine“ nicht besprochen werden und es sich folglich um eine Auswahl handelt, erwähnen die Anwälte nicht.
Gempe beantragt außerdem die Verlesung eines Gutachtens des Historikers Franz Seidler vom April dieses Jahres, mit dem bewiesen werden solle, dass die Losung „keine besondere Bedeutung“ für die SA gehabt hätte. „Franz Seidler tritt mit geschichtsrevisionistischen Thesen auf und publiziert in rechtsextremen Verlagen“, erwidert die Anklägerin Knatz. Es sei „befremdlich“, dass die Verteidigung „einen offensichtlichen Geschichtsrevisionisten als Experten präsentiert“.
Tatsächlich veröffentliche Seidler zahlreiche Werke in Verlagen des Rechtsextremisten Dietmar Munier sowie Artikel in mehreren rechtsextremen Zeitschriften. Namhafte Fachkollegen warfen Seidler vor, „bemerkenswert deutlich den Mustern der NS-Propaganda“ zu folgen sowie Verbrechen der Wehrmacht „in einem möglichst positiven Licht erscheinen zu lassen“.
Einen historischen Sachverständigen, den das Gericht hören wollte, hatte die Kammer vor dem Verhandlungstag wieder abgeladen. Die Staatsanwaltschaft informierte den Richter, dass sich der vom Gericht geladene Historiker Yves Müller in der Vergangenheit öffentlich über die AfD und Höcke geäußert hatte. „Da habe ich ihm mitgeteilt, dass die Kammer davon Abstand nimmt, ihn zu hören“, sagt Richter Stengel am Mittwoch. „Weil, das geht einfach nicht.“
Das Gericht hat über die meisten Beweisanträge noch nicht entschieden. Die Verhandlung wird am kommenden Montag fortgesetzt.
https://www.welt.de/
Beobachtete AfD will Verfassungsschutz in den Blick nehmen
Veröffentlicht am 07.03.2025 Lesedauer: 4 Minuten
Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke nimmt den Landesverfassungsschutz ins Visier. (Archivbild)
Quelle: Martin Schutt/dpa
Die Thüringer AfD wird seit Jahren vom Landesverfassungsschutz beobachtet und als rechtsextremistisch eingestuft. Nun will sie im Landtag die Arbeit des Inlandsgeheimdienstes unter die Lupe nehmen.
Ein mit AfD-Stimmen eingesetzter Untersuchungsausschuss soll sich mit der Arbeit des Thüringer Verfassungsschutzes befassen. Die AfD-Fraktion setzte das Gremium im Landtag im Alleingang ein - alle anderen anwesenden Abgeordneten stimmten dagegen. Im Fokus soll das Handeln von Landesverfassungsschutzpräsident Stephan Kramer stehen, wie aus dem AfD-Antrag hervorgeht.
Das Gremium soll beispielsweise klären, ob Kramer sein Amt zu politischen Zwecken missbrauchte. Der AfD-Abgeordnete Stefan Möller sagte, man nutze den Untersuchungsausschuss, um «die Machenschaften» von Kramer und Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) zu beleuchten. Er warf Kramer vor, nicht die nötigen Voraussetzungen für die Ausübung des Amtes mitzubringen, da dieser kein Volljurist sei.
Bei der Landtagswahl im Herbst 2024 war die AfD mit ihrem Thüringer Chef Björn Höcke stärkste Kraft geworden und hat nun im Landtag so viele Sitze, dass sie allein Untersuchungsausschüsse einsetzen kann. Die anderen Fraktionen können dies nicht verhindern. Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses sind ein Fünftel der Stimmen im Parlament nötig, die AfD hat in Thüringen mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag.
Die Höcke-AfD wird seit März 2021 vom Thüringer Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet.
«Wir werden diesen Untersuchungsausschuss nutzen, um über die Gefährlichkeit und die Gefahr der AfD aufzuklären», kündigte die Thüringer Linke-Abgeordnete Katharina König-Preuss an.
Der CDU-Politiker Jonas Urbach kritisierte, der Antrag der AfD zum Untersuchungsausschuss lese sich wie einen Angriff auf den Verfassungsschutz. «Wir brauchen aber einen gut funktionierenden Verfassungsschutz», sagte er.
Die Behörde sei kein politisches Instrument. «Es ist uns wichtig, die im Raum stehenden Vorwürfe auszuräumen, damit der Verfassungsschutz seine Arbeit wieder in ruhigem Fahrwasser ausführen kann.»
Urbach warf der AfD einen Delegitimierungsversuch vor. Es sei nachvollziehbar, aber verwerflich, dass «gerade diejenigen versuchen, die Behörde in Verruf zu bringen, deren Aktivitäten von ihr beobachtet werden», sagte Urbach.
Der Landtag verabschiedete zudem zwei Gesetzesänderungen, um eine Blockade der AfD bei der Besetzung von Gremien zur Kontrolle des Verfassungsschutzes zu verhindern.
Künftig ist keine Zweidrittelmehrheit mehr nötig, um Mitglieder für die parlamentarische Kontrollkommission und für die sogenannte G10-Kommission zu wählen. Die einfache Mehrheit reicht. Damit hat die AfD-Fraktion keine Sperrminorität mehr. Die Änderungen wurden mit Stimmen von CDU, BSW, Linke und SPD angenommen, die AfD stimmte dagegen.
Die parlamentarische Kontrollkommission überwacht die Arbeit des Verfassungsschutzes. Die G10-Kommission kontrolliert zusätzlich, bei welchen Menschen der Verfassungsschutz zum Beispiel Telefone und die Post überwachen darf. Die AfD wäre gern selbst in diesen beiden Gremien vertreten. Für die anderen Fraktionen ist das aber keine Option, da die AfD wegen ihrer extremen Ansichten selbst vom Landesverfassungsschutz beobachtet wird.
Nach den Erfahrungen bei der ersten Landtagssitzung nach der Wahl im Herbst 2024 änderten die Abgeordneten von CDU, BSW, Linke und SPD zudem die Geschäftsordnung des Landtags. Die Sitzung geriet damals unter der Leitung des Alterspräsidenten Jürgen Treutler (AfD) zum Polit-Debakel. Das Spektakel landete sogar vor dem Verfassungsgerichtshof, der dem Agieren von Treutler ein Stopp-Schild zeigte. Der 73-Jährige hatte Abgeordneten das Wort entzogen, Abstimmungen nicht zugelassen und eine von vielen Abgeordneten als parteiisch kritisierte Rede gehalten.
Künftig soll nicht mehr der älteste Abgeordnete die erste Sitzung des Parlaments leiten, sondern der dienstälteste. Die Änderung bedeutet zugleich eine Anpassung an die Regeln im Bundestag.
Die Abgeordnete des Landtags änderten noch weitere Punkte in der Geschäftsordnung. Künftig sollen namentliche Abstimmungen nicht mehr mit farbigen Stimmkarten durchgeführt werden, sondern per Namensaufruf. Für die Öffentlichkeit soll so schneller direkt nachvollziehbarer werden, wer wie gestimmt hat.
Außerdem soll es künftig eine Regierungsbefragung geben - ebenfalls nach Vorbild des Bundestages. Bei der Bildung der Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD war ein Konsultationsverfahren entstanden, das nun in der Geschäftsordnung abgebildet wird. «Damit werden alle im Parlament vertretenen Fraktionen frühzeitig bei Gesetzentwürfen eingebunden», teilten die drei regierungstragenden Fraktionen mit. Mit den Änderungen werden die mündlichen Anfragen abgeschafft und durch Dringlichkeitsanfragen ersetzt. Diese können ebenfalls an die Regierung gerichtet und schriftlich beantwortet werden.
dpa-infocom GmbH
https://www.welt.de/
Kandidierenden-Check
Björn Höcke: Wann die Justiz gegen den AfD-Politiker ermittelte
Björn Höcke musste sich schon mehrfach vor Gericht verantworten. Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen im September wurde die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden erneut aufgehoben. Eine Chronik der Ermittlungen, eingestellten Verfahren und Prozesse.
von Martin Böhmer
17.07.2024
Björn Höcke und die Justiz: Thüringens AfD-Fraktionsvorsitzender am 1. Juli im Landgericht Halle.
„Heute wurde zum 9. Mal meine Immunität aufgehoben.“ So teilt es Björn Höcke seinen Followerinnen und Followern am 10. Juli via Telegram mit. Jetzt kann die Staatsanwaltschaft erneut gegen den Thüringer AfD-Spitzenkandidaten ermitteln. Mit der Justiz hat Höcke seit Jahren Ärger.
Mehrfach wurde bisher gegen Höcke ermittelt. Die meisten Verfahren wurden eingestellt. In zwei Prozessen wurden Urteile gegen den AfD-Politiker gesprochen, die allerdings noch nicht rechtskräftig sind; zwei weitere Prozesse drohen ihm derzeit. Weswegen wurde gegen ihn ermittelt? Welche Verfahren wurden eingestellt? Darf er wirklich „Faschist“ genannt werden? Eine Übersicht der Ermittlungen und Urteile zur Dokumentation.
Björn Höcke: Ermittlungen, eingestellte Verfahren und Prozesse gegen den AfD-Politiker
2015 – Staatsanwaltschaft Erfurt ging wohl Betrugsverdacht nach – Der Justizausschuss hob laut Medienberichten im Sommer 2015 die Immunität des AfD-Politikers auf. Der Verdacht erhärtete sich nicht, die Ermittlungen wurden demnach 2016 eingestellt.
Mehr von CORRECTIV
Björn Höcke bei einem Gerichtstermin.
Höcke-Urteil: Frühzeitiger FAZ-Artikel belegt nicht, dass das Urteil schon vorher feststand
Geheimplan gegen Deutschland
2015 – Staatsanwaltschaft Halle ermittelte offenbar wegen Volksverhetzung – Im November 2015 sprach Björn Höcke von einem „lebensbejahenden, afrikanischen Ausbreitungstyp“. Diese Worte nutzte er beim Neue-Rechte-Thinktank „Institut für Staatspolitik“ von Götz Kubitschek, wie Videoaufnahmen belegen. Die Staatsanwaltschaft stellte ihre Ermittlungen aber wohl mangels hinreichenden Tatverdachts ein.
„Denkmal der Schande“: Skandalträchtige Dresden-Rede blieb für Björn Höcke juristisch folgenlos
2017 – Staatsanwaltschaft Dresden ermittelte wegen Volksverhetzung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener – Björn Höcke bezeichnete in seiner viel kritisierten Dresdner Rede 2017 bei der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative unter anderem das Holocaust-Mahnmal in Berlin als „Denkmal der Schande“ und forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“. Strafrechtlich blieb die Rede folgenlos: die Dresdner Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen im März 2017 ein. Auch das folgende in der AfD angestoßene Parteiausschlussverfahren überstand Höcke.
2018 – Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelte wegen Verstoßes gegen Kunsturhebergesetz – Mit dem Bild der getöteten Tramperin Sophia L. machten Rechtsextreme, AfD und Pegida bei einem sogenannten „Trauermarsch“ Stimmung gegen Migrantinnen und Migranten. L.s Eltern wehrten sich gegen den Missbrauch des Fotos ihrer Tochter. Gegen Björn Höcke bestand der Verdacht Urheberrechtsverletzung: Er hatte Fotos der Demo auf Facebook verbreitet. Das Bild der jungen Frau war darauf zu sehen. Aber die Staatsanwaltschaft Chemnitz stellte Anfang 2019 die Ermittlungen ein, es gab „keine berechtigten Interessen“ seitens der Familie.
Landgericht Mühlhausen lässt Anklage gegen Björn Höcke nach Telegram-Beitrag zu
2020 – Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelte wegen Volksverhetzung und Verleumdung – In einem Twitter-Post vom 3. Juni 2020 wurde die Seenotretterin Carola Rackete diffamiert. Darin hieß es: „Schlepper-Ikone Carola Rackete: Ich habe Folter, sexuelle Gewalt, Menschenhandel und Mord importiert“. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelte gegen Höcke als mutmaßlichem Urheber des Posts. Trotz einer Hausdurchsuchung im Mai 2021 gab es laut Staatsanwaltschaft „keine durchgreifenden Anhaltspunkte für eine Urheberschaft des Beschuldigten“. Die Ermittlungen wurden am 23. November 2021 eingestellt.
Politikerinnen und Politiker genießen in Deutschland Immunität, die sie vor Strafverfolgung schützt. Wenn eine Anzeige registriert wurde und Ermittlungsbehörden einen begründeten Verdacht feststellen, beantragen sie, dass die Immunität der Politikerin oder des Politikers aufgehoben wird. Dann entscheidet etwa der zuständige Justizausschuss, ob die Immunität aufgehoben wird. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, dürfen Staatsanwaltschaften ermitteln.
2020 – Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelte wegen übler Nachrede – Höcke bezeichnete die damalige Vorsitzende des Bayerischen Flüchtlingsrats in einem Facebook-Post als „Ex-Terroristin, die Fremden dabei hilft, den Sozialstaat zu plündern“. Weil der Beitrag laut Staatsanwaltschaft Mühlhausen von der Meinungsfreiheit gedeckt war, wurden die Ermittlungen am 23. Juni 2021 eingestellt.
Seit 2022 – Ermittlungen und Gerichtsprozess wegen Volksverhetzung – Zu einer Gewalttat in Ludwigshafen mit zwei Toten schrieb Björn Höcke via Telegram: „Wahrscheinlich ist der Täter psychisch krank und leidet an jener unter Einwanderern weit verbreiteten Volkskrankheit, welche die Betroffenen ,Allahu Akbar‘ schreien lässt und deren Wahrnehmung so verzerrt, dass sie in den ,ungläubigen‘ Gastgebern lebensunwertes Leben sehen.“ Die Anklage wurde am 21. September 2023 vor dem Landgericht Mühlhausen zugelassen. Der Termin für den Prozess steht noch nicht fest. (Anmerkung: Siehe Update am Ende des Textes)
Zwei Geldstrafen für den Thüringer AfD-Spitzenkandidaten
Mai 2024 – Erstes (nicht rechtskräftiges) Urteil wegen SA-Parole – Björn Höcke rief bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Merseburg im Mai 2021: „Alles für Deutschland“. Nach Einschätzung des Gerichts habe er gewusst, dass es sich hierbei um eine verbotene Parole der Sturmabteilung (SA) der NSDAP handelt. Das Landgericht Halle verurteilte Björn Höcke am 14. Mai 2024 zu 100 Tagessätzen zu je 130 Euro (13.000 Euro gesamt) wegen Verwendens von Kennzeichen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation (nach §86a StGB). Höckes Verteidiger legten Revision ein, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Juli 2024 – Zweites (nicht rechtskräftiges) Urteil wegen SA-Parole – Während die Ermittlungen zur SA-Parole in Merseburg liefen, benutzte Höcke bei einer Veranstaltung am 14. Dezember 2023 in Gera die Parole erneut. Höcke sprach selbst „Alles für…“ aus und ließ das Publikum „Deutschland“ ergänzen. Daraufhin musste er sich erneut wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verantworten. Der Prozess am Landgericht Halle begann am 24. Juni, am 1. Juli wurde Höcke zu einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu 130 Euro (16.900€) verurteilt.
Die Staatsanwaltschaft hatte eine Bewährungsstrafe von acht Monaten und die Aberkennung des passiven Wahlrechts gefordert, so dass Höcke nach einer rechtskräftigen Verurteilung nicht zur Landtagswahl hätte antreten dürfen. Das Gericht folgte dieser Forderung nicht. Auch bei diesem Urteil legten Höckes Verteidiger Revision ein. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, gilt Björn Höcke als vorbestraft.
Juli 2024 – Björn Höcke droht neues Verfahren wegen Gera-Rede 2022 – Aktuell geht die Staatsanwaltschaft dem Verdacht nach, dass Höcke in einer Rede am 3. Oktober 2022 in Gera den deutschen Staat verunglimpft hat. Die Immunität Höckes wurde nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Gera nach Informationen von CORRECTIV aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft Gera hat das Ermittlungsverfahren noch nicht offiziell bestätigt. Es ist noch unklar, ob es zu einem Prozess kommt.
Gericht entschied: Höcke darf als „Faschist“ bezeichnet werden
2019 – Darf man Björn Höcke „Faschist“ nennen? – Eine Demonstration gegen ein AfD-Familienfest in Eisenach trug den Titel „Protest gegen die rassistische AfD, insbesondere gegen den Faschisten Höcke“. Das Verwaltungsgericht Meiningen erklärte in dem Zivilverfahren die Bezeichnung Höckes als „Faschist“ am 26. September 2019 für zulässig.
Zu beachten ist: Höcke ist nicht gerichtlich zum Faschisten erklärt worden. Aber die Bezeichnung ist als Meinungsäußerung gedeckt. Das entschied das Gericht.
Update vom 19. Juli 2024: Wir haben den Text mit einer klareren Trennung zwischen Strafrecht und Zivilrecht angepasst. Deutlicher wird nun auch, dass die meisten Ermittlungen eingestellt wurden.
Update vom 19. September 2024: Das Landgericht Mühlhausen teilt mit, dass Ermittlungen wegen Volksverhetzung vorläufig eingestellt wurden. Für weitere Ermittlungen muss der neue Justizausschuss nach der Thüringer Landtagswahl erneut Björn Höckes Immunität aufheben. So verlangt es die Thüringer Verfassung. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.
Redigatur: Gabriela Keller, Justus von Daniels
- Faktencheck: Elena Kolb
- Kommunikation: Valentin Zick
https://correctiv.org/
Höcke-Urteil: Frühzeitiger FAZ-Artikel belegt nicht, dass das Urteil schon vorher feststand
Noch bevor AfD-Politiker Björn Höcke wegen des Verwendens einer verbotenen NS-Parole verurteilt wurde, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung über das Urteil. Anders als behauptet, belegt das…
bjoern-hoecke-gerichtssaal
weiterlesen
Neue Rechte
Geheimplan gegen Deutschland
Von diesem Treffen sollte niemand erfahren: Hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer kamen im November in einem Hotel bei Potsdam zusammen. Sie planten nichts Geringeres als…
test-header
weiterlesen
Björn Höcke - WIKIPEDIA-Auszüge
10.05.2025
Björn Uwe Höcke[1][2] (* 1. April 1972 in Lünen, Nordrhein-Westfalen) ist ein rechtsextremer deutscher Politiker (AfD).
Höcke ist seit 2014 Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag und gemeinsam mit Stefan Möller Sprecher des Landesverbands AfD Thüringen. Im März 2015 war er Mitbegründer der rechtsextremen parteiinternen Gruppe Der Flügel. Auch nach deren formeller Auflösung gilt Höcke wegen seiner guten Vernetzung als bundesweit einflussreichster Politiker in der rechtsextremen AfD. Er vertritt Konzepte der Neuen Rechten und strebt ein Bündnis ultranationalistischer Gruppen zur ethnischen Homogenisierung Deutschlands und Europas an.
Sozialwissenschaftler und Historiker stellen in Höckes Äußerungen Faschismus, Rassismus, Geschichtsrevisionismus und Antisemitismus sowie Ideen und Sprache des Nationalsozialismus fest. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) stuft ihn als Rechtsextremisten ein und überwacht ihn seit Anfang 2020.
Höckes Vater hatte die antisemitische Zeitschrift Die Bauernschaft des verurteilten Holocaustleugners Thies Christophersen abonniert und sich nach dem Ausschluss von Martin Hohmann aus der CDU (seit 2016 AfD) öffentlich mit ihm solidarisiert.[4]
In einem Leserbrief von 2006 behauptete Höcke im Anschluss an den Geschichtsfälscher David Irving, anders als die deutschen Luftangriffe auf Coventry 1940 seien die britischen Luftangriffe auf Dresden 1945 eine völkerrechtswidrige, geplante Massentötung an ostdeutschen Flüchtlingen in einer unverteidigten überfüllten Stadt gewesen.[12] In dem Leserbrief steht auch der Satz: „In der Weltgeschichte sind niemals zuvor und niemals danach in so kurzer Zeit so viele Menschen vom Leben zum Tode befördert worden wie im ehemaligen Elbflorenz.“ Daraufhin musste Höcke seiner Schulleitung versprechen, so etwas als Lehrer nie wieder öffentlich zu äußern.[13]
Ab 2007 hatte Höcke Kontakt zu Vertretern der Neuen Rechten wie Dieter Stein und Heiner Hofsommer. 2008 regte er in der Zeitschrift Junge Freiheit eine Diskussion über einen „Dritten Weg“ als Alternative zum „zinsbasierten Globalkapitalismus“ an. 2011 versuchte er mit einigen Gleichgesinnten eine „Patriotische Deutsche Gesellschaft“ zu gründen.[4] Beim Gedenken an den 13. Februar 1945 in Dresden im Jahr 2010 demonstrierte er zusammen mit Neonazis.[14]
In der von Thorsten Heise herausgegebenen NPD-Zeitschrift Volk in Bewegung & Der Reichsbote veröffentlichte in den Jahren 2011 und 2012 ein Autor unter dem Pseudonym „Landolf Ladig“ mehrere Artikel, die sprachliche Wendungen und Ausdrücke enthielten, wie sie ab 2013 nur Höcke in seinen Reden verwendete. Dies belegte der Soziologe Andreas Kemper ab 2015.[17] Ladig beschrieb auch Höckes Wohnhaus in Bornhagen genau,[18] lobte die Ideen der NPD, verherrlichte das NS-Regime, behauptete, auf den „Fleiß“ und die „Formbestimmtheit“ der Deutschen neidische fremde Mächte hätten Deutschland in beiden Weltkriegen überfallen, und sprach von einer Revolution oder einem Systemwechsel, der durch „sich aufpotenzierende Krisendynamik“ nahegerückt sei. Die „identitäre Systemopposition“ müsse sich an die Spitze dieser Revolution setzen, um die „organische Marktwirtschaft“ (NS-Wirtschaftspolitik) auf rassenbiologischer Grundlage wieder einzuführen.
Wegen der Vielzahl charakteristischer Übereinstimmungen forderte der AfD-Bundesvorstand im April 2015 von Höcke eine Versicherung an Eides statt, dass er nie unter dem Pseudonym „Landolf Ladig“ Texte verfasst, daran mitgewirkt oder sie in irgendeiner Form wissentlich verbreitet habe.[20] Höcke lehnte dies ab, bestritt, dass er je Artikel für NPD-Blätter verfasst habe, und drohte jedem rechtliche Schritte an, der behauptet, er sei mit Ladig identisch.[21] Tatsächlich aber ging er nie juristisch gegen seine öffentliche Gleichsetzung mit Ladig vor.
Im April 2017 beantragte der damalige AfD-Bundesvorstand mit Kempers Belegen Höckes Parteiausschluss.[24] In seinem Gutachten zur AfD vom 15. Januar 2019 urteilte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) mit Bezug auf Kempers Belege, Höckes Identität mit „Landolf Ladig“ sei „nahezu unbestreitbar“ und „angesichts der plausibilisierten Faktendichte nahezu mit Gewissheit anzunehmen.“[25] Höckes Wortwahl, etwa vom angeblich drohenden „Volkstod“, erinnere „sprachlich und argumentativ an bekannte Deutungsmuster“ der NPD. Auch weil Höcke höchstwahrscheinlich unter jenem Pseudonym rechtsextreme Texte verfasst hatte, stufte das BfV den „Flügel“ als rechtsextremen Verdachtsfall ein.[26]
Höckes und André Poggenburgs Erfurter Resolution vom März 2015 leitete die Ablösung von Parteichef Bernd Lucke und einen Rechtsruck in der AfD ein.[33] Als Höcke im Mai 2015 erklärte, nicht jedes NPD-Mitglied sei als extremistisch einzustufen,[34] forderte Lucke ihn zum Parteiaustritt auf.[35] Mitte Mai 2015 beschloss der AfD-Bundesvorstand gegen die Stimmen von Frauke Petry und Alexander Gauland ein Amtsenthebungsverfahren gegen Höcke.[36] Im September 2015 stellte der neue Bundesvorstand unter Petry und Jörg Meuthen das Verfahren ein.[37] Zwar kritisierten die Bundesvorsitzenden Höckes Auftritte – etwa bei Günther Jauch am 18. Oktober 2015,[38] beim IfS am 21. November 2015[39] und in Dresden im Januar 2017. Meuthen lehnte jedoch Höckes Parteiausschluss ab.[40] Petry dagegen beantragte diesen und warb mit einer Mail an alle AfD-Mitglieder dafür.[41]
Mitte Februar 2017 beschloss der AfD-Bundesvorstand ein erneutes Parteiausschlussverfahren gegen ihn, das im Mai 2018 durch das Schiedsgericht der AfD Thüringen abgelehnt worden ist.[42] Der Bundesvorstand verzichtete im Juni 2018 einstimmig auf Rechtsmittel dagegen.[43] Am Folgetag schlug Gauland Höckes Kandidatur zur Bundestagswahl 2017 vor.[44]
Ende November 2018 verteidigte er die Junge Alternative für Deutschland (JA) gegen die vom AfD-Vorstand erwogene Auflösung dreier Landesverbände, die der Verfassungsschutz wegen ihrer Kontakte zu Rechtsextremen beobachtete.[52]
Ab 2014 gab Höcke öfter Interviews in neurechten bis rechtsextremen Zeitschriften wie Sezession,[82] Junge Freiheit,[83] Zuerst!,[84] Blaue Narzisse[85] und Compact.[86] Auf Kritik daran erwiderte er, er rede mit jedem. Sein zentrales Motiv für den Gang in die Politik sei der „Kampf um die Meinungsfreiheit“.[83]
Im Mai 2014 forderte Höcke in einer E-Mail an einen Thüringer Parteifreund, § 86 und § 130 StGB rasch abzuschaffen, demnach das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen zu erlauben und Volksverhetzung mitsamt Holocaustleugnung und Gewaltaufrufen straflos zu machen. Er übernahm damit eine Forderung der NPD.[87]
Am 29. Mai 2016 trat Höcke beim „Herkules-Kreis“ in Friedlos auf.[97] Darin wirken AfD-Mitglieder wie Andreas Lichert, Rechtsextreme, frühere „Reichsbürger“, Identitäre, das „Bündnis Deutscher Patrioten“ und die Kampagne Ein Prozent für unser Land zusammen.[98] Er soll nach Medienberichten Bündnisse rechtsextremer Gruppen ohne „Fesseln der Parteiraison“ bilden und Höckes Rolle als Galionsfigur des rechten AfD-Flügels stärken.[99]
Bei einer AfD-Kundgebung in Gera verteidigte Höcke am 28. Oktober 2016 Ursula Haverbeck, verharmloste ihre Holocaustleugnung als „Meinungsdelikt“ und behauptete, Täter mit der „richtigen Herkunft“ kämen für weitaus schlimmere Straftaten in Deutschland mit Bewährungsstrafen davon.[100][101]
Im Januar 2024 bekräftigte Höcke in einem auf X publizierten Video erneut, es gebe in Deutschland „im Jahr 2024 keine funktionierende Demokratie mehr“, und sagte über die Proteste gegen Rechtsextremismus in Deutschland und Österreich 2024, diese „Gutmenschen, oftmals steuerfinanziert, die da die Lichter in die Höhe gehalten“ hätten, seien „dieselben Menschen, die 1933 die Fackelmärsche in Nazideutschland veranstaltet“ hätten.[117]
Bei den Erfurter Demonstrationen im Herbst 2015 nannte Höcke politische Gegner „Volksverräter“ und „Lumpenpack“. Er forderte für Deutschland „nicht nur eine tausendjährige Vergangenheit“, sondern „auch eine tausendjährige Zukunft.“ Die Zeit des deutschen Kaiserreichs zwischen 1871 und 1914 sei „eine Hochzeit unseres Volkes“ gewesen.[124]
Im September 2019 bestritt Höcke in einem ZDF-Interview, „dass es eine allgemein gültige Definition dessen gibt, was eine NS-Diktion, was NS-Sprache ist“. Entsprechende Begriffe habe es vor und nach der NS-Zeit gegeben. Kritiker, die ihm eine sprachliche Nähe zum Nationalsozialismus vorwerfen, seien „Stellenmarkierer“, die „kontaminieren [wollten], was angeblich nicht mehr sagbar“ sei. Nach rund 15 Minuten brach Höcke das Gespräch ab.[130]
Am Tag der Deutschen Einheit 2022 rief Höcke in Gera auf einer Demonstration, Gera sei „heute der Anfang von etwas Neuem, wir sind die Ersten von morgen“. Höcke benutzte hier eine Wortwahl wie in einer 1987 im Uelzener Anzeiger erschienenen Traueranzeige für den ehemaligen Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß. Die Verfasser dieser Anzeige feierten Heß’ „Heldentum“ und charakterisierten sich selbst: „Wir sind vielleicht die letzten von gestern, aber wir sind auch die ersten von morgen.“[129]
Im Juli 2024 warf der Historiker und Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora Jens-Christian Wagner Höcke vor, auf Telegram ein Zitat des Publizisten Arthur Moeller van den Bruck verbreitet zu haben. Das sei „ein offener NS-Bezug – und zwar zustimmend“. Van den Bruck starb bereits 1925, gilt jedoch als Vertreter der Konservativen Revolution und war laut Wagner ein Vordenker des Nationalsozialismus.[131]
Zum Internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust 2015 wollten Höcke und die AfD Thüringen im ehemaligen KZ Buchenwald einen Kranz niederlegen. Dessen Inschrift „Wir gedenken aller Opfer des Konzentrations- und Speziallagers Buchenwald“ setzte NS-Opfer mit Opfern des Stalinismus gleich und griff damit das Holocaustgedenken der KZ-Überlebenden an. Höcke behauptete dazu „eine gewisse Asymmetrie in der gegenwärtigen Erinnerungskultur“. Nach Eingriff der Gedenkstättenleitung unter Volkhard Knigge und Protesten ehemaliger KZ-Häftlinge änderte die AfD die Inschrift.[138]
Am 17. Januar 2017 trat Höcke für die Junge Alternative im Ballhaus Watzke in Dresden auf. Höcke erschien mit Kubitschek.[140] Höcke sagte über das Berliner Denkmal für die ermordeten Juden Europas: „… wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Die Erinnerungskultur seit 1945 sei eine „dämliche Bewältigungspolitik“. Deutschland müsse eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ vollziehen. Man habe auch „keine Zeit mehr, tote Riten zu exekutieren“. . Richard von Weizsäckers Rede Zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft (1985) habe sich „gegen das eigene Volk“ gerichtet.[141][142][143][144]
https://de.wikipedia.org/
Gerichte und Staatsanwaltschaften
Im Mai 2021 beendete Höcke eine Landtagswahlkampfrede in Merseburg mit den Worten „Alles für Deutschland“.[246] Der Spruch war die Losung der SA[247][248] und ist laut dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags,[249] dem Oberlandesgericht Hamm[250] und der strafrechtlichen Literatur[251] als verbotenes Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafbar, wenn er in einer Rede auf einer Versammlung verwendet wird.
Am 14. Mai 2024 verurteilte das Landgericht Höcke zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 130 Euro. Das Gericht war davon überzeugt, dass Höcke gewusst habe, dass die Parole verboten sei, und sie trotzdem verwendet habe.[262][263] In der Urteilsbegründung wurde auf die enge Bekanntschaft Höckes mit einem Parteifreund hingewiesen, gegen den zuvor bereits wegen der Verwendung derselben Losung ermittelt worden war.[256]
Im März 2024 wurde bekannt, dass der Landtag Thüringen nun mittlerweile zum achten Mal die Immunität Höckes aufgehoben habe.[269] Ermöglicht werden sollten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gera wegen des Verdachts, bei einer Versammlung in Gera im vorhergehenden Dezember erneut die Parole „Alles für Deutschland“ verwendet zu haben.[270] Höcke soll in dieser Rede seinen bevorstehenden Prozess in Halle sowie den gegen ihn erhobenen Vorwurf erwähnt und dabei den ersten Teil „Alles für“ selbst gesprochen und dann das Publikum durch Gesten animiert haben, „Deutschland“ zu rufen.[271][272] Am 1. Juli 2024 verurteilte das Landgericht Höcke zu einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu je 130 Euro.[277]
Am 27. September 2019 wollte Höcke in Eisenach bei einem Familienfest der AfD als Redner auftreten. Verschiedene Gruppen meldeten eine Gegenkundgebung unter dem Motto „Protest gegen die rassistische AfD, insbesondere den Faschisten Höcke“ an. Die Stadtverwaltung ließ das Motto verbieten, da sie die öffentliche Sicherheit und Höckes Persönlichkeitsrechte bedroht sah. Am 26. September 2019 hob das Verwaltungsgericht Meiningen das Verbot in einem Eilverfahren auf und erlaubte, Höcke öffentlich als Faschisten zu bezeichnen. Die Antragsteller hätten in dem Eilverfahren „in ausreichendem Umfang glaubhaft gemacht, dass ihr Werturteil nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern auf einer überprüfbaren Tatsachengrundlage beruht“ und vor allem „die Auseinandersetzung in der Sache, und nicht – auch bei polemischer und überspitzter Kritik – die Diffamierung der Person im Vordergrund“ stehe. Daher sei die Meinungsfreiheit in diesem Fall nicht durch Persönlichkeitsrechte eingeschränkt; auch die öffentliche Sicherheit sei nicht gefährdet gewesen.[279] Die angeführten Belege stammten aus Höckes Buch Nie zweimal in denselben Fluss und Presseberichten, wonach Höcke von einem neuen Führer, dem angeblichen „Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch“ und einer „Reinigung“ Deutschlands von politischen Gegnern gesprochen und den Hitler-Faschismus relativiert hatte.[280]Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat im Juni 2023 ein Verfahren gegen einen Demonstranten eingestellt, der bei Anti-AfD-Protesten ein Plakat mit der Aufschrift „Björn Höcke ist ein Nazi“ trug. Es handle sich hier nicht um eine strafbare Beleidigung, sondern um ein „an Tatsachen anknüpfendes Werturteil“, so die Ermittler.[282]
Verfassungsschutzbehörden
Am 6. September 2018 erklärte das Amt für Verfassungsschutz Thüringen die AfD des Landes zum Prüffall, um festzustellen, ob sie dauerhaft beobachtet werden muss.
Thüringens Verfassungsschutzleiter Stephan J. Kramer erklärte weitere Aussagen Höckes für verfassungsfeindlich: Die AfD sei „die letzte revolutionäre, […] die letzte friedliche Chance für unser Vaterland“; manchmal müsse man „das Recht in die eigenen Hände nehmen“; das Gedenken an die NS-Zeit sei ein „Erinnerungszwang“, der „unser nationales Selbstwertgefühl“ unterminieren solle.[285]
Im Jahre 2020 stellte das BfV „Motive des sekundären Antisemitismus“ in Höckes Schriften und Reden fest.
Das rund 400-seitige Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zur AfD vom 15. Januar 2019 zitiert Höcke mehrere hundert Mal und stuft den „Flügel“ der AfD vor allem wegen Höckes Aussagen als „Verdachtsfall“ ein, gegen den nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden können. Basis des Gutachtens sind Internetaussagen, auf Videos aufgezeichnete Reden außerhalb von Parlamenten, bei Höcke auch frühere Aussagen als „Landolf Ladig“ und spätere aus seinem Buch „Nie zweimal in denselben Fluss“.[26] In diesen Belegen fanden die Gutachter „stark verdichtete Anhaltspunkte“ für eine mit der Menschenwürde unvereinbare „extremistische Bestrebung“. Seine „Sofort Agenda“ gehe von einer „naturgegebenen Verschiedenheit von Völkern“ aus, die jede Integration unmöglich mache. Aussagen Höckes über „multikriminelle“ Gesellschaften und Moscheen als Symbole einer „Landnahme“ seien „klar fremdenfeindlich“. Sein „Flügel“ diffamiere Menschen muslimischen Glaubens, auch mit deutscher Staatsbürgerschaft, als „niederwertig“ und teile auch die antisemitische Verschwörungstheorie einer „Weltherrschaft über eine entkultivierte Menschheit“. Sein „ethnokultureller Ansatz“ strebe die „Rechtlosstellung“ von Ausländern, Muslimen und Andersdenkenden an. Höcke formuliere in „aller Klarheit“, „wie sehr ihm das ganze System und die im Wettbewerb stehenden Parteien verhasst sind und wie offensichtlich das Feindbild Merkel lediglich eine Chiffre für die Verachtung der Bundesrepublik insgesamt ist“. Seither beobachtet das BfV den Flügel systematisch.[288]
Seit Anfang 2020 überwacht der Verfassungsschutz Höckes außerparlamentarische Aktivitäten mit nachrichtendienstlichen Mitteln.[289]
+++
Petition mit dem Ziel der Grundrechtsverwirkung
Im Jahr 2023 wurde eine Petition gestartet, die fordert, Höcke die Wählbarkeit abzuerkennen. Die Petition beruft sich auf Artikel 18 des Grundgesetzes, der die Verwirkung von Grundrechten regelt. Das Kampagnennetzwerk Campact setzte sich in diesem Zusammenhang zum Ziel, mindestens 1,7 Millionen Unterschriften zu sammeln, um die Bundesregierung zu einem Verwirkungsantrag gegen Björn Höcke zu drängen. Die Anwendbarkeit des Artikels 18 GG wurde von der Rechtswissenschaftlerin Gertrude Lübbe-Wolff ins Gespräch gebracht. Dieses Mittel sei – im Vergleich zu einem Parteiverbot – eine schlankere Version der Demokratieverteidigung.[298]
+++
OMAS GEGEN RECHTS FFM - Höckes Strategieplan
omasgegenrechts-ffm.de
https://omasgegenrechts-ffm.de
· PDF-Datei
Strategie: Höckes Plan zur - omasgegenrechts-ffm.de
Höcke möchte keine Reformen einführen, sondern er will einen gewaltsamen Umsturz. Mit starkem Besen sollten eine „feste Hand“ und ein „Zuchtmeister“ den Saustall ausmisten.“… „Die …
25 krasse Zitate, die zeigen, dass Höcke ein waschechter Faschist ist
von Thomas Laschyk | Juli 3, 2023 | Analyse
Während in Thüringen der erste AfD-Landrat gewählt wurde und der Rechtsextremismus in Umfragen so beliebt ist wie noch nie seit 1945, ist es wieder einmal wichtig, nicht einfach nur „Höcke ist ein Nazi“ zu wiederholen – auch wenn es stimmt. Auch wenn skandalöserweise Beamte genau wegen dieses Satzes wegen angeblicher Beleidigung ermitteln, ist es wichtig, das auch zu belegen. Denn im Gegensatz zur beliebten Nazi-Keule der AfD und ihrer Gesinnungsgenossen gegen alles, was ihnen nicht passt, müssen wir die gefährliche Wahrheit nun mal aussprechen. Wer wirklich anzweifeln sollte, dass Höcke ein lupenreiner Faschist ist, der soll diese 25 Zitate lesen. Dieser Artikel ist eine geupdatete Version eines unserer Artikel von 2020.
Schon 2010 bei Nazi-Demo
Vor 13 Jahren bereits hat der jetzige Führer des Thüringer Landesverbands der AfD, Björn Höcke, an einem Neonazi-Aufmarsch der NPD in Dresden teilgenommen. Dass er zusammen mit 5000 Rechtsextremisten 2010 demonstrierte, wurde 2017 bekannt – und sorgte seinerzeit für viel Kritik – Der Zentralrat der Juden bezeichnete ihn deshalb als „Rechtsextremisten“, der aus der AfD ausgeschlossen werden sollte.
Faschist Höcke ist auch kein Ausreißer in der inzwischen strammrechten AfD. Gauland bezeichnete Höcke 2019 als „Mitte der Partei“ und erklärte über seinen „Flügel“ in der AfD, dieser werde auf Parteitagen von „40 Prozent der Delegierten“ gewählt – was ihn zum stärksten und größten Teil der AfD macht. Wegen dieses Flügels sind schon viele aus der AfD ausgetreten, weil sie ihnen zu rechtsextrem seien (Zum Beispiel). Übrig geblieben ist der Nazi-Kern.
Höcke darf laut einem Gerichtsurteil des Verwaltungsgericht Meiningen (Link) als „Faschist“ bezeichnet werden, denn die Aussage, dass Höcke ein Faschist ist, sei keine Beleidigung, da sie „auf einer überprüfbaren Tatsachengrundlage beruht.“ Das stimmt auch, aber Achtung: Was nicht stimmt, ist, dass ein Gericht ihn als Faschist eingestuft habe.
Höcke veröffentlichte laut Verfassungsschutz vor seiner Zeit in der AfD unter dem Pseudonym „Landolf Ladig“ rechtsextreme Texte unter anderem in NPD-Zeitungen (Hintergrund dazu). Er verfasste auch das Buch „Nie zweimal in denselben Fluss“. Doch das sind alles erst einmal nur Behauptungen über ihn. Wir möchten, dass sich jeder selbst ein Bild von Björn Höcke machen kann und zitieren ihn einfach selbst.
Die 25 Nazi-Zitate von Höcke
- „Und diese dämliche Bewältigungspolitik, die lähmt uns heute noch viel mehr als zu Franz Josef Strauß’ Zeiten. Wir brauchen nichts anderes als erinnerungspolitische Wende um 180 Grad!“ (Was heißt, die Zeit des Nationalsozialismus positiv zu betrachten, was man aus seiner Rede auch einfach herauslesen kann, Quelle.)
- „Wir Deutschen […] sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ (Die absichtliche Doppeldeutigkeit, mit der Höcke das Holocaust-Denkmal in Berlin bezeichnet hat, wird ihm als antisemitisch ausgelegt. Er behauptet, er habe den Holocaust mit der „Schande“ gemeint, der Kontext seiner Rede lässt das jedoch nicht vermuten, Quelle)
- „Ich will, dass Magdeburg und dass Deutschland nicht nur eine tausendjährige Vergangenheit haben. Ich will, dass sie noch eine tausendjährige Zukunft haben, und ich weiß, ihr wollt das auch.“ (Eine direkte Kopie nationalsozialistischer Sprache durch Höcke, siehe „Tausendjähriges Reich“ Quelle)
- „Das Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird.“ (Verharmlosung und Relativierung Hitlers und des Dritten Reiches, Quelle) Er sagt, dass „eben nicht die Aggressivität der Deutschen ursächlich für zwei Weltkriege war, sondern letztlich ihr Fleiß, ihre Formliebe und ihr Ideenreichtum. Das europäische Kraftzentrum entwickelte sich so prächtig, dass die etablierten Machtzentren sich gezwungen sahen, zwei ökonomische Präventivkriege gegen das Deutsche Reich zu führen.“ (Als Landolf Ladig drehte Höcke die Schuld am Zweiten Weltkrieg um und verherrlicht die NS-Herrschaft, Quelle)
- Ebenfalls als Landolf Ladig beklagte er die „Zinsknechtschaft“, „zinsverursachter Wachstumszwang“ und das „Zinsgeldsystem“. („Brechung der Zinsknechtschaft“ war zentraler Slogan der NSDAP, die damit eine „Herrschaft der Juden“ meinte, Quelle)
- „Wir müssen klar immer wieder darauf hinweisen, dass Merkel nicht das Problem ist, sondern dass sie der Kopf eines stinkenden Fisches ist… Dass nicht nur Merkel weg muss, sondern dass das Merkel-System weg muss […] und dieses Merkel-System sind sämtliche Kartellparteien, die es nicht gut mit diesem Land meinen.“ (Höcke möchte alle anderen Parteien abschaffen, Quelle)
- Höcke möchte laut seinem Buch den Kampf gegen den vermeintlich „bevorstehenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch“ antreten. (Genau auf dieses rechtsextreme Märchen stützten sich auch der Christchurch- und Halle-Attentäter.)
- „Neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein.“ („Remigration“ ist ebenfalls ein von Rechtsextremen und dem Christchurch-Attentäter genutztes Wort, was einfach „Deportationen“ bedeutet. Höcke möchte Massendeportationen durchführen, S. 254.)
- Ziel dieser „Remigration“ sei es, nach „der erhofften Wendephase“ (Machtantritt der AfD) „kulturfremde“ Menschen (Afrikaner und Asiaten) zu deportieren. Und weiter „Vor allem eine neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannungen auszuhalten haben: Sie ist den Interessen der autochthonen Bevölkerung verpflichtet und muss aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen.“ Man werde, „so fürchte ich, nicht um eine Politik der ‚wohltemperierten Grausamkeit‘ herumkommen.“ (Höcke will diese Massendeportationen also notfalls mit Gewalt durchführen, S. 254ff.)
- „Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen.“ Er denke an einen „Aderlass“. (Höcke will bei seinen Massendeportationen auch den Tod oder die Verbannung von Menschen in Kauf nehmen [oder verursachen], die sich dagegen wehren.)
- „Ich weise dieser Partei einen langen und entbehrungsreichen Weg. Aber es ist der einzige Weg, der zu einem vollständigen Sieg führt, und dieses Land braucht einen vollständigen Sieg der AfD und deshalb will ich diesen Weg – und nur diesen Weg – mit euch gehen, liebe Freunde!“ (Höcke träumt also von einem „Endsieg“ der AfD, Quelle)
- „Mit der Bombardierung Dresdens und der anderen deutschen Städte wollte man nichts anderes, als uns unsere kollektive Identität [zu] rauben. Man wollte uns mit Stumpf und Stiel vernichten, man wollte unsere Wurzeln roden. Und zusammen mit der dann nach 1945 begonnenen systematischen Umerziehung hat man das auch fast geschafft.“ (Höcke bezeichnet die Entnazifizierung als etwas Schlechtes, ergo ist Nazi-Denken gut? Quelle)
- „Eine wirkliche Demokratie ist Deutschland heute für mich nicht mehr. Deutschland ist für mich heute eine Maulkorbdemokratie, die leider auf dem besten Weg ist, eine Wohlfühldiktatur zu werden.“ (Höcke behauptet, wir würden in keiner Demokratie leben, weil er angeblich nicht mehr alles sagen dürfe, Quelle)
- „Heimat verliert man dadurch, dass man zur Minderheit im eigenen Land wird. In den westdeutschen Großstädten ist es mittlerweile so, dass wir Deutschen Minderheit im eigenen Land sind.“ (Das ist natürlich eine Lüge, deutsche Staatsbürger sind natürlich nicht die Minderheit. Aber auch „Deutsche ohne Migrationshintergrund“ sind auch in allen westdeutschen Großstädten immer noch die größte Gruppe. Es ist wieder die rechtsextreme Theorie des Volkstods. Ähnliche Zitate brachte er sogar häufiger, Quelle)
- „Die sogenannte Einwanderungspolitik, die nichts anderes ist als eine von oben verordnete multikulturelle Revolution, die nichts anderes ist als die Abschaffung des deutschen Volkes.“ (Wieder die Neonazi-Fantasien vom „Volkstod“, Quelle)
- „Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp.“ (Das ist klassische „Rassenlehre“ und einfach Rassismus, Quelle)
- „Der Syrer, der zu uns kommt, der hat noch sein Syrien. Der Afghane, der zu uns kommt, der hat noch sein Afghanistan. Und der Senegalese, der zu uns kommt, der hat noch seinen Senegal. Wenn wir unser Deutschland verloren haben, dann haben wir keine Heimat mehr!“ (Höcke behauptet, jemand, der von einem vom Krieg zerstörten Land geflohen ist habe noch eine Heimat, aber die Deutschen würden ihre wohlhabende, friedliche Heimat verlieren, Quelle)
- „Ich habe die AfD stets als letzte evolutionäre Chance für unser Land bezeichnet. Sie kann es nur bleiben, wenn sie – als eigentlich zutiefst bürgerliche Partei – über ihren Schatten springt: Sie muß in den nächsten Jahren als fundamentaloppositionelle Bewegungspartei gegen die Feinde des Gewordenen organisieren.“ (Höcke erklärt die AfD zum Feind aller anderen Parteien, Quelle)
- „Die Sehnsucht der Deutschen nach einer geschichtlichen Figur, welche einst die Wunden im Volk wieder heilt, die Zerrissenheit überwindet und die Dinge in Ordnung bringt, ist tief in unserer Seele verankert, davon bin ich überzeugt.“ (Höcke behauptet, die Deutschen sehnen sich nach einem „Führer“, Quelle)
- „Die Überwindung des Parteigeistes und die enge Verbindung mit den neutralen, sachkompetenten staatlichen Institutionen halte ich für entscheidend bei der Lösung der anstehenden Probleme. Bis dahin ist es die Aufgabe der AfD, eine unüberhörbare parlamentarische Stimme und Vertretung der Volksopposition im Land zu sein.“ (Höcke möchte das Parteiensystem „überwinden“ und durch „staatliche Institutionen“ ersetzen, Quelle)
- „Ein paar Korrekturen und Reförmchen werden nicht ausreichen, aber die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen, dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt.“ (Höcke möchte keine Reformen einführen sondern will eine Revolution, Quelle)
- „Die Weißen und die Schwarzen setzten sich vor ihrer Amerikanisierung aus mehreren hochdifferenzierten Völkern mit eigenen Identitäten zusammen. Jetzt sind sie in einer Masse aufgegangen. Diesen Abstieg sollten wir Europäer vermeiden und die Völker bewahren.“ (Muss man zu diesem offensichtlichen Rassismus noch etwas sagen? Quelle)
- „Überlegung über ein Zusammengehen oder Koalieren mit Teilen des politischen Establishments setzt deren Läuterung und prinzipielle Neujustierung voraus. Das ist erst zu erwarten, wenn das Altparteienkartell unter der steigenden Krisenlast zerbrochen ist.“ (Höcke nennt nicht nur alle anderen Parteien kriminell, er will auch nur mit „Teilen des politischen Establishments“ zusammenarbeiten, wenn diese vollständig auf AfD-Linie stehen, Quelle)
- „Die Altparteien sind nicht nur inhaltlich erstarrt, sie sind inhaltlich entartet.“ („Entartet“ ist ein offizieller Propagandabegriff der Nazis, mit welchem sie Kunstwerke bezeichneten, die nicht ihrer Ideologie entsprachen, Quelle)
Höcke ist ein Faschist
Diese Liste könnte man noch sehr viel länger machen, doch Höcke wiederholt sich im Grunde genommen immer wieder: Er verherrlicht oder verharmlost Hitler und den Nationalsozialismus, er fantasiert einen Untergang des „deutschen Volkes“ herbei wegen Ausländern und er gibt „Globalisten“ und „Eliten“ die Schuld daran, die im Hintergrund die Strippen ziehen sollen. Wenn man hinschaut, sieht man, dass „Globalisten“ das „internationale Judentum“ und „Ethnopluralismus“ die „NS-Rassenlehre“ sind, nur mit neuen Namen. Wir haben hier auch kürzlich analysiert, wie viel Hitler in Höckes Reden steckt:
Gegen ihn wird auch derzeit wieder mal geklagt wegen Volksverhetzung, wegen mehrfacher Verwendung des SA-Spruchs „Alles für Deutschland“. Der AfD-Politiker sei im Ergebnis der Ermittlungen hinreichend verdächtig, in einer öffentlichen Rede den verbotenen Wahlspruch der SA (Sturmabteilung) der NSDAP „Alles für Deutschland!“ verwendet zu haben. Die Rede hielt Höcke demnach auf einer Wahlkampfveranstaltung der Rechtsextremen 2021. Höcke will sich herausreden, dass das nur Zufall gewesen sein. Dabei haben wir gesehen, dass er sehr sehr oft die Sprache der Nationalsozialisten und von Hitler kopiert. Der ehemalige Geschichtslehrer weiß genau, was er tut. Kein Wunder also, dass ausländische Medien von Höcke als „neuen Hitler“ sprechen:
„The new Hitler“: So berichtet das Ausland über Höcke
Und kein Wunder, dass nicht einmal Parteikollegen seine Zitate von denen von Hitler unterscheiden konnten:
Deshalb ist es auch kein Wunder, dass der Verfassungsschutz in Thüringen die AfD schon als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft hat. Gegen einzelne Passagen daraus klagt die AfD übrigens gerade.
HÖCKE IST EIN FASCHIST
Will wirklich irgendjemand noch in Frage stellen, welcher Ideologie dieser Mann angehört? Höcke ist ein Faschist, er will Massendeportationen, andere Parteien abschaffen und behauptet, Deutschland wolle einen neuen Führer. Dieser Mann ist die „Mitte der Partei“ AfD. Dieser Mann wurde explizit nicht aus der Partei geworfen. Er und andere Mitglieder des „Flügels“ haben nicht nur jede Menge Kontakte in die rechtsextreme Szene, sie gehören laut Verfassungsschutz zur rechtsextremen Szene. Sie sind der parlamentarische Arm der rechtsextremen Szene. Und einer aus Höckes Landesverband ist jetzt Landrat in Sonneberg. Hier zu sehen mit seinem Vorsitzenden:
Martin Schutt/dpa
Wer aus dem Dritten Reich lernen will (und keine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ begrüßt), muss dem Faschisten Höcke, seinem rechtsextremen „Flügel“ und der Partei, zu deren Mitte er gehört, die AfD, kompromisslos entgegentreten. Der darf nie mit ihnen kooperieren, der darf sie nicht wählen, der darf sie nicht verharmlosen. Der darf ihr auch nicht nach den Mund reden und ihre Feindbilder und Desinformation nachplappern. Von genau so etwas kommt etwas wie die Schande von Sonneberg oder Raguhn-Jeßnitz. Wer das nicht glaubt, dem soll man diese Liste zeigen.
Es gibt Menschen, die diese faschistoiden Ideen gut finden. Aber alle anderen müssen aufgeklärt werden, bevor es zu spät ist. Deshalb teilt diesen Artikel und diese Liste, damit sich jeder selbst ein Bild machen kann. Jetzt ist die Gelegenheit herauszufinden, was wir statt unserer Großeltern getan hätten.
Artikelbild: knipsdesign, shutterstock.com / Screenshot youtube.com
https://www.volksverpetzer.de/
Thüringen: Die Faschisten lieferten heute das beste Argument für ein AfD Verbot
von Philip Kreißel, Thomas Laschyk | 26.09.2024 | Aktuelles, Demokratischer Herbst
Die Faschisten in der AfD schweißen heute in Thüringen die Demokraten zusammen und liefern die bisher besten Argumente für ein AfD-Verbot, indem sie gezeigt haben, wie sehr sie die parlamentarische Demokratie verachteten. Sie blockierten vermutlich rechtswidrig jegliche Tagesordnung, ließen keine Abstimmung zu und wollten allen anderen die Mikrofone abschalten. Offensichtlich kann man sie weder an der Urne, noch im Parlament stoppen. Zeit für das letzte Mittel unseres Grundgesetzes und unsere Petition für die Prüfung eines AfD-Verbots?
Das ist in Thüringen passiert
Eigentlich hätte sich heute das Parlament in Thüringen konstituieren sollen. Zu den ersten Aufgaben des frisch gewählten Parlaments gehört auch, einen Landtagspräsidenten zu wählen. Die bisherige Geschäftsordnung des Landtags Thüringen sieht vor, dass die stärkste Fraktion auch zuerst den Landtagspräsidenten nominieren darf. Das wäre jetzt die rechtsextreme AfD. Warum das weniger günstig wäre, hat hier der Verfassungsblog aufgeschrieben:
Die AfD Kandidaten für das Amt des Landtagspräsidenten würden natürlich niemals vom Rest gewählt, dafür fehlt die Mehrheit. Zuletzt hatte die AfD eine Kriminelle als Landtagspräsidentin vorgeschlagen. Dass es diese Diskussion jetzt gibt, liegt vor allem an der CDU, die nicht mit den anderen Demokraten zusammenarbeiten wollte, um dies zu verhindern und vor der Wahl die Regeln anzupassen. Jetzt, nach der Wahl, wollten die demokratischen Parteien aber endlich die Geschäftsordnung ändern, um es nachzuholen, damit die Faschisten nicht einfach nur sich selbst nominieren und nicht gewählt werden.
Die demokratischen Parteien im thüringischen Landtag wollten sich auf das in der Verfassung verankerte Selbstorganisationsrecht des Parlaments berufen. Sie wollten über eine neue Geschäftsordnung abstimmen, in der das Vorschlagsrecht für den Landtagspräsidenten klarer geregelt ist. Und dann über einen neuen Landtagspräsidenten. Bei dem die AfD natürlich weitere Faschisten als Kandidaten vorschlagen darf. Nur nicht als erste und vor allem nicht als einzige. Das sah auch die Tagesordnung für den heutigen Tag vor. Die Tagesordnung wurde von der letzten gewählten Landtagspräsidentin aufgestellt. So weit, so klar.
AfD Thüringen zeigt ihre undemokratische Seite
Die erste Sitzung in Thüringen wird laut bisherigen Regeln vom Alterspräsident geleitet (also dem ältesten Mitglied des Parlaments). Der ist aber leider einer der Faschisten von der AfD. Und er hat nun einfach die beschlossene Tagesordnung in den Müll geworfen und wollte undemokratisch die Wahl eines AfD-Landtagspräsidenten gegen den Willen der Mehrheit im Parlament erzwingen.
Er weigerte sich einfach, die Tagesordnung durchzugehen oder irgendeinen anderen Abgeordneten irgendeinen Antrag stellen zu lassen. Er verhinderte, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass die demokratischen Abgeordneten über irgendetwas abstimmen. Er wollte einfach sein „eigenes“ Programm durchziehen. Es war eine riesige Farce. Er behauptete zum Beispiel, dass das Parlament gar nicht beschlussfähig sei. Als die CDU darüber abstimmen wollte, ob das Parlament beschlussfähig sei, ließ er das nicht zu, weil das Parlament angeblich nicht beschlussfähig sei.
Er ignorierte einfach jegliche Anträge aller Parteien. Er ließ nicht darüber abstimmen, stimmte nicht dagegen, er ignorierte einfach, dass sie gestellt wurden. Er blockierte ALLES, angefangen davon, überhaupt mit der korrekten Tagesordnung zu beginnen. Die anderen Parteien konnten nichts dagegen tun, außer zu protestieren, was der Rechtsextremist ignorierte. Nicht nur das, er wollte ihnen sogar die Möglichkeit zum Protest entziehen und verlangte, dass die Mikrofone der anderen Abgeordneten einfach abgeschaltet werden sollten. Er verteilte „Ordnungsrufe“, ignorierte die Proteste darüber, dass er das nicht durfte und machte einfach weiter.
Das ist das Demokratieverständnis der AfD: Alle anderen sollen mundtot gemacht werden, dass die Faschisten einfach nach ihren eigenen Spielregeln machen können, was sie wollen. Einparteienherrschaft wie in der DDR. Unfassbar. Die Sitzung wurde nach diesem unwürdigen Chaos mehrfach unterbrochen und jetzt bis auf Samstag verschoben. Thüringen hat bisher noch kein Parlament, weil die Faschisten alles blockiert haben. So etwas hat es noch nie gegeben.
Demokratieverachtend: AfD entlarvt sich selbst
Die AfD sabotierte gleich die erste Sitzung des Thüringer Landtags, bevor dieser sich überhaupt konstituieren konnte. Sie zeigte dabei eine Verachtung für demokratische Prozesse, vor denen die ganze Zeit gewarnt wurde. Sie ignorierte die Mehrheitsmeinung im Parlament. Jetzt muss das Verfassungsgericht angerufen werden, um die Faschisten zu zwingen, dass das Parlament endlich seine Tagesordnung durchgeht.
Das heutige Chaos im Thüringer Landtag wäre auch völlig vermeidbar gewesen. Die Grünen hatten vor einiger Zeit vorgeschlagen, den „Alterspräsident“ des Parlaments nicht nach Lebensalter, sondern nach seiner Zeit im Parlament zu ernennen. Dann wäre Jürgen Treutler von der AfD nicht Alterspräsident geworden und hätte nicht die erste Sitzung sabotieren können. Leider hat die CDU, deren Stimmen nötig gewesen wären, hier auch keine Maßnahmen ergriffen.
Trotzdem hat sich der Zirkus der Faschisten zumindest in einer Hinsicht gelohnt, denn jetzt wissen offensichtlich alle, woran wir hier sind. Die AfD steht eben nicht nur im Verdacht, die Menschenwürde abschaffen zu wollen, wie das Oberverwaltungsgericht Münster festgestellt hat, sondern auch das Selbstorganisationsrecht der Parlamente. Die AfD richtet sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung und verachtet demokratische Prozesse.
Alle Demokraten verurteilen die „Machtergreifung“ der AfD
Die CDU Thüringen warf der AfD während der Sitzung eine „Machtergreifung“ vor.
Die Abgeordnete Janine Merz kritisiert den Alterspräsidenten: „Sie bestimmen nicht alleine über die Geschäftsordnung dieses Landtages.“
Der SPD Abgeordnete Hey sprach gar von „Weimarer Republik“:
Das muss jetzt passieren
Tatsächlich hat sich die faschistische AfD hier ein ziemliches Eigentor geschossen. Sie hat vor zig Kameras gezeigt, wie wenig sie von demokratischen Prozessen hält. Die Meinung unserer gewählten Volksvertreter war ihr erkennbar egal. Unseren gewählten Repräsentanten sollten sogar die Mikros abgestellt werden und ihnen wurde kein Stimmrecht gewährt.
Das tut man nicht in einem demokratischen Rechtsstaat. Es reiht sich ein in eine Liste aus Demokratie-Verachtung durch die AfD. Viele, die bisher bei einem Verbotsverfahren skeptisch waren, wollten lieber eine weitere Beobachtung durch den Verfassungsschutz abwarten. Aber wieso abwarten, wenn die AfD diese Dinge doch in aller Öffentlichkeit tut? Worauf wollen wir warten?
Bis die AfD genug Macht hat und Stimmen kriegt, dass es zu spät ist, sie aufzuhalten? Das Verbotsverfahren dauert ohnehin lange, warum mit der Materialsammlung und Erstellung des Antrags noch länger warten? Man kann doch endlich zumindest einmal anfangen, und sehen, wie viel man zusammen bekommt. Aber heute in Thüringen hat jeder doch selbst beobachten können, was diese Partei macht, sobald sie etwas Macht bekommt.
Wir haben genug von Ein-Parteien-Herrschaft hier in Deutschland, wie sie die AfD heute in Thüringen offenbar durchboxen wollte. Genau für solche Fälle ist die Demokratie in Deutschland wehrhaft. Genau dafür haben die Begründer des Grundgesetzes das Verbotsverfahren ermöglicht. Das steht in unserem Grundgesetz. Unterschreibt hier gemeinsam mit 850.000 anderen, dass der Bundesrat sich endlich bewegen soll.
Artikelbild: Martin Schutt/dpa
https://www.volksverpetzer.de/
2.5.1 Online-Artikel zu Angriffen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, gegen die Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht im Juli 2025
Nius und andere
Lobbycontrol fordert Maßnahmen gegen superreiche Finanziers rechter Hetzportale
Der Verein Lobbycontrol hat sich für Maßnahmen gegen den Einfluss „rechter Hetzplattformen“ und „Superreicher“ ausgesprochen, die sie finanzieren.
15.10.2025
Das Logo von LobbyControl Köln, Am Justizzentrum, ist im Eingangsbereich befestigt.
LobbyControl schlägt als Beispiel einen Parteispendendeckel vor. (Sascha Steinach via www.imago-images.de)
Es gehe um den Schutz der Demokratie, sagte Sprecherin Christina Deckwirth dem Deutschlandfunk. Sie schlägt als Beispiel einen Parteispendendeckel vor. Ein Unternehmer wie Frank Gotthardt, der hinter dem Portal Nius stehe, lasse den Parteien sehr viel Geld zukommen und gewinne dadurch politischen Einfluss. Deckwirth fügte hinzu, auch insgesamt müsse es mehr Sensibilität gegenüber dem Einfluss Superreicher geben, die Hetzkampagnen finanzierten und so politische Macht bekämen.
Die Kampagnen lassen sich nicht immer auf einen Urheber zurückführen. Meistens gibt es keinen einzelnen, zentralen Akteur. Im Internet finden sich in der Regel Gleichgesinnte zusammen. Sie treiben ihre Ziele aus Eigenantrieb und ohne Absprachen voran. Insgesamt zwei Drittel der letztlich erfolgreichen Kampagne gegen die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Brosius-Gersdorf, gehen laut einer Untersuchung der Denkfabrik Polisphere auf die AfD und deren Umfeld zurück. Gesteuert gewesen sei es nicht, erklärte Geschäftsführer Philipp Sälhoff. Das sei eben auch gar nicht nötig. Es handele sich im Internet um eine sehr eingespielte Szenerie. Irgendjemand in den Sozialen Medien oder ein Blog oder ein Alternativmedium bringt einen Beitrag, und andere aus der Szene springen darauf an und verbreiten ihn. Das ist einstudiert. Da müsste niemand unbedingt jemanden erst anrufen oder antexten.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
https://www.deutschlandfunk.de/
„Superreiche“ und rechte Hetzportale: Lobbycontrol schlägt Maßnahme vor
Stand:14.10.2025, 11:20 Uhr
Von: Franziska Schwarz
Kampagnen im Internet sind oft dezentral, aber erfolgreich. Jüngeres Beispiel: Brosius-Gersdorf. Die NGO will deshalb ans Finanzielle.
Köln – Der Verein Lobbycontrol fordert Schritte gegen den Einfluss rechter Hetzplattformen. Sprecherin Christina Deckwirth hat im Deutschlandfunk (Dlf) zudem den Einfluss „Superreicher“, die solche Plattformen finanzieren, kritisiert. Es gehe um den Schutz der Demokratie. Konkret fordert Lobbycontrol einen Parteispendendeckel.
Illustration - Cyberkriminalität.
Alternativmedien werden laut „Polisphere“ gerne Ausgangspunkt von Hetzkampagnen im Netz (Symbolbild). © Silas Stein/dpa
In dem Bericht betonte der Deutschlandfunk den Fall Frauke Brosius-Gersdorf: Laut einer Untersuchung der Denkfabrik Polisphere gingen zwei Drittel der erfolgreichen Kampagne gegen Brosius-Gersdorf auf die AfD und deren Umfeld zurück. Die SPD hatte die Juristin dieses Jahr als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht aufgestellt.
Rechte Hetzplattformen in Deutschland: Lobbycontrol fordert Parteispendendeckel
Polisphere-Geschäftsführer Philipp Sälhoff erklärte dem Deutschlandfunk zufolge, dass solche Kampagnen im Internet nicht zentral gesteuert werden müssten, da sich Gleichgesinnte ohne direkte Absprachen zusammenfinden und ihre Ziele aus Eigenantrieb vorantreiben. In der eingespielten Szenerie der sozialen Medien reiche es, wenn ein Beitrag von einem Blog oder Alternativmedium veröffentlicht werde, woraufhin andere ihn automatisch verbreiten.
Als Beispiel für die von ihr kritisierten „Superreichen“ nannte die Lobbycontrol-Sprecherin Unternehmer Frank Gotthardt. Er ist Hauptfinanzier des als rechtspopulistisch eingestuften Online-Portal Nius des früheren Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt, und daher eine Reizfigur. So nannte etwa der CDU-Politiker Ruprecht Polenz Nius auf X ein „AfD-freundliches Hetzportal“.
„Nius“-Finanzier Frank Gotthardt will „Fox News“ auf Deutsch
Im Jahr 2024 berichtete das Handelsblatt, Gotthardt wolle mit Nius ein deutsches Pendant zu Fox News aufbauen.
Das Portal t-online.de befasste sich im Januar 2025 mit Gotthardts Großspenden an politische Parteien: je 100.000 Euro an CDU und FDP, kurz vor der Bundestagswahl 2025. Beträge über 35.000 Euro müssen die Parteien offiziell melden. Ob auch eine Spende an die AfD ging, ist nicht bekannt.
Klöckner (CDU) vergleicht „taz“ mit „Nius“ – Reichinnek (Linke) fordert Rücktritt
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner geriet dann wegen ihres Auftrittes auf einem CDU-Sommerfest, das von Gotthardt ausgerichtet wurde, in die Kritik. Denn auf der Veranstaltung zog Klöckner Vergleiche zwischen der linken taz und Nius. Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek empfahl der CDU-Politikerin daraufhin den Rücktritt, denn sie verharmlose damit rechte Hetze und Desinformation.
Die NGO Lobbycontrol argumentiert aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive und kämpft gegen problematischen Lobbyismus. Die Kritisierten erwidern manchmal. Im Jahr 2022 antwortete die damalige Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, auf Lobbycontrol-Kritik: Ihre Mitgliedschaften in Vereinen, an denen die Rüstungsindustrie beteiligt ist, würden ihre Integrität nicht beeinträchtigen, so die Auffassung der FDP-Politikerin. (Quellen: Deutschlandfunk, t-online.de, Handelsblatt, dpa, politikexpress.de) (frs)
https://www.fr.de/
Nach missglückter Richterwahl
Frauke Brosius-Gersdorf wartet immer noch auf Anruf von Friedrich Merz
Ihre Wahl zur Verfassungsrichterin im Bundestag war dramatisch gescheitert, daraufhin zog Frauke Brosius-Gersdorf ihre Kandidatur zurück. Nun äußert sich die Juristin in einem Interview – und hadert mit ihrer Entscheidung.
01.10.2025, 16.06 Uhr
- Frauke Brosius-Gersdorf
- Im zweiten Anlauf: Bundestag bestätigt drei Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht Bundestag bestätigt drei Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht
Bild vergrößern
Frauke Brosius-Gersdorf Foto: Britta Pedersen / dpa
Der Streit über die Personalie Frauke Brosius-Gersdorf hatte die schwarz-rote Koalition in eine tiefe Krise gestürzt. Die Juristin zog schließlich selbst ihre Kandidatur für ein Amt als Bundesverfassungsrichterin zurück. Mit der Entscheidung hadert sie jedoch noch immer, wie Brosius-Gersdorf nun gegenüber der »Zeit« verdeutlicht hat. Damit hätten sich letztlich »unsachliche Kampagnen durchgesetzt«.
Ihr Schritt sei trotzdem richtig gewesen. Ab einem gewissen Zeitpunkt sei klar gewesen, dass sie nicht gewählt werde. »Ich hatte den Eindruck, der Streit innerhalb der Koalition könne sich derart zuspitzen, dass es keinen vernünftigen Ausweg mehr gibt«, so die Juristin. »Mir war außerdem wichtig, eine Beschädigung des Bundesverfassungsgerichts zu verhindern.«
»Ich werde diesen Sommer nicht so schnell vergessen«
Wegen Vorbehalten aus der Union gegen die von der SPD nominierte Brosius-Gersdorf war die Wahl von drei Verfassungsrichtern im Juli abgesagt worden. Im August zog die Juristin schließlich ihre Kandidatur zurück. Die SPD schickte daraufhin Sigrid Emmenegger ins Rennen. Sie wurde vergangene Woche schließlich im zweiten Anlauf zur Richterwahl zusammen mit Ann-Katrin Kaufhold und Günter Spinner zu neuen Verfassungsrichtern gewählt.
Brosius-Gersdorf äußerte sich erfreut über die geglückte Wahl. »Das ist gut für das Bundesverfassungsgericht, aber auch für unsere Demokratie.« Die zurückliegenden Monate seien eine »Achterbahnfahrt der Gefühle« gewesen, sagte sie. »Ich werde diesen Sommer nicht so schnell vergessen.«
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe sich in dieser schwierigen Zeit nicht bei ihr gemeldet. »Ich kenne ihn aus einer Zusammenarbeit vor vielen Jahren, die ich als angenehm in Erinnerung habe. Ich fand es aber nicht richtig, dass er die Richterwahl im Plenum des Bundestags zu einer Gewissensfrage erklärt hat«, sagte Brosius-Gersdorf. »Das ist keine Gewissensfrage, sondern eine Personalentscheidung, für die eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erforderlich ist und für die man auch die Opposition braucht.«
Ex-Bundesverfassungsrichterin Susanne Baer: »Nichts ist gefährlicher als schwache Richter, denn sie werden ideologische Richter« Von Melanie Amann und Dietmar Hipp
»Nichts ist gefährlicher als schwache Richter, denn sie werden ideologische Richter«
Neue Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht: Wer ist Sigrid Emmenegger? Von Dietmar Hipp, Karlsruhe
Wer ist Sigrid Emmenegger?
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) habe sie hingegen unmittelbar nach ihrer Rückzugserklärung angerufen. »Es war ein kurzes Telefonat, in dem er eingeräumt hat, dass einiges nicht so gut gelaufen sei. Und dass er das bedaure.«
Eine derartige »Politisierung der Richterwahl«, wie man sie im Sommer erlebt habe, bleibe hoffentlich ein einmaliger Fall, so Brosius-Gersdorf. »Wir erleben Gott sei Dank bislang keine Politisierung der Justiz, sie arbeitet unabhängig. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz und vor allem in das Bundesverfassungsgericht ist zu Recht hoch.«
Warum der Ärger um die Wahl der Richter fürs Bundesverfassungsgericht noch immer nachwirkt, lesen Sie hier .
eru/dpa
https://www.spiegel.de/
Klöckners Auftritt in Koblenz
Wertschätzung für Nius-Finanzier Gotthardt?
Stand: 16.08.2025 12:18 Uhr
Bundestagspräsidentin Klöckner polarisiert erneut: Sie will auf einem Sommerfest der CDU sprechen, das bei einem Koblenzer Unternehmer gastiert. Der tritt auch als Finanzier des rechten Portals Nius in Erscheinung.
Juri Sonnenholzner
Von Juri Sonnenholzner, SWR
2019 erntete Julia Klöckner viel Kritik. Damals war sie Ernährungsministerin und der offizielle Twitter-Accounts ihres Ministeriums teilte ein Video. Es zeigte Klöckner mit dem Deutschland-Chef des Lebensmittel-Riesen Nestlé. Der Mann aus der Wirtschaft sprach nah neben ihr davon, dass das Unternehmen Zucker, Fett und Salz in vielen seiner Fertigprodukte verringert habe.Kritiker sahen darin eine Art Schleichwerbung. Sascha Raithel, Professor für Marketing in Berlin, nannte es damals einen "PR-Coup" für den Konzern.
Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X angezeigt werden.
Bundestagspräsidentin repräsentiert gesamtes Parlament
Es ist eine alte Geschichte, die sechs Jahre her ist. Das ist viel Zeit, um dazuzulernen. Mittlerweile ist Klöckner Bundestagspräsidentin. Das Amt stellt andere Anforderungen als an eine Ministerin: Es geht damit einher, die Würde des Bundestags zu wahren. Bei wichtigen politischen und gesellschaftlichen Anlässen soll das gesamte Parlament repräsentiert werden. Solch einen veranstaltet die CDU Koblenz am Sonntagnachmittag. "Die Politik in Berlin ist in Bewegung und es gibt viel zu berichten", heißt es in der Einladung zum "Sommerempfang". Das soll Klöckner bei ihrem Auftritt leisten. Die Veranstaltung ist offen für jedermann, so können ihr auch Vertreter anderer Parteien zuhören.
CGM-Gründer Gotthardt hält das Grußwort
Veranstaltungsort in Klöckners Nachbar-Wahlkreis ist das "Innovationszentrum" des Koblenzer Unternehmens CompuGroup Medical (CGM). Software für Arztpraxen und Apotheken machte CGM zu einem der größten Arbeitgeber in der Region und ihren Gründer und Verwaltungsratsvorsitzenden Frank Gotthardt vermögend. Er, der parteilos und Ehrenvorsitzender des rheinland-pfälzischen CDU-Wirtschaftsrats ist, wird in seinen Räumlichkeiten eines der Grußworte halten, bevor Klöckner das Wort ergreift. Offensichtlich ist es für jeden Unternehmer eine besondere Würdigung, die Vertreterin des zweithöchsten Amtes im Staate auf dem eigenen Firmengelände begrüßen zu dürfen, geht dem doch ein gewisser Anspruch an die Reputation aller Beteiligten voraus.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner
02.08.2019
Kritik an Ministerin
Klöckner und die Konzernlobbyisten
Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner steht in der Kritik, falsche Prioritäten bei der Arbeit zu setzen. mehr
Mihalic: Bröckelnde Brandmauer der Union
Genau an dieser Reputation gibt es Kritik: Denn mit seinem Geld fördert Gotthardt die Internetseite Nius. Medienaufsicht, Journalistenverbände und Medienbeobachter werfen dem Portal mangelhafte journalistische Sorgfalt vor - offenbar auf Kosten von Asylsuchenden, Transsexuellen oder Politikern. Zuletzt war die Internetseite in die Kritik geraten, weil sie an der Kampagne mit diffamierenden Aussagen gegen die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, beteiligt gewesen sein soll. Die Causa wuchs sich zu einer Belastungsprobe für die Koalition aus."Dieses Zusammenspiel zwischen gezielter Desinformation und politischem Miteinander mit der CDU beschädigt zentrale demokratische Verfahren", kritisiert der rheinland-pfälzische SPD-Landesverband. Irene Mihalic, erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, sieht in Gotthardts Engagement eine Unterstützung für rechte Meinungsmache und Falschnachrichten: "Julia Klöckner sollte sehr deutlich machen, dass sie als diejenige, die das zweithöchste Staatsamt bekleidet, nicht ein weiterer Stein ist, der aus der ohnehin schon bröckelnden Brandmauer der Union fällt."
Julia Klöckner
Player: audioBundestagspräsidentin Klöckners Amtsführung: polarisierend oder präsidial?
06.06.2025
Bundestagspräsidentin Klöckner
Polarisierend oder präsidial?
Bundestagspräsidentin Klöckner ist noch relativ neu in ihrem Amt. Wie ist der erste Eindruck? mehr
CDU spricht von "Sommerlochdiskussion"
Die CDU kann die Aufregung nicht nachvollziehen: "Die Wahl des Veranstaltungsortes spiegelt unsere Wertschätzung für die Rolle der CGM als Arbeitgeber und Impulsgeber für die Region und für die Leistung der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wider", heißt es in einer Stellungnahme - ohne ein Wort zu Gotthardts medialen Aktivitäten. Mit denen hat der CDU-Landeschef Gordon Schnieder nach eigenen Aussagen zwar ein Problem, er sehe in der Berichterstattung über den Sommerempfang aber das Ziel, "Persönlichkeiten und Firmen zu diskreditieren", sagte er dem SWR. "Das kommt mir eher nach einer Sommerlochdiskussion vor", erklärte er. Gotthardt selbst lässt auf Nachfrage des SWR über seinen Anwalt ausrichten, dass für ihn die Meinungs- und Pressefreiheit aller Medien ein hohes Gut sei und er nicht die Absicht habe, sich zu äußern. Im Koblenz-Podcast "Rund ums Eck" sagte er zu einem früheren Zeitpunkt, er habe einen Anreiz aus der staatsbürgerlichen Verantwortung heraus gesehen, die "Übermacht der eher links zu verortenden Medien" im konservativen Bereich zu ergänzen. Klöckner selbst reagierte via abgeordnetenwatch.de auf die Frage, wie sie ihre Teilnahme mit dem Neutralitätsgebot vereinbare: "Veranstalter des Sommerempfangs ist der CDU-Verband Koblenz, der Termin, Lokalität und Einladungskreis festgelegt hat."
Julia Klöckner
Player: videoJulia Klöckner, Bundestagspräsidentin, zu Debatte um Regenbogenflagge
29.06.2025
Klöckner im Bericht aus Berlin
"Müssen neutral sein, auch wenn das manchmal wehtut"
Bundestagspräsidentin Klöckner verteidigte ihre Entscheidung, die Regenbogenflagge nicht zu hissen. mehr
Staatsrechtler: "Das Recht greift erst bei Eindeutigkeiten"
Staatsrechtler Alexander Thiele konstatiert, dass es per se kein Problem sei, dass die Bundestagspräsidentin entsprechenden Einladungen folgt. Auch wenn diese von Parteien kommen sollte. "Allerdings hätte sie natürlich die Möglichkeit, ihre Teilnahme aus diesen Gründen abzusagen. Allerdings könnte ihr auch das - jedenfalls politisch - als nicht neutral ausgelegt werden", sagt der Professor an der BSP Business and Law School in Berlin. So bleibe die Teilnahme im rechtlich zulässigen Bereich. Gerade deshalb gehe aber von ihr auch eine politische Entscheidung mit einer gewissen Signalwirkung aus, sagt Thiele. "Die man daher auch kritisieren darf. Und genau das geschieht ja auch." In dieser Diskussion könne auch der Standpunkt eingenommen werden, Klöckner stehe für Meinungsvielfalt ein, verdeutlicht Thiele .Solange die verfassungsrechtlichen Grenzen nicht erreicht seien, bleibe auch die Frage, wie man für verfassungsrechtliche Werte eintrete, eine politische: "Diese Ambivalenz ist genau das, was das Politische ausmacht. Das Recht greift, verlangt oder verbietet erst bei Eindeutigkeiten. Und die sind hier nicht erreicht", sagt Thiele.
Nutzt Klöckner den Auftritt für einen Appell?
Im Jahr 2019, als jenes Nestlé-Video die Runde machte, stellte Klöckner allen Unkenrufen zum Trotz ihr Video als Erfolg dar. Es sei ihr darum gegangen, "Druck auf die Unternehmen zu machen", freiwillig den Zuckergehalt in ihren Lebensmitteln zu reduzieren. Und Nestlé stehe nun unter Druck. Vielleicht nutzt die Bundestagspräsidentin den Sommerempfang am Sonntag in Koblenz genauso für einen Appell an den Medienunternehmer Gotthardt, für ein bisschen "Druck".
Dieses Thema im Programm:
Über dieses Thema berichtete SWR aktuell Rheinland-Pfalz am 14. August 2025 um 19:30 Uhr.
https://www.tagesschau.de/
Verfassungsgericht:
Ghostwriting-Verdacht gegen Brosius-Gersdorf: Plagiatsjäger verweigert Unterlassungsaufforderung
Plagiatsjäger Stefan Weber hält an seinen Gutachten über die ehemalige Richterwahlkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf fest. Eine Abmahnung lässt er unbeachtet.
Author - Sophie-Marie Schulz
13.08.2025 , 16:23 Uhr
Frauke Brosius-Gersdorf, gescheiterte Richterkandidatin, geht rechtlich gegen den österreichischen Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber vor.
Britta Pedersen/dpa
Der österreichische Kommunikationswissenschaftler und selbsternannte Plagiatsjäger Stefan Weber wird die von den Eheleuten Brosius-Gersdorf geforderte Unterlassungserklärung nicht abgeben. Das teilte die Anwaltskanzlei Höcker in einer Pressemitteilung mit.
Weber hält weiterhin an seinen Gutachten fest, die nahelegen sollen, dass es bei der Doktorarbeit von Prof. Dr. Frauke Brosius-Gersdorf zumindest teilweise Ghostwriting durch ihren Ehemann, Prof. Dr. Hubertus Gersdorf, gegeben haben könnte. Rechtsanwalt Dr. René Rosenau erklärt dazu: „Mein Mandant dokumentiert Fakten. Fakten lassen sich nicht abmahnen, und das Gutachten verschwindet nicht, nur weil Frau Brosius-Gersdorf es gern verschwinden sähe.“
Bärbel Bas: Nach dem Sommerinterview zweifelt sie plötzlich an ihrem Ministerposten
Politik
11.08.2025
Ärger um Brosius-Gersdorf: CDU-Politikerin Saskia Ludwig schreibt Brief an Spahn
Nach Ärger um Brosius-Gersdorf: CDU-Politikerin schreibt wütenden Brief an Spahn
News
11.08.2025
Webers Anwalt betont, dass die Einschätzungen seines Mandanten auf wissenschaftlicher Analyse und empirischen Untersuchungen beruhen. In der Pressemitteilung heißt es: „Die angegriffenen Aussagen sind nicht als Verdachtsäußerungen, sondern als Schlussfolgerungen und damit Meinungsäußerungen innerhalb eines auf wissenschaftlicher Grundlage erstellten Gutachtens zu qualifizieren.“
Dem Gutachten zufolge gibt es zahlreiche Textübereinstimmungen zwischen der Doktorarbeit von Brosius-Gersdorf und der Habilitationsschrift sowie weiteren Arbeiten ihres Ehemanns. „Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Autoren unabhängig voneinander identische Sätze, Absätze oder gleiche Zitierfehler produzieren, ist äußerst gering“, betont Weber.
Die Eheleute Brosius-Gersdorf hatten daraufhin Weber abmahnen lassen und ihm vorgeworfen, gegen die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung verstoßen zu haben. Sie kritisierten, dass es an Beweisen fehle und Weber sie vor Veröffentlichung nicht angehört habe.
Weber und seine Anwälte weisen diese Vorwürfe zurück. Sie argumentieren, dass wissenschaftliche Gutachten grundsätzlich als Meinungsäußerungen zu werten seien und das Gutachten damit rechtlich abgesichert bleibe.
https://www.berliner-zeitung.de/
Kaufhold als nächstes Ziel: AfD mobilisiert gegen zweite SPD-Kandidatin
Stand:10.08.2025, 04:52 Uhr
Von: Konstantin Ochsenreiter
Nach Brosius-Gersdorfs Aufgabe greift die AfD Kaufhold an. Die Kandidatin wird als „untragbar“ abgestempelt. Die rechtsextreme Szene fühlt sich bekräftigt.
Berlin – Nach dem freiwilligen Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht rufen die AfD und weitere rechtsextreme Akteure nun zu einer zweiten Runde des Kulturkampfes auf: Die Wahl der nächsten SPD-Kandidatin, Ann-Katrin Kaufhold, soll verhindert werden.
„Der nächste Kampf geht gegen Kaufhold“: AfD mobilisiert erneut
In einem Video verkündet der Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner (AfD): „Der nächste Kampf geht gegen Kaufhold“, und bezeichnete die Kandidatin als „untragbar“ und „hochgefährlich“.
Die Bundes-AfD diffamiert die Professorin in sozialen Netzwerken als „Demokratie-Feind“ und gibt die Parole „Jetzt Kaufhold verhindern!“ aus. Brosius-Gersdorfs Abgang wird als „ein wichtiges Signal“, aber kein Grund zur Entwarnung bewertet.
Der Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf, der auf den massiven Druck zurückgeführt wird, hat die rechtsextreme Szene in Deutschland gestärkt. Via Twitter reagiert AfD-Fraktionsvize Sebastian Münzenmaier auf die radikal-nationalistische Junge Freiheit und freut sich: „Der Druck von rechts wirkt!“ Er fügt hinzu, auch Kaufhold solle „merken, dass sie als oberste Richterin nicht vermittelbar ist“.
Die AfD auf Rechtskurs: Von Bernd Lucke bis Alice Weidel – Streit war gestern
AfD-Bundesparteitag in Riesa mit Alice Weidel
Fotostrecke ansehen
Politikberater warnt: Eine hochqualifizierte Richterin, „als linke Aktivistin dämonisiert“
Gegenüber dem Tagesspiegel interpretiert Politikberater Johannes Hillje den Kampf der AfD gegen Kaufhold als den Versuch, „eine zweite Runde im Kulturkampf um das Verfassungsgericht einzuläuten“. Er betont, dass erneut eine „hochqualifizierte Frau als linke Aktivistin dämonisiert“ werde.
Meine News
Geplatzte Wahl
Geplatzte Richterwahl: SPD schließt neue Kandidatin aus – Appell an Union
Richterwahl: Die Sprecherin der SPD-Linken fordert von der Union die Zustimmung für die Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf.
Bundesverfassungsgericht
Beben in der SPD nach Brosius-Gersdorf-Rückzug
Brosius-Gersdorf
Berliner Koalition
Ein neuer Name muss nun her
ARCHIV - 01.07.2025, Berlin: Stefanie Hubig (SPD), Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, aufgenommen bei einem Interview mit der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH im Justizministerium. (zu dpa: „Justizministerin für Konsequenzen aus Fall Brosius-Gersdorf“) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
Bundesverfassungsgericht
Brosius-Gersdorf reagiert auf rechte Vorhaltungen
Richterin Frauke Brosius-Gersdorf in der Talk-Sendung „Markus Lanz“.
Das übergeordnete Ziel solcher Kampagnen sei es, sowohl die Regierungskoalition als auch die Gesellschaft zu spalten.
De Anhänger der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ fühlen sich bestärkt und wollen weiterhin agieren. Die rechte Plattform „Apollo News“, die sich an der Kampagne gegen Brosius-Gersdorf beteiligt hatte, kündigte ebenfalls an, weiter aktiv zu bleiben: Es ginge um eine „politisch grundsätzliche Frage“.
Kulturkampf um Verfassungsgericht: Rechtsextreme gegen Kaufhold
Rechtsextreme begründen ihre Ablehnung gegen Ann-Katrin Kaufhold mit Vorwürfen, sie sei eine „radikale Klimaaktivistin“ oder „Enteignungsbefürworterin“.
Kaufhold kandidiert jedoch für den zweiten Senat des Gerichts, der sich nicht mit Klimapolitik beschäftigt. Der Vorwurf der „Enteignungsbefürworterin“ spielt darauf an, dass der Berliner Senat sie in eine Experten-Kommission berufen hatte. Diese soll die Zulässigkeit von Vergesellschaftungen großer Wohnungskonzerne prüfen.
Wer ist Ann-Katrin Kaufhold?
Alter 49 Jahre
Beruf Professorin
Lehrtätigkeit Ludwig-Maximilians-Universität München
Kandidatur für Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts
Weitere Rolle Mitglied einer Experten-Kommission des Berliner Senats zur Prüfung von Vergesellschaftungen großer Wohnungskonzerne
Union gibt sich nach Richterwahlfiasko wortkarg: Kaufhold unter Druck
Frauke Brosius-Gersdorf hatte wegen des Widerstands aus der Union ihre Kandidatur für das Bundesverfassungsgericht zurückgezogen. Sie warf der Union vor, einer Diffamierungskampagne aufgesessen zu sein.
Ann-Katrin Kaufhold, AfD
Unerwartet, trotzdem da: SPD-Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold. Kann sie der AfD und deren Schattenmännern die Stirn bieten? (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa/ C.Olesinski/ picture alliance/dpa/LMU
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) zollt Brosius-Gersdorf zwar in ein paar Sätzen Respekt, eine Faktionssitzung oder ein Informationsschreiben an die Unionsabgeordneten gibt es jedoch nicht. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärt ein Sprecher, es besteht „aktuell kein drängender Informationsbedarf“. (kox)
https://www.fr.de/
Bundesverfassungsgericht: Juli Zeh: Würde Nominierung für Karlsruhe ablehnen
Sie fühlt sich dem Land verpflichtet, sagt die Bestsellerautorin und Juristin Juli Zeh. Warum eine Nominierung fürs Bundesverfassungsgericht aber nicht infrage käme.
Stand: 09.08.2025, 12:30 Uhr
Die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh würde eine Nominierung für das Bundesverfassungsgericht ausschlagen. Der „Berliner Zeitung“ sagte sie auf die Frage, ob sie die Nominierung annehmen würde, wenn man sie vorschlagen würde: „Ich würde das als eine große Ehre betrachten und mich heftig mit der Entscheidung quälen, weil ich eine hohe Dankbarkeit gegenüber unserem Land empfinde und mich berufen fühle, durch mein Engagement etwas zurückzugeben, wenn ich kann. Aber am Ende würde ich die Nominierung ablehnen, weil sie bedeuten würde, meine künstlerische Arbeit komplett an den Nagel zu hängen.“
Die Bestsellerautorin Zeh ist SPD-Mitglied und ehrenamtliche Richterin am Landesverfassungsgericht in Brandenburg.
Rückzug von Potsdamer Jura-Professorin Brosius-Gersdorf
Die Potsdamer Jura-Professorin Frauke Brosius-Gersdorf hatte ihre Bereitschaft zur Kandidatur als Richterin am Bundesverfassungsgericht vor einigen Tagen zurückgezogen. Die Wahl von Brosius-Gersdorf und zwei weiteren Kandidaten für das höchste deutsche Gericht war im Juli im Bundestag geplatzt. Der Widerstand in der Unionsfraktion gegen die SPD-Kandidatin war zu groß geworden.
Zeh nennt hohe Arbeitsbelastung
Der „Berliner Zeitung“ sagte Zeh: „Schon Landesverfassungsrichter müssen sehr viel arbeiten und werden dafür traurigerweise nicht einmal bezahlt, abgesehen von einer Aufwandsentschädigung - wir arbeiten alle ehrenamtlich.“ Am Bundesverfassungsgericht sei die Arbeitsbelastung ungleich höher, das könne man nicht zusätzlich zu einer anderen Tätigkeit machen.
Zum Rückzug von Brosius-Gersdorf sagte Zeh unter anderem: „Aus meiner Sicht illustriert ihr Fall ein Versagen von Medienvertretern und auch zum Teil Bundestagsabgeordneten, die lieber auf Empörungsbereitschaft und Skandalisierung setzen, anstatt sachliche Argumente und Informationsvermittlung in den Vordergrund zu stellen.“
https://www.tagesspiegel.de/
Justiz: Fall Brosius-Gersdorf: SPD mahnt Union zur Verlässlichkeit
Die Juristin Brosius-Gersdorf war von der SPD als Verfassungsrichterin nominiert - nun hat sie ihre Kandidatur zurückgezogen. In der Koalition ist Vertrauen verloren gegangen.
Stand: 08.08.2025, 05:16 Uhr
Nach dem Rückzug der von der SPD nominierten Verfassungsrichterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf erwarten die Sozialdemokraten mehr Verlässlichkeit und Loyalität von ihren Koalitionspartnern CDU und CSU.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur, „Kampagnen“ dürften nicht dazu führen, dass man talentierte und qualifizierte Bewerber – und vor allem Bewerberinnen – verliere. „Wir müssen daraus lernen – alle gemeinsam. Es geht um eine bessere Diskussionskultur und darum, solchen Angriffen auf die Demokratie künftig besser standzuhalten.“
Die Wahl der Potsdamer Juraprofessorin Brosius-Gersdorf und zwei weiteren Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht war im Juli im Bundestag kurzfristig abgesetzt worden, weil der Widerstand in der Unionsfraktion gegen die SPD-Kandidatin zu groß geworden war. Die Fraktionsspitze konnte die dem Koalitionspartner SPD zugesagte Unterstützung nicht garantieren. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch schrieb in einem Brief an seine Abgeordneten, CDU und CSU müssten sich nun zu den Spielregeln des Regierens bekennen. „Nur wenn Zusagen Bestand haben, sind tragfähige Kompromisse möglich. Nur dann können wir Vertrauen zurückgewinnen und politische Handlungsfähigkeit sichern.“
Die Unionsspitze habe zunächst wiederholt ihre Zustimmung zu Brosius-Gersdorf signalisiert. „Dass sich zentrale Teile der CDU/CSU-Fraktion am Ende davon distanziert haben, erschüttert nicht nur Vertrauen, sondern stellt das Fundament infrage, auf dem demokratische Zusammenarbeit überhaupt möglich ist.“ Weiter schrieb Miersch: „Vielleicht fragen sich einige von Euch, wie belastbar diese Koalition überhaupt noch ist, wenn sich der andere Partner nicht an Absprachen hält. In dem Zustand, in dem sich die Unionsfraktion bei der Richterwahl präsentiert hat, ist diese Frage berechtigt.“
Bundesregierung „zum Gelingen verdammt“
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident und Vizechef der Bundes-SPD, Alexander Schweitzer, rief zu besserer Zusammenarbeit in der Koalition auf. „Diese Bundesregierung ist zum Gelingen verdammt“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Ich kann nur hoffen, dass dies alle vor Augen haben, allen voran Bundeskanzler Friedrich Merz.“
Die vor allem in der Union umstrittene Brosius-Gersdorf hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass sie nicht länger für eine Kandidatur als Richterin am Bundesverfassungsgericht zur Verfügung stehe. Ihr sei aus der CDU/CSU-Fraktion sehr deutlich signalisiert worden, dass ihre Wahl ausgeschlossen sei, hieß es in einem über eine Bonner Kanzlei verbreiteten Schreiben. Zudem kritisierte die 54-jährige Staatsrechtlerin Teile der Medien, auch wenn die Berichterstattung dann sachlicher geworden sei.
Als Grund wurden unter anderem Äußerungen zum Schwangerschaftsabbruch und zu einer möglichen Impfpflicht in Corona-Zeiten angeführt. Auch meldete sich kurz vor der geplanten Wahl der Plagiatssucher Stefan Weber mit Fragen zur Dissertation der Staatsrechtlerin zu Wort. Brosius-Gersdorf hatte zunächst an ihrer Nominierung festgehalten.
Linke fordert Mitsprache
Linken-Chefin Ines Schwerdtner sagte dem Portal t-online, die Vorgänge um Brosius-Gersdorf seien ein Armutszeugnis für die Bundesregierung. Unionsfraktionschef Jens Spahn habe seine Fraktion nicht im Griff, und die Sozialdemokraten hätten „die Durchsetzungskraft eines schlafenden Kaninchens“. So werde eine Regierung keine vier Jahre durchhalten können. Bei künftigen Richterwahlen im Bundestag fordert Schwerdtner ein Vorschlagsrecht und einen Platz am Tisch für ihre Partei.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner sagte dem RND zum Rückzug von Brosius-Gersdorf: „Der Tag wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem der rechte Mob erstmals einen Triumph gefeiert hat. Die demokratischen Parteien haben sich demgegenüber als wehrlos erwiesen.“ Die Union müsse endlich verstehen, welchen Dammbruch sie ermöglicht habe.
„Beigetragen hat dazu eine Mischung aus Böswilligkeit, Fahrlässigkeit und Schlafwandlerei“, sagte Stegner. „Eine Wiederholung eines solchen Vorgangs muss ausgeschlossen werden. Merz und Spahn müssen öffentlich deutlich signalisieren, dass sie begriffen haben, was da auf dem Spiel steht.“
Der Rückzug Brosius-Gersdorfs mag die Blockade um die Richterwahl lösen, zugleich stellt er die Koalition vor ein neues (altes) Problem: im Bundestag die nötige Zweidrittelmehrheit zu finden für die Wahl ihrer Kandidaten.
Schon bei der Mitte Juli geplatzten Wahl hätte die CDU/CSU am Ende auf Stimmen der AfD angewiesen sein können. Das möchten sowohl die Union als auch die anderen Fraktionen vermeiden. Doch Gespräche mit der Linken, deren Stimmen dann nötig werden könnten, lehnte die Unionsfraktion ab.
https://www.tagesspiegel.de/
AfD will zweite SPD-Kandidatin verhindern: „Der nächste Kampf geht gegen Kaufhold“
Durch den Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf fühlt sich die rechtsextreme Szene gestärkt und plant neue Kampagnen. Zunächst soll die zweite Richterkandidatin Ann-Katrin Kaufhold zu Fall gebracht werden.
Von Sebastian Leber
Stand: 08.08.2025, 19:55 Uhr
https://www.tagesspiegel.de/
Stellungnahme von Anwaltskanzlei
Brosius-Gersdorf geht juristisch gegen selbst ernannten Plagiatsjäger vor
Der umstrittene Plagiatssucher Stefan Weber erhebt neue Vorwürfe gegen die Bundesverfassungsgerichtskandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Eine von ihr beauftragte Kanzlei droht mit rechtlichen Schritten.
07.08.2025, 12.07 Uhr
- Frauke Brosius-Gersdorf Foto: Britta Pedersen / dpa
Frauke Brosius-Gersdorf wehrt sich mithilfe einer Anwaltskanzlei gegen neue Plagiatsvorwürfe. Der selbst ernannte Plagiatsjäger Stefan Weber wirft der Kandidatin für den Posten der Verfassungsrichterin Ghostwriting vor. Brosius-Gersdorfs Ehemann Hubertus Gersdorf soll demnach als heimlicher Autor für ihre Dissertation von 1997 tätig gewesen sein.
In einer Stellungnahme weist eine Bonner Anwaltskanzlei den Vorwurf zurück. Dafür gebe es keine »Tatsachengrundlage«, heißt es darin. Es ist von einem »unzutreffenden, haltlosen und ehrverletzenden Vorwurf« die Rede. Man solle Brosius-Gersdorf konkret damit konfrontieren, damit sie dem entgegentreten könne. Rechtliche Schritte gegen Weber seien in Vorbereitung.
Brosius-Gersdorf ist von der SPD für das Bundesverfassungsgericht nominiert. Teile der Union haben jedoch Vorbehalte, unter anderem wegen früherer Äußerungen der Juristin zum Abtreibungsrecht und zu Coronaimpfungen. Ihre Wahl – gemeinsam mit zwei weiteren Nominierten für das höchste Gericht – war im Juli im Bundestag kurzfristig abgesagt worden .
Union legt Brosius-Gersdorf einen Rückzug nahe
Politiker der Union hatten Brosius-Gersdorf einen Rückzug von der Nominierung nahegelegt – nicht wegen möglicher Vorbehalte gegen ihre wissenschaftliche Arbeit, sondern wegen der politischen Widerstände in der Unionsfraktion. Die SPD hält hingegen an der Benennung der Verfassungsrechtlerin fest. Nach wie vor ist offen, wie CDU, CSU und SPD das Dilemma auflösen wollen. Einen Kommentar, warum Frauke Brosius-Gersdorf nicht zurückziehen sollte, lesen Sie hier .
Weber hatte bereits im Juli mit Blick auf Brosius-Gersdorfs Dissertation Vorwürfe erhoben. Dazu hatte Brosius-Gersdorf bei einer Stuttgarter Kanzlei ein Kurzgutachten beauftragt und veröffentlicht: »Die Prüfung hat ergeben, dass die Vorwürfe unbegründet sind und keine Substanz haben«, erklärten die Rechtsanwälte damals. Nun geht die Auseinandersetzung in die nächste Runde.
Festgefahrene Richterwahl: Warum Frauke Brosius-Gersdorf nicht zurückziehen sollte
Ein Kommentar von Felix Keßler
Warum Frauke Brosius-Gersdorf nicht zurückziehen sollte
Schwarz-Rot in der Krise: Wie die Koalition einen Weg aus dem Richterstreit finden könnte
Der SPIEGEL-Leitartikel von Maria Fiedler
Wie die Koalition einen Weg aus dem Richterstreit finden könnte
Richterinnenstreit: Die Klügere gibt nach, und das wäre diesmal die SPD
Eine Kolumne von Nikolaus Blome
Die Klügere gibt nach, und das wäre diesmal die SPD
In seinem neuen Papier verweist der umstrittene Plagiatssucher Weber auf »Textübereinstimmungen«, die die These des Ghostwritings aus seiner Sicht »stark plausibilisieren«. Als »Indizien« werden unter anderem »gemeinsame Zitierfehler und gemeinsame distinkte Formulierungen« angeführt. Zudem fänden sich unter den Quellen der Textübereinstimmungen Texte, die Hubertus Gersdorf vor 1997 publiziert habe.
Die Bonner Kanzlei weist dies in einem mehrseitigen Schreiben, das dem SPIEGEL vorliegt, zurück und spricht von einem »unzutreffenden, haltlosen und ehrverletzenden Vorwurf«. Brosius-Gersdorf »schrieb ihre Dissertation allein«, heißt es darin. »Die Dissertation wurde nicht in Teilen von Herrn Prof. Gersdorf (...) geschrieben.« Es gebe nicht einmal einen »Mindestbestand an Beweistatsachen«.
hba/dpa
https://www.spiegel.de/
Brosius-Gersdorf:
Anwalt weist Ghostwriting-Vorwurf zurück
Von Heike Schmoll, Berlin
05.08.2025, 14:46Lesezeit: 4 Min.
Sie weist die Vorwürfe zurück: Frauke Brosius-Gersdorf bei einer Pressekonferenz im April 2025
Der Plagiatssucher Weber unterstellt Frauke Brosius-Gersdorf jetzt, dass sie ihren Ehemann als Ghostwriter eingespannt habe. Der Anwalt des Ehepaares widerspricht...
Der umstrittene österreichische Plagiatssucher Stefan Weber hat auf seinem Blog weitere Vorwürfe gegen die Potsdamer Rechtswissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf geäußert, die von der SPD als Verfassungsrichter-Kandidatin nominiert worden war....
https://www.faz.net/
Umgang mit der AfD:
Die Union lässt sich jagen
Friederike Haupt
Ein Kommentar von Friederike Haupt
04.08.2025, 10:56Lesezeit: 3 Min.
Jens Spahn (CDU) zusammen mit Alexander Hoffmann (CSU), Thorsten Frei (CDU) und Alexander Dobrindt (CSU) im Mai im Bundestag.
Die AfD will Union und SPD auseinandertreiben. Ihr Plan ist nicht geheim und geht trotzdem auf. Vor allem Jens Spahn muss endlich handeln.
Die AfD jagt die Union; so hat sie es vor Jahren angekündigt, und so geschieht es nun. Doch die Gejagte stelzt umher, als sehe sie erst Handlungsbedarf, wenn sie zwischen den Zähnen des Jägers zappelte. Jüngstes Beispiel: der Fall Brosius-Gersdorf...
https://www.faz.net/
Schwesig hält an Brosius-Gersdorf für Verfassungsrichterwahl fest
DTS Nachrichtenagentur
30.07.2025
Im Ringen zwischen Union und SPD um die Verfassungsrichterwahl hat die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), die Union aufgefordert, ihre Kritik an der Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf „zurückzufahren“. „Die Kandidatin ist eine gute Kandidatin“, sagte sie der „Ostseezeitung“ (Donnerstagausgabe), die zum „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ gehört.
Schwesig Hält An Brosius-Gersdorf Für Verfassungsrichterwahl Fest
Manuela Schwesig (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Richter am Bundesverfassungsgericht müssten „fachlich hervorragend und unabhängig“ sein, so Schwesig. Sie sei „irritiert“, dass die CDU erwarte, dass Richter ihre politische Haltung zu Themen übernehmen. „Das geht nicht.“
Man müsse damit leben, dass „Richter im Zweifel anders entscheiden“. Entscheidend sei aber die fachliche und persönliche Kompetenz für dieses hohe Amt und die habe Brosius-Gersdorf. „Das ist unumstritten. Sie ist durch den Richterausschuss befragt und bestätigt worden“, sagte die SPD-Politikerin. „Und deshalb sollte die Union ihre Kritik jetzt zurückfahren. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Richterwahlen politisch motiviert sind.“
Die Wahl der Richter für das Bundesverfassungsgericht war Mitte Juli von der Tagesordnung des Bundestages genommen worden, weil die Unionsfraktion der Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf die Unterstützung entzogen hatte, obwohl sich Union und SPD zuvor auf das Personalpaket für die drei frei werdenden Richterstellen geeinigt hatten.
https://presse-augsburg.de/
Streit um Brosius-Gersdorf:
Die Richterwahl wurde auch von der CSU vergeigt
Von Timo Frasch, München
28.07.2025, 11:40Lesezeit: 4 Min.
Jetzt ist guter Rat teuer: Die Unionspolitiker Alexander Dobrindt (CSU), Jens Spahn (CDU) und Alexander Hoffmann (CSU, v.l.n.r.) im Juli im Bundestag
In der CSU herrscht inzwischen weitgehend Einigkeit: Brosius-Gersdorf ist den eigenen Leuten nicht vermittelbar. Bis zu dieser Erkenntnis war es ein langer Weg.
In der Causa Frauke Brosius-Gersdorf sind viele Fragen aufgeworfen worden, auch die nach der Haltung und der Kohärenz der CSU. Vor der avisierten Wahl der Juristin nach Karlsruhe hatte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann an die Unionsabgeordneten appelliert, den Vorschlag der SPD trotz kritischer Stimmen mitzutragen. Als die Wahl von Brosius-Gersdorf bereits abgeblasen war, zollte ihr Michael Frieser, ehemals Justiziar der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion, Respekt, dass sie ungeachtet der Kritik an ihrer Person an der Bewerbung festhalte. Ihre Positionen seien schwierig, aber nicht unvermittelbar....
https://www.faz.net/
Frauke Brosius-Gersdorf
Es tut sich was im Hintergrund
Meinung
Eine Kolumne von
Nicole Diekmann
Aktualisiert am 23.07.2025
Lesedauer: 4 Min.
Frauke Brosius-Gersdorf in der Talkshow von Markus Lanz (Archivfoto): Um die Doktorarbeit der Juristin ist in der Bundespolitik ein Streit entbrannt. Vergrößern des Bildes
Frauke Brosius-Gersdorf: Die Petition für ihre Bundesverfassungsrichterwahl zeigt Wirkung. (Quelle: IMAGO/teutopress GmbH/imago)
Die Diskussion um Frauke Brosius-Gersdorf geht weiter, Petitionen bringen Hunderttausende Unterschriften. Dabei gibt es eine gute Nachricht.
Es gibt Menschen, denen ist kaum ein Preis dafür zu hoch, in der Öffentlichkeit zu stehen. Dafür liefert Social Media Tag für Tag gigantische Datenmengen an Beweisen: Eltern, die ihre Kinder posten, ohne mit der Wimper zu zucken. Jugendliche, die bis an den Rand des Todes – und in tragischen Fällen darüber hinaus – sogenannte Mutproben absolvieren. Influencerinnen, die schnell noch Smartphonekamera und Licht professionell justieren, bevor sie wegen etwas anfangen zu weinen. Oder umgekehrt.
Nicole Diekmann
(Quelle: Reinaldo Coddou H.)
Zur Person
Die Fernsehjournalistin Nicole Diekmann kennt man als seriöse Politikberichterstatterin. Ganz anders, nämlich schlagfertig und lustig, erlebt man sie auf X – wo sie über 120.000 Fans hat. Ihr Buch "Die Shitstorm-Republik" ist überall erhältlich. Bei t-online schreibt sie jeden Mittwoch die Kolumne "Im Netz". Mehr
Nach dem Wenigen, was wir über Frauke Brosius-Gersdorf wissen, gehört sie nicht zu dieser Sorte Mensch. Sollte sie aber bis vor wenigen Wochen doch dazugehört haben, können wir von zwei Dingen ausgehen: Erstens war sie vorher nicht sehr erfolgreich mit ihrem Bemühen, von einer breiten Masse wahrgenommen zu werden. Zweitens wird sie inzwischen festgestellt haben: Das klingt in der Theorie oft verheißungsvoller, als es in der Praxis dann ist. Drohungen, Schmähungen, Falschbehauptungen – die vergangenen Wochen haben mal wieder gezeigt, wie aktiv der Mob vom Sofa aus werden kann. Und wie allzu gern ihn manche Portale anheizen. Auch Politiker und Politikerinnen bürgerlicher Parteien machen gern dabei mit.
Insofern dürfte die Verfassungsrechtlerin aktuell vorsichtig aufatmen: Ganz verschwunden ist das Drama um ihre geplatzte Wahl zur Bundesverfassungsrichterin aus Schlagzeilen und sozialen Netzwerken zwar nicht – aber es beherrscht sie auch nicht mehr. Viele in der CDU/CSU, aber auch in der SPD, dürften darüber erleichtert sein. Das Interesse daran, das für die Koalition (freundlich formuliert) äußerst schwierige Thema weiter öffentlich breitzutreten, statt erst mal intern zu besprechen, haben momentan nur solche, die sich ein anderes Regierungsbündnis wünschen.
Plötzlich sind alle Verfassungsjuristen
Nun ist vorerst Sommerpause, außerdem sind andere Themen in den Vordergrund gerückt. Im Hintergrund aber wird natürlich weiter gewerkelt. Denn auch in der Sommerpause arbeiten Politiker, allen Behauptungen am realen und virtuellen Stammtisch zum Trotz. Und auch die Zivilgesellschaft ist nicht untätig. Auch nicht in Sachen Brosius-Gersdorf.
"Petition für Brosius‑Gersdorf knackt 165.000 Unterschriften – und übertrumpft rechte Fake News-Kampagne deutlich", jubeln jetzt die Verantwortlichen hinter der Petitionsplattform innn.it in einer Pressemitteilung. Seit knapp einer Woche versammeln sich dort Menschen, die Brosius-Gersdorf weiterhin am höchsten deutschen, nämlich dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, sehen wollen. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Einer lautet: Weil sie sie für fähig halten. Wobei sich die tatsächliche Expertise für Verfassungsrecht im breiten Volk womöglich nicht ganz auf dem Niveau bewegt, das die (wieder freundlich formuliert) angeregte Diskussion in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Wochen suggeriert. 83 Millionen Verfassungsjuristen leben in Deutschland – diesen Eindruck mussten Nicht-Eingeweihte zumindest bekommen, wenn sie sich grob über X, Instagram und andere Plattformen informierten. Da ging mal wieder Meinung vor Ahnung.
Halbwahrheiten und Lügen
Was wahrscheinlich noch stärker hinter dem Schub für die Unterschriftensammlung steckt: Die Leute wollen nicht, dass eine zumindest in weiten Teilen auf Halbwahrheiten bis hin zu blanken Lügen basierende Kampagne Erfolg hat. Dass bis zur Unkenntlichkeit auf Social-Media-Kachelgröße und -komplexität verkürzte Falschbehauptungen und die begleitende Schlammschlacht eine angesehene Juristin noch weiter beschädigen. Heruntergebrochen auf das Debattenniveau bedeutet das: Das Böse darf nicht siegen.
Das Böse, dazu gehört demnach die in derselben Pressemeldung als "Fake News-Kampagne" bezeichnete Petition, die genau das Gegenteil fordert. Dort haben sich bislang knapp 148.000 Menschen (Stand: Mittwochmorgen) gegen Brosius-Gersdorfs Wahl ausgesprochen.
Das sind nun nicht unbedingt "deutlich mehr", wie innn.it behauptet. Da muss man eine Grundeuphorie abziehen, die Aktivisten naturgemäß innewohnend und der Sache natürlich auch dienlich ist. Plus das Geklapper, das zum Handwerk namens Öffentlichkeitsarbeit gehört. Aber ja, es stimmt: Die Anti-Brosius-Gersdorf-Kampagne läuft schon länger. Die Plattform dahinter, CitizenGo, trommelt unter anderem gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und gegen Abtreibung.
Eine sorgfältige, juristische Abwägung
In dieses Horn bliesen argumentativ auch die Unionsparteien, als sie sich gegen Brosius-Gersdorf aufstellten: Sie setze sich für straffreie Abtreibung bis zur Geburt ein, wurde behauptet. Das stimmt nur dann, wenn man entweder böswillig verkürzen will oder aber nicht in der Lage ist, eine sorgfältige, multiperspektivische juristische Abwägung eines politisch und moralisch höchst aufgeladenen Themas als das zu erkennen, was sie ist: eine sorgfältige, multiperspektivische juristische Abwägung eines politisch und moralisch höchst aufgeladenen Themas.
Hinter CitizenGo steckt Recherchen zufolge unter anderem ein Putin-naher russischer Oligarch mit Kontakten, Sie ahnen es, zur FPÖ in Österreich. Und der AfD. Auf dieser Plattform gilt Brosius-Gersdorf als "radikale Lebensfeindin". Das ist blanker, bösartiger Unsinn.
Ist der Einfluss wirklich so groß?
165.000 für Brosius-Gersdorf, 148.000 gegen sie. Das sind 313.000 Unterschriften. Dopplungen, also Menschen, die sowohl die eine als auch die andere Petition gezeichnet haben, mag es wohl wenige geben. Gemessen an den sehr vielen, die sich in den vergangenen Wochen in die Debatte eingebracht haben, sind das nicht viele. Für Petitionsverhältnisse aber ist das schon eine recht ansehnliche Zahl. Wie groß der Einfluss auf die letztendliche Entscheidungsfindung haben wird, sei mal dahingestellt.
Aber es zeigt: Es tut sich was. Auch bei denen, denen immer mehr vorgeworfen wird, zu untätig, zu still, zu defensiv zu sein: Bei denen, die kein Interesse haben, sich von rechten bis rechtsradikalen Kampagnen die Welt schlechter machen zu lassen. Das ist doch eine gute Nachricht.
https://www.t-online.de/
Marx nennt Debatte um Brosius-Gersdorf «unglücklich»
Veröffentlicht am 22.07.2025Lesedauer: 2 Minuten
image fragment altText id 687f511e6696f36098c33345
Aus Sicht des Kardinals ist die Debatte «unglücklich» gelaufen (Archivbild).
Quelle: Marijan Murat/dpa
In den Streit um die Richterwahl hatte sich auch die katholische Kirche eingemischt. Kardinal Marx mahnt nun Debatten «ohne persönliche Herabsetzungen» an.
Der Vorsitzende der Freisinger Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, bedauert die Debatte um die SPD-Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. «Es ist unglücklich, wie die Debatte gelaufen ist und dass sie zur persönlichen Beschädigung einer Kandidatin geführt wurde», sagte der katholische Erzbischof von München und Freising den «Nürnberger Nachrichten». «Die Verantwortlichen müssen sich schon fragen, wie das überhaupt passieren konnte.»
Auch der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl hatte die Debatte befeuert, indem er in einer Predigt von einem «innenpolitischen Skandal» gesprochen und gesagt hatte, Brosius-Gersdorf bestreite «angeblich das Lebensrecht ungeborener Menschen». Inzwischen hat Gössl nach einem Telefonat mit Brosius-Gersdorf eingeräumt, falsch informiert gewesen zu sein.
Bei der Wahl von Verfassungsrichtern sei möglichst großer Konsens gefragt, sagte Marx im Interview mit der Zeitung. «Die Kandidatin kann ihre Positionen natürlich vertreten. Es ist nicht verboten, diese Meinung zu haben. Wir haben eine ganz andere, für die wir eintreten.» Er wolle keine Aufhebung des Paragrafen 218, sagte der Kardinal. «Die jetzige Fassung ist ein Kompromiss, der zu einem gesellschaftlichen Frieden geführt hat. Das sollte nicht gefährdet werden.»
Marx warnte vor der Zuspitzung gesellschaftspolitischer Debatten. «Wir als Kirche sollten dafür stehen, dass Debatten mit Argumenten in der Sache ausgetragen werden – und mit Respekt vor der Person. Ohne persönliche Herabsetzungen», sagte er.
Marx: «Bin nicht glücklich, wenn das Kreuz zum Streitobjekt wird»
Und noch ein anderes Thema eigne sich seiner Ansicht nach nicht für verkürzte, verhärtete Auseinandersetzungen: das Kreuz. «Wo das Kreuz in Bayern hängen soll, ist geregelt. Ich wünsche mir, dass es im öffentlichen Raum einen Platz hat und akzeptiert wird. Das Kreuz sollte jedoch nicht zum Zweck der Ausgrenzung und des Kulturkampfes benutzt werden! Es soll ein Symbol sein, das verbindet», sagte Marx. «Ich bin nicht glücklich, wenn das Kreuz zum Streitobjekt wird.»
Kürzlich hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass ein bayerisches Gymnasium ein Kruzifix im Eingangsbereich auf Wunsch zweier Schülerinnen hätte abhängen müssen. Das Gericht sah sie in ihrer Religionsfreiheit eingeschränkt.
dpa-infocom GmbH
https://www.welt.de/
„Plagiatsjäger“ Weber will „Putsch-Plan“ der SPD vereitelt haben
Stand:21.07.2025, 06:20 Uhr
Von: Katja Thorwarth
Die Debatte um die SPD-Richterkandidatin Brosius-Gersdorf geht in die nächste Runde. Dafür sorgt nicht zuletzt der selbsternannte „Plagiatsjäger“ Stefan Weber.
Berlin – Die Debatte um die geplatzte Richterwahl der Verfassungs- und Sozialrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf nimmt mittlerweile verschwörungsähnliche Züge an. Insbesondere der selbsternannte österreichische „Plagiatsjäger“ Stefan Weber startete auf der Plattform X ein wahres Feuerwerk mit Posts gegen die SPD-Kandidatin, die am Wahltag für die Union als „nicht wählbar“ erklärt wurde. Als ein Grund hatte sie plötzlich auftauchende „Plagiatsvorwürfe“ ins Feld geführt.
Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf stellt sich hier den Fragen von Markus Lanz im ZDF. © Markus Hertrich/dpa
Weber nun lässt nicht locker und will einen „Komplott“ enthüllt haben: „DAS #LINKSLINKSGRÜN-KOMPLOTT - ENTHÜLLT“, schreibt er auf X mit dem Zusatz, die SPD sei „niederträchtig genug“ gewesen, Juraprofessorinnen aufzustellen, die ein AfD-Verbot „absegnen“ würden. An anderer Stelle teilt er einen Post des Juristen Ulrich Vosgerau, der unter anderem 2024 als Strafverteidiger von AfD-Politiker Björn Höcke fungierte und am 25. November 2023 an dem rechten Geheimtreffen in Potsdam teilnahm.
Verschwörungserzählungen von Rechtsaußen um die Richterwahl: „Die SPD plant einen Putsch“
Vosgerau präsentiert sich dort als Aufklärer: „Das sollte jeder Deutsche wissen: Die SPD plant einen Putsch. Wie?“ – indem von ihr eingesetzte Richter die AfD verbieten würden mit dem Ergebnis: „Klingbeil wird Kanzler, Reichinnek Ministerin. Sieht das keiner kommen?“ Dies framed Weber mit der Aussage, dass er „den Plan in letzter Sekunde fürs erste vereitelt“ habe: „Vereitelt wurde ein historisch bedeutender geplanter Missbrauch aller Staatsgewalten.“
Das ist ein weiterer Dreh in einer Kampagne, mit der Brosius-Gersdorf seit Bekanntgabe ihrer möglichen Wahl zur Verfassungsrichtern konfrontiert wird. In kurzer Zeit hatten rechten Medien in sozialen Netzwerken Stimmung gegen die Juristin gemacht, weshalb für die Desinformationsexpertin Hannah Schimmele im Interview mit tagesschau24 klar ist, „dass durch diese Kommunikation ein bestimmtes Ziel erreicht werden sollte: Frau Brosius-Gersdorf sollte als Verfassungsrichterin verhindert werden“.
Teile der Union legen Verfassungsrechtlerin Brosius-Gersdorf Verzicht auf das Amt nahe
Tatsächlich fallen die politischen Haltungen einzelner Richter oder Richterinnen nicht ins Gewicht, da ein Urteil immer im Kollektiv gefällt wird. Ferdinand Kirchhof, von 2007 bis 2018 Richter am Bundesverfassungsgericht, erklärte im Gespräch mit „ZDFheute“, keine Gefahr für die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts zu sehen: „Man wird einmal in das Amt gewählt, das kann spannend sein und jetzt auch mit Turbulenzen ausgestattet sein, aber wenn der Richter im Amt ist, (...) dann muss sich auch seine Unabhängigkeit zeigen“. Dies sei bislang immer gelungen.
Meine News
Kanzlei: Vorwürfe unbegründet
Plagiats-Vorwürfe bei Richterwahl: Gutachten spricht Brosius-Gersdorf frei
SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf für das Bundesverfassungsgericht.
Richterwahl
Gutachten sieht keinen Plagiatsverdacht bei Brosius-Gersdorf
Frauke Brosius-Gersdorf bei „Markus Lanz“
Wahl zum Bundesverfassungsgericht
Nach geplatzter Richterwahl von Brosius-Gersdorf: SPD wirft Union beschämende Hetzkampagne vor
Dorothee Bär (CSU) war bei der Bundestagswahl 2025 Stimmkreiskönigin und holte als einzige Kandidatin über 50 Prozent der Erststimmen. Belohnt Merz sie mit einem Ministeramt? Am ehesten käme wohl das Digitalministerium infrage. Bär war schon Digitalstaatsministerin unter Angela Merkel.
Ärger für Kanzler Merz
Plagiatsaffäre bei CDU weitet sich aus und belastet Merz Regierung
Montage IPPEN.MEDIA / IMAGO / Panama Pictures / HMB-Media
Derweil hat der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil betont, an Brosius-Gersdorf festhalten zu wollen und fordert eine Wiederholung der Richterwahl. Er betrachte die Causa als Frage des Umgangs mit externem Druck. „Es ist eine prinzipielle Frage, ob man dem Druck von rechten Netzwerken nachgibt, die eine hoch qualifizierte Frau diffamiert haben.“ Die SPD scheint hier entschlossen, dies nicht zu tun.
https://www.fr.de/
Bundesverfassungsgericht
Klingbeil hält an Brosius-Gersdorf-Kandidatur fest
Stand: 20.07.2025 15:57 Uhr
Die Bedenken der Union wegen angeblicher Plagiate seien ja ausgeräumt: Vizekanzler Klingbeil will die SPD-Kandidatin Brosius-Gersdorf weiter in Karlsruhe sehen. Und es gehe eben auch um "eine prinzipielle Frage". SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil hält an der Kandidatur von Frauke Brosius-Gersdorf für das Bundesverfassungsgericht fest. Er forderte in der "Bild am Sonntag", die Wahl erneut im Bundestag auf die Tagesordnung zu setzen. Die Bedenken in der Union gegen Brosius-Gersdorf wegen angeblicher Plagiatsvorwürfe seien ausgeräumt. Für ihn sei es "eine prinzipielle Frage, ob man dem Druck von rechten Netzwerken nachgibt, die eine hoch qualifizierte Frau diffamiert haben". Die Juraprofessorin steht seit vergangener Woche im Mittelpunkt einer Auseinandersetzung um die Richterpostenbesetzung an Deutschlands höchstem Gericht. Nachdem die Unionsführung zunächst unter anderem ihrer Wahl zugestimmt hatte, forderte sie den Koalitionspartner SPD am Freitag vergangener Woche auf, die Kandidatur Brosius-Gersdorfs zurückzuziehen.
Friedrich Merz
Player: video"Mit ersten Wochen seiner Amtszeit sehr zufrieden", Alexander Budweg, ARD Berlin, zur Sommer-Pressekonferenz von Kanzler Merz
analyse
18.07.2025
Sommerpressekonferenz
Als die gute Laune aus Merz' Gesicht weicht
Das hatte sich der Kanzler anders vorgestellt: Viele Fragen drehten sich um eine gescheiterte Wahl. mehr
Belastungsprobe für Schwarz-RotDaraufhin musste im Bundestag die Neubesetzung der Richterposten von der Tagesordnung genommen werden. Der Streit ist eine schwere Belastung für die erst seit Mai amtierende schwarz-rote Koalition.Trotz des koalitionsinternen Streits um die Richterwahl lobte Klingbeil sein gutes Arbeitsverhältnis zu Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): "Ich habe eine sehr enge und vertrauensvolle Abstimmung mit dem Bundeskanzler. Wir sind ständig im Gespräch."
Eine Hand tippt auf der Tastatur eines Laptops.
Player: audioKommentar: Brosius-Gersdorf sollte nicht vor Kampagne einknicken
kommentar
16.07.2025
Causa Brosius-Gersdorf
Eine Kampagne von weit rechts
Das Ziel: Die Juristin aus dem Spiel zu nehmen. mehr
Klingbeil will Reform der Schuldenbremse voranbringen
Gesprächsbedarf sieht Klingbeil aber beim Thema Schuldenbremse. Der Finanzminister erhöhte den Druck auf die Union. "Wir haben verabredet, dass wir die Schuldenbremse reformieren, um mehr Investitionen zu ermöglichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Partei nach ein paar Wochen vereinbarte Projekte aufkündigt", sagte er der Bild am Sonntag weiter.Weil Schwarz-Rot für eine weitere Änderung der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse die Stimmen von den Grünen und der Linken benötigt, hatten sich Unionspolitiker von dem Vorhaben distanziert. Zuletzt hatte CSU-Chef Markus Söder eine inhaltliche Zusammenarbeit mit der Linkspartei abgelehnt.
Dieses Thema im Programm:
Über dieses Thema berichtete BR24 am 19. Juli 2025 um 06:22 Uhr.
https://www.tagesschau.de/
Verfassungsrechtler rät Unionsfraktion zu Wahl von Brosius-Gersdorf
DTS Nachrichtenagentur
19.07.2025
Aus Sicht des Staatsrechtlers Alexander Thiele sollte es im Interesse der Unionsfraktion liegen, Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin zu wählen. „Brosius-Gersdorf ist eigentlich eine wunderbare Kompromisskandidatin“, sagte Thiele der „Rheinischen Post“ (Samstagausgabe).
Verfassungsrechtler Rät Unionsfraktion Zu Wahl Von Brosius-Gersdorf
Friedrich Merz in der Unionsfraktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
„Die Auffassungen der Kandidatin in vielen Bereichen, zum Beispiel in wirtschaftlichen Themenfeldern, entsprechen zu großen Teilen denen der Union. Es scheint mir aus Sicht von CDU und CSU daher eher unklug, diese Person abzulehnen.“ Thiele zufolge sei es möglich, dass die SPD anderenfalls eine „wirklich linke Kandidatin aufstellt“. Diese könnte die Union „politisch dann aber nicht mehr ablehnen“.
Der Verfassungsrechtler ist der Ansicht, dass die Debatte um Frauke Brosius-Gersdorf künftige Nominierte für das Bundesverfassungsgericht abschrecken könnte. „Man muss sich dann schon fragen, wer sich eigentlich noch bereit erklärt, für ein solches Amt zur Verfügung zu stehen. Denn als Verfassungsrechtler oder Verfassungsrechtlerin hat man immer Positionen, die auch anecken“, sagte er. „Der politische Raum muss sich deswegen schützend vor die Kandidatinnen stellen. Das ist noch immer nicht hinreichend geschehen. Brosius-Gersdorf ist von der Politik insoweit im Stich gelassen worden.“
Sorgen bereite ihm, dass im Netz bereits eine Kampagne gegen die zweite SPD-Kandidatin, Ann-Katrin Kaufhold, anlaufe. „Auch da wird versucht, Stimmung gegen sie zu machen und sie als Klimaaktivistin hinzustellen“, sagte Thiele.
https://presse-augsburg.de/
Verschobene Wahl von Brosius-Gersdorf
Es geht nicht nur um die Person – es geht um Macht
18.07.2025, 05:00 Uhr
Eine erfolgreiche Kampagne rechter Blogs und Nachrichtenportale konnte die Richterwahl von Frauke Brosius-Gersdorf verschieben. Ob es zu einem weiteren Anlauf kommen wird, scheint äußerst fraglich. Den Initiatoren und Nutznießern der Kampagne ging es dabei nicht nur um die Personalie Brosius-Gersdorf, sondern vor allem darum, ihre Macht zu demonstrieren und Zweifel am Rechtsstaat zu säen. Eine Analyse.
von Torben Lehning, Hauptstadtkorrespondent MDR AKTUELL
Inhalt des Artikels:
- Was ist passiert?
- Die Vorwürfe
- Wer profitiert?
- Worum geht es den Initiatoren?
- Der nächste Akt
- Delegitimierung von Staatsorganen
- Wie geht es weiter?
Was ist passiert?
10 Tage vor der Richterwahl startet die Kampagne. Die von der SPD nominierte Kandidatin hat sich bislang als Rechtswissenschaftlerin der Universität Potsdam und als ehemalige stellvertretende Landesverfassungsrichterin in Sachsen einen Namen gemacht. Die breite Öffentlichkeit kennt sie nicht. Das ändert sich jetzt, weil rechte Nachrichtenportale und Blogs beschließen, Brosius-Gersdorf mit gezielten Falschinformationen zu diskreditieren.
Die Vorwürfe
Diese Kandidatin sei eine "ultralinke Hardcore-Abtreibungsbefürworterin", die Schwangerschaftsabbrüche bis zum neunten Monat legalisieren wolle, heißt es etwa.
Dann wird Brosius-Gersdorf auch noch vorgeworfen, in ihrer Dissertation plagiiert zu haben. Gepaart werden die Vorwürfe mit anderen Reizthemen wie Kopftüchern, Impfpflicht und Gendern. Sowohl der Plagiats- als auch der Abtreibungsvorwurf lassen sich nachvollziehbar anhand der Arbeiten und Aussagen von Brosius-Gersdorf widerlegen.
Die rechten Blogs und Nachrichtenportale schalten bezahlte Werbeanzeigen, die zum Protest gegen die Kandidatur aufrufen und Bürger dazu auffordern, Abgeordneten mit Briefen und Mails Druck zu machen. Wie wir heute wissen, hat das funktioniert. Eine nicht zu vernachlässigende Zahl von CDU-Abgeordneten übernahm das konstruierte Narrativ, wonach Brosius-Gersdorf ultralinks und daher unwählbar sei. Die Wahl wurde verschoben.
Wer profitiert?
Brosius-Gersdorf kandidiert für den zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts. Der setzt sich nicht mit Abtreibungen auseinander, sondern unter anderem mit Parteiverbotsverfahren. Dass Brosius-Gersdorf sich 2024 in einer ZDF-Talkshow dafür ausgesprochen hat, ein AfD-Verbotsverfahren ins Auge zu fassen, wenn es "genügend Material gibt", sollte ohne Zweifel in die Bewertung der Kampagne mit einfließen. Die Meinungsäußerungen zu einem möglichen Parteiverbotsverfahren, die Brosius-Gersdorf vor ihrer Kandidatur tätigt, decken sich mit unserem Grundgesetz.
Die AfD greift die Beiträge der rechten News-Portale und Blogs weiterhin dankbar auf und erhöht den Druck auf die Union. Mittlerweile melden sich nicht mehr nur AfD'ler und parteinahe Internetblogs zu Wort, sondern auch CDU-Abgeordnete, Bischöfe und Kolumnisten von konservativen Blättern. Der Druck auf die Union bleibt auch nach der verschobenen Wahl unverändert.
Worum geht es den Initiatoren?
Rechte Onlinemedien und AfD dürften sich zu den Gewinnern der erfolgreichen Kampagne zählen. Zum einen wollen die Akteure ihre Muskeln spielen lassen und demonstrieren, dass sie Personen des öffentlichen Lebens, die ihren Normen und Werten entgegenstehen, ins Rampenlicht ziehen und verunglimpfen können. Darüber hinaus wollen sie aufzeigen, wie weit sie die Union in einer gesellschaftlichen Debatte vor sich hertreiben können. Weg vom sachlichen Diskurs, rauf auf die irrationale Gefühlsebene. Weg vom Koalitionspartner und der eigenen Fraktions- und Parteispitze, die bereits die Stimmen der Unionsfraktion zugesichert hatten.
Der nächste Akt
Der AfD-Spitze geht es derweilen längst nicht mehr nur um Brosius-Gersdorf, sondern auch um die zweite von der SPD nominierte Richterkandidatin Ann-Katrin Kaufhold. Diese stehe für "Enteignung", sagt der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Stephan Brandner. Er bewertet die Kandidatur Kaufholds als "links-grüne Agenda", die eine "Instrumentalisierung des Bundesverfassungsgerichts" darstelle.
Delegitimierung von Staatsorganen
Ein wohl gewählter Schachzug. So ist es doch gerade die AfD selbst, die – wo sie nur kann – die Institutionen der Verfassung zu delegitimieren versucht.
Nur weil bereits ein Schaden entstanden ist, heißt es nicht, dass dieser nicht noch größer werden kann.
Politische Gegner in der Parteiendemokratie werden von der AfD als "Altparteien" und "Kartellparteien" bezeichnet, das Bundesamt für Verfassungsschutz wird als "politisch instrumentalisiert" dargestellt. Jetzt versucht die AfD, die Autorität des Bundesverfassungsgerichtes zu untergraben, indem sie fortwährend suggeriert, die aktuellen Kandidatinnen seien politisch voreingenommen. So sät sie Zweifel an der Neutralität der bestehenden Senate.
Wie geht es weiter?
Egal, worauf sich Union und SPD einigen: Beide Seiten haben sich schon so tief eingegraben, dass ein Kompromiss automatisch von der nachgebenden Seite als Gesichtsverlust interpretiert werden kann. Die Situation scheint vertrackt und bedarf einigen Fingerspitzengefühls. Klar ist: Nur weil bereits ein Schaden entstanden ist, heißt es nicht, dass dieser nicht noch größer werden kann.
Selbst, wenn die Koalitionäre jetzt verbal abrüsten und im Stillen einen Kompromiss aushandeln, ist immer noch nicht klar, ob die CDU-Fraktion ihrer Spitze folgt. Das hat schon die verpatzte Kanzlerwahl gezeigt und ist ein Problem, das die Union beschäftigen sollte.
Frauke Brosius-Gersdorfmit Audio
Nach Richterwahl-Streit
Rund 300 Rechtswissenschaftler betonen Kompetenz von SPD-Kandidatin Brosius-Gersdorf
Prof. Frauke Brosius-Gersdorf
04:20
Streit um Richterwahl
Richterin Brosius-Gersdorf in Sachsen: Von CDU gewählt und fachlich geschätzt
Dieses Thema im Programm:
MDR AKTUELL RADIO | 18. Juli 2025 | 06:00 Uhr
https://www.mdr.de/
Streit über Richterwahl
Erzbischof nimmt Vorwürfe gegen Brosius-Gersdorf zurück
17.07.2025, 15:48 Uhr
Der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl, hier im Jahr 2023, hat seine Äußerung nun „nachdrücklich bedauert“.
(Foto: Daniel Löb/picture alliance/dpa)
In einer Predigt hatte der Geistliche die Nominierung der Professorin für das Bundesverfassungsgericht einen „innenpolitischen Skandal“ genannt. Er sei „falsch informiert“ gewesen, sagte er nun nach einem Telefonat mit der Juristin. Auch Bischofskonferenz-Chef Bätzing stellt sich vor sie.
Von Wolfgang Janisch und Annette Zoch, Karlsruhe/München
Der epische Streit um die fürs Bundesverfassungsgericht nominierte Professorin Frauke Brosius-Gersdorf hat nicht nur die Berliner Politik durchgerüttelt, sondern auch eine Institution auf den Plan gerufen, die sich bei Themen wie Abtreibung zuverlässig zu Wort meldet. Von Vertretern der Kirche wurde harsche Kritik an der Kandidatin und ihrer Haltung zum Schwangerschaftsabbruch geäußert.
Zur SZ-Startseite
SPD
:Wie eine alte Partei durch eine neue Welt stolpert
Ihre Hilflosigkeit in der Causa Brosius-Gersdorf offenbart, dass die SPD von den Spielregeln der modernen Politik überfordert ist. Um eine Chance im Kulturkampf von rechts zu haben, muss sie sich endlich aus der Defensive wagen.
Essay von Nils Minkmar
Lesen Sie mehr zum Thema
- Demokratie
- Bundesverfassungsgericht
- Deutschland
- Katholische Kirche
- Schwangerschaftsabbruch
- Bundestag
- Leserdiskussion
Richterwahl
Die SPD sollte ihre Kandidatin zurückziehen
Die Genossen haben nichts davon, wenn sie auf der Kandidatur von Frauke Brosius-Gersdorf beharren. Aber sie könnten gewinnen, wenn sie darauf verzichten.
Kommentar von Karoline Meta Beisel
Kultur
Claudia Roth nennt Bauhaus-Kritik der AfD „absolut inakzeptabel“
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur verweist darauf, dass die AfD in Sachsen-Anhalt „erschreckend ähnliche Argumente und Formulierungen“ wie die NSDAP verwende.
Von Nicolas RichterMedien
https://www.sueddeutsche.de/
Kritik an Brosius-Gersdorf: Lancierte Kampagne rechtspopulistischer Medien?
Stand: 16.07.2025 08:27 Uhr
Frauke Brosius-Gersdorf sollte eine der neuen Verfassungsrichterinnen werden. Doch die Wahl wurde verschoben - wegen Vorbehalten bei Unions-Abgeordneten. Hannah Schimmele vom Beratungsnetzwerk Polisphere hält es für eine mediale Kampagne von rechtspopulistischen Plattformen.
Viele der Vorbehalte gegenüber Brosius-Gersdorf sind nicht nur sachlich unbegründet. Vielmehr drängt sich der Verdacht auf, dass in einer Kampagne von rechtspopulistischen Medien Gerüchte und falsche Vorwürfe lanciert worden sind. Eine Gruppe von Berliner Politik-Analysten namens "Polisphere" hat sich die Kampagne genauer angeschaut. Vor allem die rechtspopulistische Plattform NIUS war mit 20 Artikeln innerhalb von zehn Tagen besonders aktiv.
Frau Schimmele, kann man in diesem Fall tatsächlich von einer Kampagne sprechen? Denn das würde voraussetzen, dass planvoll und abgesprochen vorgegangen wurde.
Hannah Schimmele: Wir würden sagen, dass man das Kampagne nennen kann, weil ganz deutlich ist, dass es das klare Ziel gab, diese Kandidatin zu verhindern. Natürlich kann es eine Berichterstattung über eine Kandidatin geben, und diese darf auch kritisch sein. Problematisch wird es, wenn die Berichterstattung auf Falschinformationen beruht oder diese weiter verbreitet. Genau das haben wir hier deutlich gesehen. Über die Berichterstattung hinaus gab es in den sozialen Medien eine Bandbreite von Methoden, Petitionen sowie Aufrufe an Unionsabgeordnete, diese Kandidatin nicht zu unterstützen. Die Bandbreite an Methoden, die wir gesehen haben, spricht für eine Kampagne.
Das wurde auch schon strittig diskutiert. Da sagt zum Beispiel Robin Alexander, der sich in der Welt selber sehr kritisch über Frau Brosius-Gersdorf geäußert hatte, dies sei doch keine Kampagne, sondern eine ganz normale Berichterstattung. Wörtlich sagt Alexander: "Bekannt geworden ist dieser Vorschlag durch eine Recherche der FAZ, eine Zeitung, die man nicht am rechten Rand verortet. Dann gab es eine Äußerung von Ulla Schmidt, der Chefin der Lebenshilfe, jener Organisation, die sich für die Rechte behinderter Menschen einsetzt, und eine frühere sozialdemokratische Ministerin. Sie hat gesagt, die Äußerungen der in Rede stehenden Juristin zur Würde des Menschen, des ungeborenen Lebens würde Implikationen für behinderte Menschen haben." Das führt Robin Alexander noch weiter aus. Haben Sie das bei Ihrer Analyse anders gelesen?
Hannah Schimmele: Es ist korrekt, dass die FAZ mit der Berichterstattung zentral begonnen hat. Der Unterschied ist, dass der Bericht vom 30. Juni, auf den Robin Alexander sich hier bezieht, zunächst einmal zeigt, welche drei Kandidaten zur Wahl stehen, und wer diese Personen sind. Vor allem die Alternativmedien haben sich auf diese Stories gestürzt, die eben keine sachliche Berichterstattung war, wie von der FAZ. Dann gab es Politiker aus Union und SPD, die begonnen haben zu zweifeln. Das ist absolut in Ordnung, das möchten wir nicht in Abrede stellen. Problematisch wurde es aber ab dem Moment, als die Position von Brosius-Gersdorfs zu Schwangerschaftsabbrüchen falsch dargelegt wurde. Das, was daraus gemacht wurde, dass sie sich für Abtreibungen bis in den neunten Monat, bis zur Geburt aussprechen würde, ist schlichtweg falsch. Zu dem Thema AfD-Verbot wurde aus ihrer Offenheit für die Prüfung des AfD-Verbotsverfahren als Zeichen der wehrhaften Demokratie die rigorose Haltung gemacht, sie wolle die AfD auf jeden Fall verbieten. Das Drehen an den Fakten ist der Punkt, der kritisch ist, und nicht per se, dass über sie berichtet wird.
Sind das Verkürzungen, Übertreibungen oder zum Teil auch wirklich Lügen? Kann da aus ihren Arbeiten verkürzt zitiert werden oder wurden Dinge erfunden?
Hannah Schimmele: Sowohl als auch. Die effektivste Desinformation ist eine, die einen wahren Kern hat. Das war hier der Fall. Deswegen ist das meiste, was wir sehen, Verzerrungen, Ableitungen aus Papieren, die sie veröffentlicht hat, aus Zitaten, die sie gemacht hat, die dann in einen falschen Kontext gestellt, verkürzt dargestellt, oder mit einem eigenen Spin versehen wurden. Sodass sie als linksextreme Aktivistin dargestellt wurde, was aber keiner tatsächlichen Grundlage auflegt.
Wenn Sie das analysieren und sich anschauen, welche Stoßrichtung sich dahinter verbirgt, können Sie zurückverfolgen, wer ein Interesse daran hat, diese Verwirrung zu stiften?
Hannah Schimmele: Wir sehen hier vor allem die Kommunikation aus dem rechten, rechtspopulistischen und teilweise rechtsextremen Spektrum, wo ein Interesse besteht, diese Kandidatin zu verhindern. Das sehen wir in den Artikeln, die wir analysiert haben und in der Social-Media-Kommunikation. Teilweise, das haben wir vor allem am Anfang gesehen, ging es sehr viel um ihre Position zum AfD-Verbotsverfahren. Auch aus der AfD hieß es sehr konkret, diese Frau müsse verhindert werden. Das ist eine sehr klare politische Positionierung. Darüberhinaus wurden beispielsweise auch in den Kreisen von Abtreibungsgegnern, Petitionen gegen Brosius-Gersdorf gestartet. Dann haben sich die Positionen gegenseitig aufgegriffen und alles hat zusammengewirkt.
Hier vermischen sich, Sie haben das beschrieben, eine politische Auseinandersetzung, die in einer Demokratie normal ist, mit etwas, was Sie jetzt mit guten Gründen als Kampagne bezeichnen. Was würden Sie sich wünschen, wie damit umgegangen wird?
Hannah Schimmele: Es ist ganz wichtig zu sagen, es soll, darf, kann immer kritische Berichterstattungen geben. Und das ist natürlich auch wichtig und ein wichtiges Merkmal einer liberalen Demokratie. Schwierig wird es, wenn diese Berichterstattung nicht nur auf radikalen Positionen basiert, sondern auf Falschinformationen und Verzerrungen. Was wir hier oft gesehen haben, dass das Thema - weil es diese Öffentlichkeit bekommen hat, weil die rechten Alternativmedien hier quasi sehr stark Stimmung gemacht haben - präsenter wurde, dass es dann auch in den Qualitätsmedien aufgegriffen wurde. Hier würde ich mir wünschen, dass wir uns von vornherein nicht von diesen Diffamierungen und Falschmeldungen treiben lassen, sondern eine informierte, sachliche Öffentlichkeit darstellen können, in der wir uns informieren können.
Das Gespräch führte Mischa Kreiskott. Das komplette Interview finden Sie als Audio oben auf dieser Seite.
Frauke Brosius-Gersdorf bei ihrem Auftritt im ZDF
Brosius-Gersdorf erwägt Rückzug und kritisiert "Kampagne"
Die Staatsrechtlerin Brosius-Gersdorf hält sich nach der Kritik an ihren Positionen einen Rückzug von ihrer Kandidatur zur Richterin am Bundesverfassungsgericht offen. Sie wolle sich jedoch auch nicht der "Kampagne" gegen sie beugen.
Markus Söder und Friedrich Merz
Immer mit der Ruhe?
Wie geht es nach der gescheiterten Richterwahl weiter? Die SPD und auch die Kandidatin gehen in die Offensive. Und die Unionschefs? Merz und Söder wollen "in Ruhe" Lösungen suchen. Von Benjamin Großkopff.
BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)
Richterwahl fürs Bundesverfassungsgericht: Kretschmann spricht von "politischem Versagen"
Die vorerst gekippte Wahl einer Kandidatin als Richterin am Bundesverfassungsgericht sorgt für politische Auseinandersetzungen. Nun hat sich Ministerpräsident Kretschmann geäußert.
Frauke Brosius-Gersdorf
"Diffamierend und realitätsfern"
Scharfe Kritik an der Berichterstattung: Die von der SPD als Verfassungsrichterin nominierte Juristin Brosius-Gersdorf hat sich erstmals seit der abgesagten Wahl geäußert. Es sei offensichtlich, wo sie politisch stehe.
Frauke Brosius-Gersdorf bei der Bundespressekonferenz 2024
Debatte um Richterwahl: Brosius-Gersdorf kritisiert Berichterstattung
Auch Professoren aus Niedersachsen hatten den Umgang mit der Juristin kritisiert. Nun meldet sie sich selbst zu Wort.
Unionsfraktionschef Jens Spahn im Bundestag.
"Das ist ein Vertrauensverlust"
Alles "kein Beinbruch" und schon gar keine Krise: Kanzler Merz sieht nach der geplatzten Richterwahl keinen Zeitdruck, doch die SPD ist nachhaltig empört. Im Fokus: Unionsfraktionschef Spahn.
Frauke Brosius-Gersdorf bei der Bundespressekonferenz 2024
Verfassungsrichter-Wahl: CDU in MV sieht Koalition nicht in Gefahr
AfD und Linke hingegen kritisieren Union und SPD nach dem Desaster um die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf scharf.
Blick in den leeren Plenarsaal des Bundestags.
Einiges zu besprechen nach Eklat um Richterwahl
Der Juristin Brosius-Gersdorf wurden Dinge vorgeworfen, die sie nie gesagt hat - und manchem davon wurde selbst im Bundestag nicht widersprochen. In der Sommerpause sollte die Koalition einiges klären, mahnt eine Politologin. Von B. Schwarz.
Außenaufnahme des Bundesverfassungsgerichtes mit dem Schriftzug Bundesverfassungsgericht.
"Bewusste Demontage unseres höchsten Gerichts"
In der SPD ist der Ärger über die Union groß. Man fürchtet, dass durch die geplatzte Richterwahl auch das Verfassungsgericht als Institution beschädigt wurde. Kritisch äußert sich auch ein Ex-Verfassungsrichter, der lange CDU-Spitzenpolitiker war.
Dieses Thema im Programm:
NDR Kultur | Das Gespräch | 15.07.2025 | 15:00 Uhr
https://www.ndr.de/
Hannah Schimmele, Beratungsnetzwerk polisphere, mit einer Analyse zum Fall Brosius-Gersdorf
Video
Stand: 16.07.2025 11:33 Uhr
Sendungsbild
Player: video
Hannah Schimmele, Beratungsnetzwerk polisphere, mit einer Analyse zum Fall Brosius-Gersdorf
9 Min
tagesschau24, 16.07.2025 11:00 Uhr
https://www.tagesschau.de/
Bundesverfassungsgericht
: Die Kandidatin gibt kräftig Kontra
Kommentar von Wolfgang Janisch
16.07.2025, 12:21 Uhr
Ihre einzige Chance lag darin, die Debatte in ihre Welt zurückzuholen, ins Reich der Ratio: Frauke Brosius-Gersdorf in der Talk-Sendung mit Markus Lanz im ZDF.
(Foto: Markus Hertrich/Markus Hertrich/ZDF/dpa)
Die Schmutzkampagne gegen Frauke Brosius-Gersdorf arbeitete mit persönlichen Angriffen, mit grotesken Verzerrungen und Lügen. Dem ist sie nun öffentlich in einem Akt der Notwehr entgegengetreten – gut so...
https://www.sueddeutsche.de/
Causa Brosius-Gersdorf
: Politologe: Rückzug hätte "sehr hohen" Preis
16.07.2025 | 07:49
Frauke Brosius-Gersdorf hat bei "Markus Lanz" einen möglichen Rückzug von ihrer Kandidatur ins Spiel gebracht. Politologe Korte warnt vor einem "sehr hohen" Preis - für die Union.
Die ganze Sendung "Markus Lanz" mit Frauke Brosis-Gersdorf im Video.
15.07.2025 | 84:20 min
Wie weiter in der Causa Brosius-Gersdorf? Nach öffentlicher Kritik aus Teilen der Union und darüber hinaus an ihrer Nominierung signalisiert Frauke Brosius-Gersdorf am Dienstagabend bei "Markus Lanz", dass sie an ihrer Kandidatur festhalten möchte - sich unter bestimmten Umständen aber auch einen Rückzug vorstellen könne.
Auf die Frage, ob die am vergangenen Freitag im Bundestag geplatzte Verfassungsrichterwahl und der Streit um ihre Person nicht dem Bundesverfassungsgericht schade, antwortete sie:
Sobald das auch nur droht, würde ich an meiner Nominierung nicht festhalten.
„
Frauke Brosius-Gersdorf
Können Union und SPD gemeinsam eine Lösung für die Situation finden - oder ist ein Rückzug der einzige Ausweg?
Trotz Kritik hält SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf an ihrer Kandidatur fürs Bundesverfassungsgericht fest. Sollte dem Gericht allerdings Schaden drohen, würde sie verzichten.
16.07.2025 | 1:43 min
Es geht um mehr als eine Personalie
"Das kommt darauf an, wie man die Konfliktmasse einschätzt", erklärt Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte. Im ZDF heute journal verweist er auf drei mögliche Erklärungsmuster für die blockierte Wahl:
- Kulturkampf-Narrativ: Teile der Unionsfraktion seien, so Korte, "auf demagogische Informationen reingefallen". Gemeint sind unter anderem Kampagnen in sozialen Medien, in denen Brosius-Gersdorf etwa wegen früherer Aussagen angegriffen wurde.
- Fraktion gegen Fraktionsführung: Korte sieht zudem ein mögliches Führungsproblem innerhalb der Unionsfraktion. Viele Abgeordnete hätten sich nicht eingebunden gefühlt, der Widerstand gegen die Kandidatin sei daher auch Ausdruck von Unmut über den Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn:
Das Politikmanagement, das kleine Einmaleins, Leute mitzunehmen aus einer Position der Fraktionsspitze, ist nicht gelungen.
„
Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler
Die ganze Analyse von Karl-Rudolf Korte im Video.
15.07.2025 | 4:34 min
- Parteitaktische Reaktion auf die SPD: Schließlich nennt Korte auch parteipolitische Motive als mögliche Ursache. Die SPD habe sich am Tag der Wahl "als Kleinpartei gegenüber der Großpartei Union" durchgesetzt. Der Streit um Brosius-Gersdorf könnte auch als Reaktion auf diesen wahrgenommenen Kontrollverlust der Union zu verstehen sein.
ZDF-Korrespondentin: Auftritt wird "nicht für Beruhigung sorgen"
Sollte das erste Erklärungsmuster zutreffen, wäre die Situation laut Korte grundsätzlich durch Aufklärung lösbar: "Mit Informationen und Gesprächen" könne man Bedenken in der Unionsfraktion möglicherweise ausräumen. Es gehe darum, zu zeigen, dass die Bedenken unbegründet seien:
All das wäre ja möglich durch ein Gespräch auszuräumen, dass man in der Tat sich fähig zeigt, gegen Demagogie vorzugehen.
„
Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler
ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann beurteilt die Wirkung des Auftritts jedoch kritisch. Die Stellungnahme und das Gespräch bei "Markus Lanz" hätten in der Unionsfraktion "sicherlich nicht für Beruhigung" gesorgt. Im Gegenteil: Die "offensive Art" werde dort eher als Konfrontation und Eskalation wahrgenommen. Ihr Fazit:
Brosius-Gersdorf ist mit diesen Auftritten ihrem Ziel, Verfassungsrichterin zu werden, eher weiter entfernt als heute Morgen.
„
Diana Zimmermann, ZDF-Korrespondentin
Die ganze Einschätzung von Diana Zimmermann im Video.
15.07.2025 | 1:55 min
Rückzug der Kandidatin? Nicht ohne politische Folgen
Politologe Korte betont, dass in vergleichbaren Fällen ein Rückzug der nominierten Person "der Normalfall" sei. Politisch wäre ein solcher Schritt jedoch nicht folgenlos: Die SPD dürfte einen Rückzug nicht ohne Gegenleistung akzeptieren. Der Preis wäre für die Union "sehr hoch" - möglicherweise verbunden mit einem Personalvorschlag.
Vielleicht für ein ganz anderes Amt, vielleicht für den Bundespräsidenten.
„
Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler
Auch, wenn ein Rückzug noch offen ist, warnt Korte vor einem grundsätzlichen Schaden durch die Debatte: Das Ansehen des Bundesverfassungsgerichts könne in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn sich der Eindruck verfestige, parteipolitische Erwägungen dominierten das Auswahlverfahren.
Das Interview mit Karl-Rudolf Korte führte Marietta Slomka, zusammengefasst hat es Christian Harz.
Quelle: ZDF
https://www.zdfheute.de/
Nach abgesetzter Richterwahl
Brosius-Gersdorf erwägt Rückzug und kritisiert "Kampagne"
Stand: 16.07.2025 09:04 Uhr
Die Staatsrechtlerin Brosius-Gersdorf hält sich nach der Kritik an ihren Positionen einen Rückzug von ihrer Kandidatur zur Richterin am Bundesverfassungsgericht offen. Sie wolle sich jedoch auch nicht der "Kampagne" gegen sie beugen. Die von der SPD nominierte Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf hält trotz Kritik aus der Union vorerst an ihrer Kandidatur für das Bundesverfassungsgericht fest, schließt einen Rückzug aber nicht aus. Sollte dem Gericht in der Debatte um die Richterwahl Schaden drohen, würde sie sofort verzichten, sagte sie in der Sendung Markus Lanz im ZDF. "Das ist ein Schaden, den kann ich gar nicht verantworten." Das Bundesverfassungsgericht müsse in Ruhe arbeiten können und funktionsfähig bleiben. Brosius-Gersdorf betonte: "Ich möchte auch nicht verantwortlich sein für eine Regierungskrise in diesem Land, weil wir nicht wissen, was dann hinterher passiert. Das sind alles Aspekte, die nehme ich unheimlich ernst und die bedenke ich."
Frauke Brosius-Gersdorf
Player: videoBrosius-Gersdorf kritisiert Berichterstattung und Debatte über ihre Personalie nach geplatzter Richterwahl
15.07.2025
Brosius-Gersdorf zu Berichterstattung
"Diffamierend und realitätsfern"
Frauke Brosius-Gersdorf hat sich erstmals seit der abgesagten Verfassungsrichterwahl geäußert. mehr
Richterwahl wurde von Tagesordnung genommenIm Bundestag war die Wahl zweier neuer Richterinnen und eines Richters für das Bundesverfassungsgericht kurzfristig von der Tagesordnung genommen worden. Der Druck gegen die von der SPD vorgeschlagene Brosius-Gersdorf war in der Union zu groß geworden. Die Fraktionsführung konnte die mit dem Koalitionspartner verabredete Unterstützung nicht mehr garantieren. Hintergrund der unionsinternen Bedenken war vor allem Kritik an der angeblichen Haltung von Brosius-Gersdorf bezüglich Fragen des Schwangerschaftsabbruchs. Zudem nannte die Unionsfraktion Vorwürfe im Zusammenhang mit der Doktorarbeit von Brosius-Gersdorf als Grund für die fehlende Unterstützung. Ein österreichischer Plagiatsprüfer hatte kurz vor der geplanten Richterwahl Parallelen zwischen der Doktorarbeit von Brosius-Gersdorf und der Habilitationsschrift ihres Mannes veröffentlicht.
Brosius-Gersdorf - worum geht es bei den Vorwürfen?
Die Unionsfraktion hat von der SPD den Verzicht auf die Wahl der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf für das Bundesverfassungsgericht gefordert. Als Grund dafür wurden Zweifel an ihrer Doktorarbeit genannt, aufgrund einer Veröffentlichung des als "Plagiatsjäger" bekannten Stefan Weber auf dessen Website.
Dieser hatte bemängelt, dass es in der Dissertation von Brosius-Gersdorf "23 Verdachtsstellen auf Kollusion und Quellenplagiate" gebe. Konkret geht es um sogenannte Textidentitäten in der Doktorarbeit der SPD-Kandidatin und der Habilitation ihres Ehemannes, Hubertus Gersdorf.
Allerdings erschien die Doktorarbeit von Brosius-Gersdorf bereits im Jahr 1997, die Habilitation ihres Mannes erst im Jahr 2000. Rein zeitlich ist es also höchst unwahrscheinlich, dass Brosius-Gersdorf die Passagen übernommen hat. Auch Weber selbst teilte auf der Plattform X mit, dass die Sichtweise der CDU, dass von ihm Plagiatsvorwürfe gegen Brosius-Gersdorf erhoben wurden, falsch sei.
Der Plagiatsexperte Jochen Zenthöfer sieht das ähnlich. In der Plagiatsforschung gelte der Grundsatz, dass bei Textidentitäten die Arbeit als sauber gelte, die zuerst da war - also in dem Fall die von Brosius-Gersdorf.
Der Plagiatsprüfer Weber nahm bereits zahlreiche Politikerinnen und Politiker ins Visier. So erhob er schon Vorwürfe gegen Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck und Annalena Baerbock (beide Grüne).
Zuletzt hatte er im Auftrag der populistischen Internetplattform Nius Texte der damaligen stellvertretenden Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, Alexandra Föderl-Schmid, untersucht und ihr massive Plagiate vorgeworfen. Eine daraufhin eingesetzte externe Kommission prüfte die Vorwürfe und fand keine Hinweise, dass Föderl-Schmid systematisch abgeschrieben habe.
Schwerdtner: CDU beugt sich Hetzkampagne
Nach massiver Kritik an der Absetzung der Abstimmung sowie dem Agieren der Union betonte Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz, dass kein Schaden für Regierung oder Verfassungsgericht durch die verschobene Wahl eingetreten sei. Es bestehe kein Zeitdruck für eine Neuansetzung der Wahl, die er nach der parlamentarischen Sommerpause anstrebt. Die Grünen hatten eine Sondersitzung in der Sommerpause des Bundestages gefordert, um die Wahl erneut anzusetzen. Linken-Chefin Ines Schwerdtner dagegen lehnt eine solche Sitzung ab. Diese würde, wenn alle Abgeordneten aus der Sommerpause zurückgeholt werden sollten, 200.000 Euro kosten. Dies sei nicht zu legitimieren, so Schwerdtner im ARD-Morgenmagazin. Die Regierung sei jetzt in der Pflicht, eine Einigung über die Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht herbeizuführen. Schwerdtner beklagte eine beispiellose Hetzkampagne von rechts gegen Brosius-Gersdorf, der sich die CDU gebeugt habe. Sie ließ zugleich offen, ob die Linke Brosius-Gersdorf weiter unterstützen werde. Der Ball liege jetzt bei CDU und SPD, nicht bei der Kandidatin selbst. "Wir entscheiden nach inhaltlichen Kriterien. Wir werden sie vermutlich weiter unterstützen, aber wir schauen uns das Gesamtpaket dann an."
Player: video"Wir werden sie vermutlich weiter unterstützen", Ines Schwerdtner, Vors. Linkspartei, zur Causa Brosius-Gersdorf
5 Min
"Wir werden sie vermutlich weiter unterstützen", Ines Schwerdtner, Vors. Linkspartei, zur Causa Brosius-Gersdorf
Morgenmagazin, 16.07.2025 05:30 Uhr
Einigung auf Kandidaten ist weiter offen
Wie die schwarz-roten Koalitionsparteien doch noch gemeinsam Richter wählen können, ist derzeit aber noch unklar. Politiker aus der Union halten nach wie vor an ihrer Kritik an Brosius-Gersdorf fest - genauso wie die SPD an ihrer Richterkandidatin. Bundesforschungsministerin und CSU-Politikerin Dorothee Bär äußerte Verständnis für die Bedenken von Unionsabgeordneten gegen Brosius-Gersdorf und legte ihr nahe, ihre Kandidatur zu überdenken. "Wir haben lauter mündige Abgeordnete, und wenn die sagen, ich kann mit meinem Gewissen Frau Brosius-Gersdorf nicht wählen, dann akzeptiere ich das, dann respektiere ich es und dann erwarte ich aber auch von der Kandidatin, dass sie mal für sich selbst überlegt, ob sie die Richtige ist", sagte Bär in der ARD-Talkshow Maischberger.
Blick in den leeren Plenarsaal des Bundestags.
Player: audioEklat um Brosius-Gersdorf - wer spricht in der Sommerpause mit wem?
13.07.2025
Union und SPD
Einiges zu besprechen nach Eklat um Richterwahl
Nach der gescheiterten Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht gibt es einiges an Redebedarf. mehr
Brosius-Gersdorf spricht von Kampagne gegen sich
Im ZDF sagte Brosius-Gersdorf dagegen, es gehe in der Debatte nicht mehr nur um sie. "Es geht auch darum, was passiert, wenn sich solche Kampagnen, und es war in Teilen eine Kampagne, durchsetzen, was das mit uns macht, was das mit dem Land macht, mit unserer Demokratie." Dies müsse sie wägen.Sie habe Tausende von Zuschriften und Anrufen aus der Bevölkerung, aus der Politik, von Pfarrern, von Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtswissenschaft und anderen Disziplinen erhalten, die sie nachhaltig aufgefordert hätten, jetzt nicht zurückzustecken, weil sich dann so eine Kampagne durchsetze.
Unter anderem hatten rund 300 Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler ihre Unterstützung für Brosius-Gersdorf deutlich gemacht. Sie kritisierten in einem offenen Brief, über den das Rechtsmagazin Legal Tribune Online zuerst berichtete, den Umgang mit ihrer Kollegin und warnten vor einer Beschädigung des Bundesverfassungsgerichts. Zudem gebe es an der fachlichen Qualifikation von Brosius-Gersdorf für den Posten als Richterin in Karlsruhe keine Zweifel, so die Wissenschaftler. Die gegen sie vorgebrachten Vorwürfe im Zusammenhang mit ihrer Doktorarbeit bezeichneten sie als "ausgesprochen unglaubhaft" und als "Angriff auf das Ansehen der Wissenschaft".
Player: videoDebatte um geplatzte Richterwahl dauert an
2 Min
Debatte um geplatzte Richterwahl dauert an
Kerstin Dausend, ARD Berlin, tagesschau, 16.07.2025 12:00 Uhr
Juristin: Habe Drohungen erhalten
Die Juristin hatte bereits in einer schriftlichen Stellungnahme gegen sie erhobene Vorwürfe deutlich zurückgewiesen. "Die Bezeichnung meiner Person als 'ultralinks' oder 'linksradikal' ist diffamierend und realitätsfern", heißt es darin. In manchen Medien sei zudem falsch über ihre Position zum Schwangerschaftsabbruch berichtet worden.
In der ZDF-Talkshow betonte Brosius-Gersdorf nun: "Ich vertrete absolut gemäßigte Positionen aus der Mitte unserer Gesellschaft." Dies könne jeder nachlesen. Zugleich berichtete sie, sie habe Drohungen und verdächtige Poststücke erhalten. "Ich musste vorsorglich meine Mitarbeitenden bitten, nicht mehr am Lehrstuhl zu arbeiten", sagte Brosius-Gersdorf. Die Berichterstattung über die Verfassungsrichterwahl und ihre Person sei "nicht spurlos an mir vorbeigegangen, nicht an mir, nicht an meinem Mann, an meiner Familie, meinem gesamten sozialen Umfeld". Zu den Vorwürfen im Zusammenhang mit ihrer Doktorarbeit sagte Brosius-Gersdorf, sie seien "der letzte Versuch mich zu verhindern". Sie habe sofort Spezialisten mit der Klärung beauftragt, berichtete die Juristin. Eine Rechtsanwaltskanzlei habe die Vorwürfe mehrere Tage lang geprüft und werde eine Stellungnahme abgeben.
Barette der Verfassungsrichter liegen nebeneinander
Player: videoChristopher Mestmacher, ARD Berlin, mit einem Überblick zur verschobenen Richterwahl
analyse
11.07.2025
Verschobene Richterwahl
Die Koalition stolpert in ihre erste große Krise
Der Vertrauensverlust durch die verschobene Verfassungsrichterwahl könnte für Schwarz-Rot zum Problem werden. mehr
Ethikratsvorsitzender besorgt über politische Kultur
Der Ethikratsvorsitzende und Jurist Helmut Frister äußerte sich vor dem Hintergrund der abgesetzten Richterwahl besorgt über die politische Kultur in Deutschland. Auf diese werde ein schlechtes Licht geworfen. "Sollte dies Schule machen, wäre zu befürchten, dass hoch qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber es sich in Zukunft zweimal überlegen, ob sie sich so etwas antun wollen", sagte Frister der Nachrichtenagentur KNA. Vergleiche mit den massiven Angriffen auf die Wissenschaftsfreiheit in den USA hält Frister dennoch für überzogen. Über Brosius-Gersdorf seien Unwahrheiten über ihre wissenschaftliche Positionen verbreitet worden, so Frister weiter. "Das von Frau Brosius-Gersdorf vertretene Konzept eines abgestuften Lebensschutzes muss niemanden gefallen, ist aber rechtswissenschaftlich gut vertretbar und bedeutet keineswegs, dass das ungeborene Leben verfassungsrechtlich völlig schutzlos gestellt wäre." Der im Grundgesetz verankerte Lebensschutz gelte nach diesem Konzept auch für das ungeborene Leben und setze dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren nach Abwägung Grenzen. Die Behauptung, Brosius-Gersdorf trete für eine Zulassung des Schwangerschaftsabbruchs bis zum Beginn der Geburt ein, entbehre folglich jeder Grundlage, hob Frister hervor.
Dieses Thema im Programm:
Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 15. Juli 2025 um 22:15 Uhr.
https://www.tagesschau.de/
Brosius-Gersdorf bei „Lanz“ zum Richterfiasko: „Hätte man sich in seinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen können“
Erstmals seit der gescheiterten Richterwahl tritt die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf öffentlich auf. Bei „Lanz“ berichtet sie von Morddrohungen und denkt laut über einen Rückzug nach.
Von Nico Preikschat
16.07.2025, 06:01 Uhr
Ein ungelöster Streit schwelt in der schwarz-roten Koalition, er dreht sich um eine Person: Frauke Brosius-Gersdorf. Die Juristin, von der SPD als Kandidatin fürs Bundesverfassungsgericht nominiert, löst in der Union viel Unmut aus. Vielen gilt sie als zu liberal, von manch obskurer Seite wird sie gar als linksradikal bezeichnet.
Als sich abzeichnete, dass Brosius-Gersdorf bei der geplanten Richterwahl im Bundestag am vergangenen Freitag keine Mehrheit erhalten würde, wurde die Abstimmung kurzfristig abgesagt. Seitdem knirscht es zwischen Union und SPD.
Brosius-Gersdorf selbst hielt sich aus der Öffentlichkeit fern, äußerte sich seither nur schriftlich. Nun trat sie am Dienstagabend in der Sendung von Markus Lanz auf. Für den Moderator ist es ein Coup, für die Juristin eine Gelegenheit zur Richtigstellung. Die Sendung in der TV-Kritik.
Brosius-Gersdorf berichtet von Morddrohungen
Lanz gesteht Brosius-Gersdorf nicht nur ein Einzelgespräch zu – eine seltene Ehre. Er gibt ihr zu Beginn auch die Möglichkeit, ausführlich über ihr Befinden zu sprechen. Ob sich die Juristin dabei sonderlich wohlfühlt, sei dahingestellt.
„Es geht mir den Umständen entsprechend“, sagt Brosius-Gersdorf. Die Berichterstattung über sie habe Spuren hinterlassen, auch in ihrem sozialen Umfeld. Ihre Menschenwürde und ihr Persönlichkeitsrecht seien zu achten, stellt Brosius-Gersdorf klar.
Sobald das auch nur droht, würde ich an meiner Nominierung nicht festhalten. Das ist ein Schaden, den kann ich gar nicht verantworten.
Frauke Brosius-Gersdorf, Juristin, über ihre Kandidatur als Richterin am Bundesverfassungsgericht
„Ist es zutreffend, dass sie sogar Morddrohungen bekommen haben?“, fragt Lanz. „Ja, wir haben Drohungen bekommen“, bestätigt die Juristin. Dazu kämen „Poststücke mit verdächtigem Inhalt, die an meinen Lehrstuhl gesendet wurden“. Sie habe ihre Mitarbeiter gebeten, vorerst nicht mehr dort zu arbeiten, berichtet die Professorin.
Äußerungen in der Öffentlichkeit über sie, etwa als „Kindsmörderin“, bezeichnet Brosius-Gersdorf als „tiefste Schmähungen“. „Jemand, der sich für ein so hohes Amt im Staat zur Verfügung stellt, muss sich der Diskussion stellen“, betont die Juristin. Natürlich gelte die Presse- und Meinungsfreiheit. „Aber das Ganze hat auch Grenzen“ – etwa bei Diffamierungen.
Eine gezielte Kampagne?
Wo liegen die Grenzen der medialen Berichterstattung? Der Moderator unterstellt Brosius-Gersdorf, eine „relativ pauschale Medienschelte“ betrieben zu haben, zumindest in ihren schriftlichen Äußerungen vom Dienstag.
„Ich habe ganz bewusst von einzelnen Medien, einzelnen Journalisten gesprochen“, verteidigt sich die Juristin. Deren Berichterstattung nennt sie „unvollständig, unsachlich, teilweise falsch“.
Zugleich habe es „viele gute Berichte“ gegeben. Aber es sei nicht akzeptabel, „wenn einzelne Thesen herausgepickt werden, und wenn Sätze falsch wiedergegeben werden und aus dem Zusammenhang gerissen werden“, so Brosius-Gersdorf.
Juristin Brosius-Gersdorf erklärt sich bei Markus Lanz Morddrohungen, eine schlaflose Nacht und ein möglicher Rückzug
Ist das schon eine gezielte Kampagne, wie es in den vergangenen Tagen vielfach hieß? Lanz ist skeptisch: Journalisten müssten eben kritisch nachfragen. Dennoch habe man „irgendwann“ das Gefühl gehabt, „da läuft auch jetzt tatsächlich eine Kampagne“, so Lanz. Brosius-Gersdorfs Urteil fällt eindeutiger aus: „Es war ein Teil einer Kampagne“, sagt sie.
Entlanghangeln an einzelnen Vorwürfen
Was über die Juristin vermeintlich herausgepickt wurde, das besprechen Moderator und Gast intensiv. An ihrer Position zum AfD-Verbotsverfahren hält Brosius-Gersdorf fest, eine Impfpflicht würde sie aus heutiger Sicht anders beurteilen, die Debatte um die Menschenwürde von Embryos im Mutterleib beschreibt die Professorin als Dilemma.
Die Richterin Frauke Brosius-Gersdorf in der Talk-Sendung „Markus Lanz“ mit dem namensgebenden Moderator. © dpa/MARKUS HERTRICH
Viel fruchtbarer, als sich an diesen einzelnen Positionen entlangzuhangeln, erscheinen jedoch die weitreichenderen Fragen, die sich daraus ergeben – und die vom Moderator treffsicher herausgearbeitet werden.
Da ist zum einen Brosius-Gersdorfs Selbstverständnis als Rechtswissenschaftlerin: Wie versteht sie ihre Rolle zwischen Öffentlichkeit und Juristerei? Immer wieder betont die Professorin, sie sei weder Politikerin noch Aktivistin, sondern Wissenschaftlerin. Als solche nehme sie wissenschaftlich Stellung.
„Entscheidend ist das Wort ‚nachdenken‘, Herr Lanz. Das ist das, was wir Juristen jeden Tag machen“, sagt Brosius-Gersdorf, angesprochen auf ihre Äußerungen zur Impfpflicht.
Sie sieht es so: Als Rechtswissenschaftlerin wäge sie verschiedene Rechtsgüter gegeneinander ab, so etwa bei der Abtreibungsfrage. Daraus könne man jedoch nicht zwingend eine politische Position ableiten.
Die Positionen, die sie vertrete, seien „absolut gemäßigte Positionen aus der Mitte der Gesellschaft“, beteuert Brosius-Gersdorf immer wieder. „Nun habe ich die alte Schwäche, dass ich mich nun mal relativ klar ausdrücke“, gesteht sie. Bei einem Wechsel ans Bundesverfassungsgericht würde sie sich jedoch anders verhalten: „Mir ist dieser Berufs- und Rollenwechsel komplett bewusst.“
Brosius-Gersdorf zeigt sich offen für einen Rückzug
Ob dieser Wechsel eines Tages stattfinden wird, steht wohl noch in den Sternen. Wie es nun für sie weitergehe, möchte Lanz von Brosius-Gersdorf wissen. „Das ist für mich auch wirklich nicht einfach, diese Frage“, antwortet sie nachdenklich. Es gebe viel abzuwägen.
Was sie tun würde, wenn die Debatte über sie irgendwann auch das Bundesverfassungsgericht beschädigen sollte, fragt Lanz. „Sobald das auch nur droht, würde ich an meiner Nominierung nicht festhalten. Das ist ein Schaden, den kann ich gar nicht verantworten“, antwortet Brosius-Gersdorf.
Schon jetzt habe die Richterwahl undenkbare Folgen gehabt, sagt die Juristin an anderer Stelle: „Das hätte man sich in seinen schlimmsten Träumen auch so nicht vorstellen können, diese Art von Politisierung einer Verfassungsrichterwahl.“ So etwas „sollte möglichst auch nicht mehr geschehen in dieser Republik, weil es Schaden anrichtet für unsere Demokratie“.
Ein irritierender Abschluss
Irritierenderweise hat Lanz an diesem Abend nicht nur Brosius-Gersdorf zu Gast. Nachdem die knapp einstündige Einzelbefragung der Rechtswissenschaftlerin beendet ist, diskutieren die Journalisten Anna Lehmann (taz) und Marc Felix Serrao (NZZ) über deren Auftritt.
Mehr zur gescheiterten Richterwahl:
Rekonstruktion einer Blamage Wie Union und SPD in das Debakel der Richterwahl stolperten
Fiasko um die Richterwahl Das doppelte Versagen in der Causa Brosius-Gersdorf
„Ultralinks“ oder „linksradikal“? Brosius-Gersdorf wehrt sich nach gescheiterter Richterwahl gegen Vorwürfe
Eher unbeholfen wirkt der Versuch der beiden Nicht-Juristen, Brosius-Gersdorfs Äußerungen zum Schwangerschaftsabbruch juristisch einzuordnen. Deutlich aufschlussreicher ist hingegen die Einschätzung der beiden Politikjournalisten, etwa zu den Ursachen und Folgen der gescheiterten Richterwahl.
Der Streit, der sich in den verbleibenden Minuten der Sendung zwischen beiden entwickelt, wirkt leider etwas zu gewollt. Aber so ganz ohne Zoff kommt wohl keine Lanz-Sendung aus.
https://www.tagesspiegel.de/
Auftritt im ZDF
Brosius-Gersdorf berichtet über Drohungen
Weil der Widerstand in der Union gegen Frauke Brosius-Gersdorf zu groß war, ist zuletzt die geplante Wahl von Verfassungsrichtern im Bundestag gescheitert. Jetzt hat sich die Staatsrechtlerin bei Markus Lanz geäußert.
16.07.2025, 00.46 Uhr
- Frauke Brosius-Gersdorf mit Moderator Markus Lanz: »Ich musste vorsorglich meine Mitarbeitenden bitten, nicht mehr am Lehrstuhl zu arbeiten« Foto: Markus Hertrich / ZDF / dpa
Die von der SPD für das Bundesverfassungsgericht nominierte Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf wird nach dem Scheitern der Richterwahl im Bundestag bedroht. »Wir haben Drohungen bekommen, also ich habe vor allem Drohungen bekommen, per E-Mail«, sagte sie in der ZDF-Sendung »Markus Lanz«. An ihren Lehrstuhl seien Poststücke mit verdächtigem Inhalt geschickt worden. »Ich musste vorsorglich meine Mitarbeitenden bitten, nicht mehr am Lehrstuhl zu arbeiten.«
Es gehe ihr den Umständen entsprechend, sagte Brosius-Gersdorf. Die Berichterstattung über die Verfassungsrichterwahl und ihre Person sei »nicht spurlos an mir vorbeigegangen, nicht an mir, nicht an meinem Mann, an meiner Familie, meinem gesamten sozialen Umfeld«.
Am Freitag war die Wahl zweier neuer Richterinnen und eines Richters für Karlsruhe kurzfristig von der Tagesordnung des Bundestags abgesetzt worden. Der Druck gegen Brosius-Gersdorf war in der Union zu groß geworden. Die Fraktionsführung konnte die mit dem Koalitionspartner verabredete Unterstützung nicht mehr garantieren.
Brosius-Gersdorf wies in einer Stellungnahme , die sie über eine Anwaltskanzlei veröffentlichte, die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurück. »Die Bezeichnung meiner Person als ›ultralinks‹ oder ›linksradikal‹ ist diffamierend und realitätsfern«, heißt es in dem Schreiben. Die Berichterstattung über ihre Person und ihre inhaltlichen Positionen sei von dem Ziel geleitet gewesen, »die Wahl zu verhindern«.
Dem Eklat im Bundestag waren Aktionen rechtspopulistischer Medien aus dem Umfeld der AfD vorausgegangen.
Mehr dazu lesen Sie hier: Diese Akteure stehen hinter der Netzkampagne gegen Brosius-Gersdorf
Im ZDF sagte Brosius-Gersdorf nun: »Es wurde in den vergangenen Wochen intensiv über mich berichtet und nach meinem Empfinden, in Teilen der Medien von einzelnen Journalisten auf Berufung auf anonyme Quellen eben unvollständig, unsachlich, teilweise falsch. Gerade im Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch.«
Unionszoff um gescheiterte Richterwahl: Und was, wenn am Ende niemand nachgibt? Von Jonas Schaible
Und was, wenn am Ende niemand nachgibt?
SPD-Kandidatin Brosius-Gersdorf: Die Kirche sollte sich aus der Wahl von Richtern heraushalten
Ein Kommentar von Felix Bohr
Die Kirche sollte sich aus der Wahl von Richtern heraushalten
Debatte über Richterpersonalie: Wie weit links steht Brosius-Gersdorf wirklich? Von Dietmar Hipp, Karlsruhe
Wie weit links steht Brosius-Gersdorf wirklich?
Abtreibungsgegner, etwa die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch oder der Bamberger Erzbischof, hatten Brosius-Gersdorf heftig angegangen. Zu den Anfeindungen sagte Brosius-Gersdorf im ZDF: »Ich muss sagen: Das kann ich mir nicht länger gefallen lassen. Ich finde das infam. Ich möchte daran erinnern, dass auch Vertreter der katholischen Kirche an die Verfassungswerte unseres Grundgesetzes gebunden sind und damit auch an meine Menschenwürde und mein Persönlichkeitsrecht.«
Wie es in der Debatte weitergeht, ist unklar. Die Union fordert eine neue Kandidatin für den Posten am Verfassungsgericht, die SPD hält an Brosius-Gersdorf fest.
lpz/dpa
https://www.spiegel.de/
"Markus Lanz"
"Das ist infam!": So kämpft die verhinderte Richterin um ihren Ruf
von Martin Debes
16.07.2025 06:23 Uhr
Frauke Brosius-Gersdorf in der ZDF-Sendung von Markus Lanz
© Markus Hertrich / ZDF / DPA
Die abgesetzte Verfassungsrichterwahl von Frauke Brosius-Gersdorf spaltet das Land. Im ZDF nahm die Rechtsprofessorin erstmals persönlich Stellung zu dem Eklat.
Markus Lanz hat die höchste Stufe seines Drama-Modus eingeschaltet. "Linksextremistin" oder "Opfer einer Kampagne?", fragt der ZDF-Moderator am späten Dienstagabend in die Kameras und macht dazu ein besonders ernsthaftes Gesicht.
Dann lässt er rasch eine klare Tendenz erkennen: "Sie ist völlig unverschuldet in einen Entrüstungssturm geraten."
Sie, das ist Frauke Brosius-Gersdorf, 54 Jahre alt, Rechtsprofessorin aus Potsdam. Sie sitzt ihm direkt gegenüber, andere Talkshow-Gäste sind vorläufig nicht zu sehen. Brosius-Gersdorf blickt starr durch ihre Brille und presst die Lippen zusammen, ihre langen Haare hat sie wie immer streng nach hinten gekämmt. "Es gab definitiv schon bessere Zeiten in meinem Leben", sagt sie. "Das hätte man sich in seinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen können."
Drohungen gegen Frauke Brosius-Gersdorf
Sie habe, berichtet sie, an ihrer Universität Drohungen per E-Mail erhalten, auch Poststücke mit verdächtigem Inhalt. "Ich musste vorsorglich meine Mitarbeitenden bitten, nicht mehr am Lehrstuhl zu arbeiten."
Die renommierte Verfassungsjuristin wirkt sichtlich angefasst. Die Art und Weise, wie sogar ein katholischer Erzbischof über sie hergezogen sei: "Ich finde das infam!"
Seit etwa einer Woche nun schon steht Frauke Brosius-Gersdorf im Zentrum einer politisch-kulturellen Großschlacht. Sie ist die am stärksten umkämpfte Richterkandidatin, die es je in der Bundesrepublik gab. (Die weitaus zahlreicheren Richterkandidaten sind ausdrücklich mitgemeint.)
Am vergangenen Freitag war ihre vor Wochen von CDU, CSU, SPD und Grünen vereinbarte und im zuständigen Ausschuss bestätigte Nominierung kurz vor dem Wahltermin im Bundestag abgesetzt worden. Zuvor hatte Unionsfraktionschef Jens Spahn angesichts des wachsenden Widerstands unter seinen Abgeordneten "die Notbremse" gezogen. So formulierte er es später selbst.
Die peinliche Absage war eine parlamentarische Premiere. Sie düpierte CDU-Kanzler Friedrich Merz und seinen Fraktionschef, verhagelte die Startbilanz der Bundesregierung und verunsichert die schwarz-rote Koalition, die doch alles viel besser als die Ampel machen wollte.
Nach der gescheiterten Richterwahl für Karlsruhe gibt sich Kanzler Friedrich Merz (CDU) betont gelassen
Streit um Richterwahl
Dieser Kniff könnte Merz und der Union aus der Klemme helfen
Artikel merken
Auch wenn der Kanzler mit seiner Einschätzung recht haben dürfte, dass die meisten Deutschen den Eklat nur "aus dem Augenwinkel" verfolgen: Die Menschen würden bestimmt ganz genau hinschauen, wenn seine Bundesregierung über die Affäre stürzte.
Eine streitbare Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht
Kurzum, eine solche Situation gab es im Bundestag noch nie. Und was es auch noch nie gab: eine streitbare Verfassungsrichter-Kandidatin wie Brosius-Gersdorf. Das betrifft nicht nur ihre sehr pointierten Aussagen zu schwierigen Themen wie Abtreibung, Geschlechterparität bei Wahllisten und die Corona-Impfpflicht, sondern auch ihre offensive Verteidigung gegen die Angriffe.
Am Dienstagmorgen hatte sie eine Erklärung veröffentlicht, in der sie eine Kampagne gegen sich beklagte. Die Berichterstattung "in Teilen der Medien"? "Unzutreffend und unvollständig, unsachlich und intransparent". Dass sie als "ultralinks" oder "linksradikal" bezeichnet werde? "Diffamierend und realitätsfern".
Am Dienstagabend sitzt Brosius-Gersdorf dann in ihrer Geburtsstadt Hamburg im Studio von Lanz und sagt, dass sie sich jeder sachlichen Kritik stelle, auch wenn sie hart und zugespitzt sei. Die Meinungs- und Pressefreiheit gelte, bekräftigt sie. Aber es gebe Grenzen, und die seien von einzelnen Journalisten und Politikern nicht beachtet worden.
Die Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf
Frauke Brosius-Gersdorf
Umstrittene Richter-Kandidatin rechnet mit Kritikern ab
Artikel merken
Diese Entwicklung bereite ihr Sorge, sagt die Professorin. "Wenn man das schon mit mir macht, dann müssen wir uns die Frage stellen, was dann in wirklich schweren Zeiten passiert."
Die Kandidatin wirkt sichtlich angefasst wegen der Politisierung ihrer Person. "Ich bin weder bei Ludwig Erhard noch bei Rosa Luxemburg", sagt sie. "Ich bin Wissenschaftlerin!" Dass eine politische Auseinandersetzung andere Regeln besitzt als eine akademische Debatte, will sie nicht akzeptieren. "Eigentlich sind die Schwerpunkte meiner Arbeit das Schulrecht, das Verfassungsrecht und das Sozialversicherungsrecht", sagt sie. Da aber habe leider niemand drüber geschrieben.
Weidel kritisierte Brosius-Gersdorf
Brosius-Gersdorf ist am Dienstagabend nicht das erste Mal zu Gast bei Lanz. Vor einem Jahr sagte sie in der Sendung, dass ein AfD-Verbotsverfahren "ein ganz starkes Zeichen unserer wehrhaften Demokratie ist, dass sie sich gegen Verfassungsfeinde wehrt". Dann setzte sie noch hinzu: Richtig sei, "dass damit natürlich nicht die Anhängerschaft beseitigt ist".
Der Satz wurde denn auch von AfD-Chefin Alice Weidel in der Debatte Freitag im Bundestag genüsslich seziert. "Das ist der Sprachduktus Ihrer Kandidatin für das höchste Gericht", rief sie der SPD zu – "die lediglich bedauert, dass man unsere zehn Millionen Wähler nicht beseitigen kann!"
Bei ihrem aktuellen Lanz-Aufritt gibt sich Brosius-Gersdorf an dieser Stelle selbstkritisch. Diese "eine Formulierung" sei "nicht glücklich" gewesen, sagt sie. Aber, so schiebt sie sofort nach: "Jeder, der die Sendung in Gänze gesehen hat, weiß natürlich, was ich damit gemeint habe: Dass mit einem Parteiverbotsverfahren nicht die Probleme beseitigt werden, die Menschen dazu veranlassen, sich von der demokratischen Mitte abzuwenden."
Verfassungsgericht 2. Senat - Symbolbild zum Thema Frauke Brosius-Gersdorf
Frauke Brosius-Gersdorf
Kulturkampf um Richterin – droht die "Supreme-Courtisierung" Deutschlands?
Artikel merken
In diesem Ton geht es weiter. Lanz konfrontiert die Wissenschaftlerin mit ihrer Aussage während der Corona-Pandemie: "Man kann sogar darüber nachdenken, ob mittlerweile eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Einführung einer Impfpflicht besteht." Brosius-Gersdorf wirkt betont ungerührt. "Aber entscheidend ist das Wort 'Nachdenken', Herr Lanz", antwortet sie. "Das ist das, was wir Juristen jeden Tag machen."
Schließlich gelangt Lanz zum Thema Abtreibung. Brosius-Gersdorf war unterstellt worden, dass sie den Schwangerschaftsabbruch bis zur Geburt legitimieren wolle.
Sie widerspricht vehement. "Wenn Sie das Lebensrecht des Embryos und die Grundrechte der Frau mit gleichem Schutz gegenüberstellen", sagt sie, "dann können Sie den Schwangerschaftsabbruch zu keiner Zeit rechtfertigen, nicht einmal in Fällen der medizinischen Indikation." Allein auf dieses rechtliche Dilemma habe sie hinweisen wollen.
Verzichtet sie auf das Amt?
"Wie geht es weiter?", fragt Markus Lanz am Ende. "Das ist 'ne gute Frage", antwortet die Kandidatin. "Das ist sicher heute Abend nicht der richtige Zeitpunkt, um das zu entscheiden."
Die Frage sei für sie "wirklich nicht einfach": "Es geht nicht mehr nur um mich, Herr Lanz. Es geht auch darum, was passiert, wenn sich solche Kampagnen – und es war in Teilen eine Kampagne – durchsetzen. Was das mit uns macht, was das mit dem Land macht, mit der Demokratie ... das muss ich wägen."
Es erscheint also möglich, dass Brosius-Gersdorf auf ihren Antritt verzichtet. Die SPD selbst wird ihre Kandidatin nicht zurückziehen, das hat die Bundestagsfraktion klargemacht. Hört man wiederum in die Unionsfraktion hinein, hat der mediale Doppelschlag der Verfassungsrechtlerin den Widerstand unter den Abgeordneten eher bestärkt.
Die Lage bleibt also vorerst maximal kompliziert. Am Dienstagabend saß auch die CSU-Forschungsministerin Dorothee Bär in einer Talkshow, bei Sandra Maischberger in der ARD. "Wir haben lauter mündige Abgeordnete", sagte sie. "Und wenn die sagen, ich kann mit meinem Gewissen Frau Brosius-Gersdorf nicht wählen, dann akzeptiere ich das, dann respektiere ich es – und dann erwarte ich aber auch von der Kandidatin, dass sie mal für sich selbst überlegt, ob sie die Richtige ist.
https://www.stern.de/
Streit über Kandidatin für Verfassungsgericht
Diese Akteure stehen hinter der Netzkampagne gegen Brosius-Gersdorf
Die vorerst gescheiterte Richterwahl hat die Koalition beschädigt. Vorausgegangen war dem Eklat eine orchestrierte Aktion von Abtreibungsgegnern, rechtspopulistischen Medien und dem Umfeld der AfD. Hatten sie Einfluss auf die Union?
Von Fabian Hillebrand, Livia Sarai Lergenmüller und Severin Weiland
15.07.2025, 15.33 Uhr • aus DER SPIEGEL 30/2025
Frauke Brosius-Gersdorf: Schon für einen Auftritt bei Lanz wurde sie vielfach kritisiert Foto: teutopress / IMAGO
https://www.spiegel.de/
Frauke Brosius-Gersdorf
Stimmungsmache von rechts
Mit Vorwürfen bis hin zu Falschbehauptungen wurde die von der SPD als Verfassungsrichterin nominierte Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf zur linken Aktivistin stilisiert. Ein politischer Thinktank kommt zu dem Schluss, dass es sich um eine Kampagne gehandelt hat.
15.07.2025
Frauke Brosius-Gersdorf sitzt in einem Sessel in einem TV-Studio. Sie blickt ernst in Richtung Kamera.
Viele Politiker der Union wollten nach einer hitzigen Debatte nicht mehr für Frauke Brosius-Gersdorf als Verfassungsrichterin stimmen. (picture alliance / teutopress / -)
Innerhalb von zwei Wochen wurde aus der renommierten Jura-Professorin Frauke Brosius-Gersdorf eine linke Aktivistin. Die SPD wollte sie als Verfassungsrichterin. Doch schließlich erschien Brosius-Gersdorf für Teile der Unionsfraktion im Bundestag unwählbar. Die für den 11. Juli 2025 im Bundestag angesetzte Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht wurde kurzfristig abgesetzt.
Angestoßen wurde die massive Kritik an der Juristin von rechten Online-Plattformen, verbreitete sich über soziale Netzwerke und wurde dann von einigen großen konservativen Tageszeitungen aufgegriffen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch wirft der Union deshalb vor, einer „Schmutzkampagne“ nachgegeben zu haben – und auch ein politischer Thinktank kommt zu dem Schluss, dass es sich um eine Kampagne gegen Brosius-Gersdorf gehandelt habe.
Inhalt
- Wie verbreitete sich die Kritik an Frauke Brosius-Gersdorf?
- Hat die Verbreitung der Vorwürfe die Richterwahl platzen lassen?
- Wofür steht die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf tatsächlich?
Informationen am Morgen
Lügen und FührungsschwächeWie kann es mit der Personalie Brosius-Gersdorf weiter gehen?
05:51 Minuten17.07.2025
Wie verbreitete sich die Kritik an Frauke Brosius-Gersdorf?
Der Thinktank Polisphere hat in einer Social-Media-Analyse Zehntausende Posts auf der Plattform X ausgewertet. Geschäftsführer Philipp Sälhoff spricht auf Linkedin von einer Kampagne gegen die Juristin. „Es war ein schmerzhafter Sieg der rechten Netzwerke aus „Alternativmedien“, Influencern und ihren politischen Verbündeten, der AfD“, schreibt er. „Innerhalb weniger Tage wurde eine Kampagne durchgeführt, die ihren erfolgreichen Abschluss im Plenarsaal des Bundestags fand.“
Der Polisphere-Analyse zufolge begann die Kampagne gegen die Rechtsprofessorin am 1. Juli mit einem Artikel beim rechtslibertären Alternativmedium Apollo News, der lauter Kulturkampf-Themen anbot: etwa dass Brosius-Gersdorf während der Pandemie eine Impfpflicht befürwortete, dass sie eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen unterstützt – und dass sie, sollte sie Verfassungsrichterin werden, in dieser Position die AfD verbieten werde.
Die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf spricht auf einer Pressekonferenz
Richterwahl-EklatEin Erfolg für die Neue Rechte
06:03 Minuten14.07.2025
Rechtspopulistische Medien griffen das Thema auf und verstärkten so die Aufmerksamkeit: Allein NIUS veröffentlichte der Analyse zufolge 20 Artikel innerhalb von zehn Tagen. Der Fokus, der zunächst auf einem möglichen AfD-Verbot lag, verschob sich später zum Thema Schwangerschaftsabbruch. In den letzten 24 Stunden kamen auch noch Plagiatsvorwürfe hinzu, von denen sich der „Plagiatsjäger“ Stefan Weber allerdings schnell distanzierte und schrieb, die Sichtweise, er habe Plagiatsvorwürfe erhoben, sei falsch.
Auf Social Media verbreiteten sich neben den Artikeln der Alternativmedien laut der Polisphere-Auswertung außerdem KI-generierte Inhalte, die Brosius-Gersdorf als linke Aktivistin darstellten. AfD-Politiker riefen dazu auf, an CDU-Bundestagsabgeordnete zu schreiben, dass die Juristin unwählbar sei. Schließlich gab es eine Petition gegen Brosius-Gersdorf. Und am Ende griffen auch seriöse Medien die Vorwürfe gegen Frauke Brosius-Gersdorf auf.
Selbst Unwahrheiten schafften es in den Bundestag: Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch behauptete in einer Frage an den Bundeskanzler, Brosius-Gersdorf habe gesagt, dass einem neun Monate alten Fötus zwei Minuten vor der Geburt keine Menschenwürde zukomme – und legte so nahe, die Juristin wolle Abtreibungen zu diesem Zeitpunkt freigeben.
Die Rechtsprofessorin Brosius-Gersdorf selbst nennt es diffamierend und realitätsfern, wenn sie als „ultralinks“ oder „linksradikal“ eingeordnet werde. Vor allem die Behauptung, sie habe sich für eine Freigabe des Schwangerschaftsabbruch bis kurz vor Geburt eingesetzt, weist sie scharf zurück und bezeichnet dies als verunglimpfend.
Podcast: Studio 9
Eklat um RichterwahlDie Verfassungsgerichtskandidatin Brosius-Gersdorf äußert sich
05:49 Minuten15.07.2025
Hat die Verbreitung der Vorwürfe die Richterwahl platzen lassen?
Es handele sich „um einen medialen und politischen Erfolg für die Neue Rechte“, sagt die Deutschlandfunk-Journalistin Christiane Florin, die seit Längerem deren Strategie beobachtet. Diese bestehe darin, „demokratische Institutionen zu sabotieren, einen permanenten Ausnahmezustand herbeizureden und den Eindruck zu erzeugen, nur eine rechte Partei könne das Volk aus diesem Chaos retten“.
Der Erfolg für die Neue Rechte besteht demnach darin, dass Falschbehauptungen, Halbwahrheiten und Gerüchte die Sphäre der sogenannten alternativen Medien verlassen und Bundestagsabgeordnete der CDU beeinflusst haben, sodass die Abstimmung über die Verfassungsrichter nicht stattfinden konnte. Die Neue Rechte arbeitet seit vielen Jahren an der Entgrenzung, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und den USA.
Eines der Hauptthemen in diesem Entgrenzungskampf ist der Widerstand gegen feministische Politik und vor allem gegen die Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Mit der kurzfristig verschobenen Richterwahl zeigt sich, dass der Kampf gegen Abtreibungen nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland Mobilisierungspotenzial aufweist.
Frauke Brosius-Gersdorf
Bundestag
Verfassungsrichterwahl mit Hindernissen
Der Bundestag sollte drei neue Verfassungsrichter wählen. Doch die Abstimmung wurde kurzfristig verschoben. Hintergrund ist Kritik der Union an der SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf wegen ihrer Haltung zur Abtreibung.
Auch für die AfD ist die Verschiebung der Richterwahl nach Einschätzung von Christiane Florin ein großer Erfolg: Mit Bundestag, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht seien gleich drei Institutionen beschädigt worden.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine andere Perspektive. Er wurde im ARD-Sommerinterview auf den Einfluss rechter Netzwerke auf die gescheiterte Richterabstimmung angesprochen, wies das jedoch als Verschwörungserzählung zurück: „Ich habe gehört, dass auf Social Media alle möglichen Theorien bis hin zu Verschwörungstheorien verbreitet worden sind“, sagte Merz. „Das ist hier keine rechte Verschwörung. Jedenfalls sind wir nicht Teil davon, wenn sie überhaupt stattgefunden hat.“
Podcast: Studio 9
Bundeskanzler Merz im ARD-SommerinterviewDefensiv genervt
03:43 Minuten14.07.2025
Tatsächlich existiert eine weltweite Allianz zwischen Rechtspopulisten, Rechtsextremen und der religiösen Rechten: Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass es diese Netzwerke gibt, im Sinne einer weltweiten Bewegung mit Geld und einer politischen Mission gegen die liberale Demokratie. „Es geht nicht allein darum, ob Jens Spahn und der Kanzler die Fraktion im Griff haben, sondern es geht um eine politische Tiefenbewegung“, betont Christiane Florin.
Peter Thiel hält sich eine Hand halb vor sein Gesicht
Die Peter Thiel Story
Wofür steht die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf tatsächlich?
Frauke Brosius-Gersdorf ist Professorin an der Universität Potsdam. Dort hat die 54-jährige Hamburgerin einen Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Verfassungsrecht und Sozialrecht, inne. Sie wurde zwar von der SPD für die Verfassungsrichterwahl nominiert, „aber wer sich eine linientreue SPD-Juristin vorstellt, liegt ganz falsch“, sagt der Jurist und Journalist Ronen Steinke. „Sie ist ein unabhängiger Geist.“
Kommentar und Themen der Woche
Kommentar zur Kandidatin Frauke Brosius-GersdorfEin unabhängiger Geist
04:24 Minuten05.07.2025
Die Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf von der Universität Potsdam spricht in der Bundespressekonferenz zum Abschlussbericht der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin.
Kommentar zur VerfassungsrichterwahlFalschbehauptungen und Gerüchte
04:37 Minuten12.07.2025
Die Rechtswissenschaftlerin sei liberal in dem Sinne, dass sie sich für eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ausspricht. Als Mitglied einer Expertenkommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin verfasste Brosius-Gersdorf 2024 eine juristische Einschätzung zur Neuregelung von Schwangerschaftsabbrüchen. In ihrem Gutachten ging es darum, wie die Rechte des ungeborenen Lebens und die Rechte der Mutter miteinander abzuwägen sind.
Auch sonst ist Brosius-Gersdorf gesellschaftspolitisch progressiv: So ist sie etwa für Frauenquoten in Parlamenten offen, die andere Verfassungsrechtler für zu weitgehend halten. In wirtschaftspolitischen Fragen wiederum ist sie keine klassische Linke, steht den Gewerkschaften eher nüchtern gegenüber, schreibt das Grundrecht auf Privateigentum groß, und hat sich auch schon für die Rente mit 70 ausgesprochen. Auch für die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung hat sie bereits wissenschaftliche Gutachten geschrieben. Vom Plan der ehemaligen SPD-Innenministerin Nancy Faeser, das rechte Monatsmagazin „Compact“ zu verbieten, hielt Brosius-Gersdorf wenig, so Ronen Steinke.
jfr
https://www.deutschlandfunk.de/
Frauke Brosius-Gersdorf:
«Realitätsfern»: Umstrittene Richter-Kandidatin wehrt sich
Die Jura-Professorin Frauke Brosius-Gersdorf hat sich öffentlich zu den Vorwürfen geäussert, die am Freitag zum Abbruch der Richterwahl geführt haben.
15.07.2025
Justin Arber
Verfassungsrichter-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf wehrt sich gegen Kritik.
1 / 3
Die Jura-Professorin kritisiert vor allem die Berichterstattung. Unter anderem, dass sich staatliche Funktionsträger anonym geäussert haben.
1 / 3
Aus der Union kommen Forderungen nach einer neuen Kandidatin, zum Beispiel von CSU-Chef Markus Söder.
1 / 3
1 / 3
Verfassungsrichter-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf wehrt sich gegen Kritik.
Britta Pedersen/dpa
Darum gehts
- Die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf verteidigt sich gegen Vorwürfe, sie sei linksradikal.
- Sie kritisiert die Medienberichterstattung als unsachlich und betont ihre demokratische Mitte-Position.
- Falschdarstellungen zu ihrer Haltung bei Schwangerschaftsabbrüchen und Kopftuchverboten werden zurückgewiesen.
- Die Richterwahl wurde aufgrund von Widerstand aus der Union abgesetzt.
Die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, hat sich öffentlich und ausführlich zur abgesetzten Richterwahl am Freitag geäussert.
Es sei «diffamierend und realitätsfern», sie als ultralinks oder linksradikal darzustellen, heisst es in einer Erklärung, die unter anderem Focus.de vorliegt. Die Kritikpunkte in der Übersicht.
Kritik an Berichterstattung
Brosius-Gersdorf kritisiert die Berichterstattung als «in Teilen unzutreffend, unvollständig, unsachlich und intransparent». Ordne man ihre wissenschaftlichen Positionen in ihrer Breite politisch zu, «zeigt sich ein Bild der demokratischen Mitte. Einseitige Zuschreibungen (‹ultralinks› und ‹linksradikal›) entbehren der Tatsachenbasis.»
Kritik an staatlichen Funktionsträgern
«Kritik müssen sich auch einzelne staatliche Funktionsträger gefallen lassen», heisst es in der Erklärung weiter. Brosius-Gersdorf bezieht sich dabei auf in den Medien abgedruckte Aussagen unter Berufung auf anonyme Quellen. «In Zeiten, in denen Politikerinnen und Politiker für sich zu Recht stärkeren Schutz vor verbalen Angriffen fordern und ein ‹digitales Vermummungsverbot› diskutieren, befremden anonyme Äusserungen aus den Reihen politisch verantwortlicher Funktionsträger des Staates.»
Die Richterwahl wurde am Freitag abgesetzt, nachdem Vorwürfe gegen SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf aufgekommen waren.
Britta Pedersen/dpa
Einzelne Positionen
Brosius-Gersdorf bezeichnet auch die Vorwürfe, sie sei für einen Schwangerschaftsabbruch bis zur Geburt, als falsch. «Dem menschlichen Leben steht ab Nidation das Grundrecht auf Leben zu. Dafür bin ich stets eingetreten. Die Aussage, ich wäre für eine Legalisierung und eine (hiervon zu unterscheidende) Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs bis zur Geburt, ist unzutreffend und stellt eine Verunglimpfung dar.» Ihre Veröffentlichungen zu diesem Thema liessen sich auch nicht missverstehen. Auch ihre Positionen zu einem Kopftuchverbot und zu Paritätsmodellen für die Wahl des Bundestags seien häufig falsch dargestellt worden.
So geht es weiter
Drei Richterposten sollten im Bundestag am Freitag besetzt werden. Weil die von der SPD vorgeschlagene Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf aber bei der Union auf Widerstand stiess, wurde die Wahl aller drei Richter abgesetzt.
Werbung
Die SPD will an Brosius-Gersdorf festhalten. Aus der Union kommen hingegen Forderungen nach einer neuen Kandidatin, beispielsweise von CSU-Chef Markus Söder. Die Spitzen von Union und SPD beraten hinter verschlossenen Türen über eine Lösung. Wie diese aussehen könnte, ist noch nicht bekannt.
Darum wurde das Kommentarfeld deaktiviert
- Wir wissen, wie wichtig es ist, eure Meinung zu teilen. Leider müssen wir die Kommentarspalte bei diesem Artikel geschlossen lassen. Es gibt Themen, bei denen wir wiederholt Hasskommentare und Beleidigungen erhalten. Trotz intensivem Aufwand findet in diesen Kommentarspalten kein konstruktiver Austausch statt. Das bedauern wir sehr. Bei Storys rund um Todesfälle, Verbrechen und Unglücke verzichten wir ebenfalls auf die Kommentarfunktion.
- Uns ist der Austausch mit euch enorm wichtig – er ist ein zentraler Bestandteil unserer Plattform und ein wesentlicher Baustein einer lebendigen Demokratie. Deshalb versuchen wir die Kommentarspalten so oft wie möglich offenzuhalten.
- Ihr habt es selbst in der Hand: Mit respektvollen, konstruktiven und freundlichen Kommentaren tragt ihr dazu bei, dass der Dialog offen und wertschätzend bleibt. Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch in der nächsten Kommentarspalte!
https://www.20min.ch/
Gescheiterte Richterwahl
„Unsachlich, intransparent“, attackiert Brosius-Gersdorf ihre Kritiker – SPD erleichtert, AfD empört
Veröffentlicht am 15.07.2025Lesedauer: 4 Minuten
Frauke Brosius-Gersdorf sollte von der SPD als Richterin zum Bundesverfassungsgericht geschickt werden. Es gab viele Kontroversen. Jetzt hat sie sich selbst dazu geäußert. WELT Reporter Gerrit Seebald berichtet aus Berlin.
Quelle: WELT TV
Vergangene Woche scheiterte die Wahl von zwei Richterinnen und einem Richter für das Bundesverfassungsgericht. Aus der Union kam Kritik an der SPD-Kandidatin, die nun Stellung bezogen hat. Linke und SPD begrüßten die Erklärung – die AfD hingegen spricht von „linksideologischen“ Aussagen.
Nach der gescheiterten Wahl von drei Verfassungsrichtern im Bundestag hat die von der SPD vorgeschlagene Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf Darstellungen zurückgewiesen, sie sei „ultralinks“ oder „linksradikal“.
In einem Brief an die Medien, der WELT vorliegt, betont sie, dass die Darstellung ihrer Person in einigen Publikationen „unzutreffend und unvollständig, unsachlich und intransparent“ gewesen sei. „Sie war nicht sachorientiert, sondern von dem Ziel geleitet, die Wahl zu verhindern“, heißt es weiter.
Lesen Sie auch
ARCHIV - 15.04.2024, Berlin: Frauke Brosius-Gersdorf, Juristin, stellt den Abschlussbericht der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin vor. Brosius-Gersdorf soll Nachfolgerin für die Richterin des Bundesverfassungsgerichts im Zweiten Senat, Doris König, werden. Der Bundestag stimmt am Freitag, 11.07.2025 in geheimer Wahl ohne Aussprache über die Wahlvorschläge des Wahlausschusses für die Richter des Bundesverfassungsgerichts ab. Foto: Britta Pedersen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
„Vom Ziel geleitet, die Wahl zu verhindern“ – Die Erklärung von Frauke Brosius-Gersdorf im Wortlaut
Solche Einstufungen seien diffamierend und realitätsfern, heißt es in der Erklärung der Professorin. So sei etwa die Behauptung verunglimpfend, sie habe sich für eine Legalisierung und eine Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs bis zur Geburt ausgesprochen.
Auch ihre Positionen zu einem Kopftuchverbot und zu Paritätsmodellen für die Wahl des Bundestags seien häufig falsch dargestellt worden, betont Brosius-Gersdorf in dem Schreiben.
Eine eingehende Befassung mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit zeige vielmehr, dass ihre Positionen im Ganzen betrachtet der demokratischen Mitte zuzuordnen seien.
Lesen Sie auch
DWOSB_Unionsfraktion_js
Abgesagte Richterwahl
„Trauen wir uns jetzt nicht mal mehr, unsere wahren Gründe für die Ablehnung zu sagen?“
In dem Schreiben kritisiert Brosius-Gersdorf die Äußerungen „einzelner staatlicher Funktionsträger“: „In Zeiten, in denen Politikerinnen und Politiker für sich zu Recht stärkeren Schutz vor verbalen Angriffen fordern und ein ,digitales Vermummungsverbot‘ diskutieren, befremden anonyme Äußerungen aus den Reihen politisch verantwortlicher Funktionsträger des Staates“, heißt es. Beides stehe im Widerspruch zueinander.
Lesen Sie hier die Erklärung von Frauke Brosius-Gersdorf im Wortlaut
Für die SPD begrüßte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sonja Eichwede die Stellungnahme der Kandidatin. „Frau Professor Brosius-Gersdorf bestätigt mit ihrer Erklärung genau das, was wir seit Tagen sagen: Die ihr vorgeworfenen Äußerungen waren falsch, verkürzt dargestellt oder unzutreffend. Mittlerweile haben sich auch viele namhafte Juristen hinter sie gestellt, die mit Entsetzen sehen, wie versucht wurde, eine renommierte Kollegin und herausragende Staatsrechtslehrerin öffentlich zu diskreditieren“, so die SPD-Politikerin zu WELT.
Sie sei, so Eichwede weiter, „froh, dass sich Frau Brosius-Gersdorf nun selbst zu Wort gemeldet hat, um die Gerüchte auszuräumen. Ein Grund mehr für die Unionsfraktion, jetzt das Gespräch mit ihr zu suchen“.
„Brosius-Gersdorf steht politisch das Wasser bis zum Hals“, stichelt die AfD
Auch Die Linke im Bundestag stellte sich in einer Stellungnahme ausdrücklich hinter die Erklärung von Brosius-Gersdorf. „Der Brief geht sachlich auf alle Punkte ein, die in den vergangenen Tagen dafür genutzt wurden, eine beispiellose Hetzkampagne gegen Brosius-Gersdorf zu fahren“, sagte die Linke-Innenpolitikerin Clara Bünger WELT.
Hätte man sich mit ihren Aussagen etwas mehr beschäftigt, als „Verdrehungen und Verzerrungen von rechts“ zu übernehmen, „hätten wir heute wahrscheinlich eine wissenschaftlich sehr starke und unabhängige neue Richterin am Bundesverfassungsgericht gehabt“.
Die Alternative für Deutschland (AfD) hingegen übt scharfe Kritik an der Staatsrechtlerin: „Den beiden umstrittenen Kandidatinnen Kaufhold und Brosius-Gersdorf steht politisch das Wasser bis zum Hals. Dass Letztere jetzt versucht, die Kritiker zu diffamieren, erinnert an einen Ertrinkenden, der wild um sich schlägt“, sagte der AfD-Rechtspolitiker Stephan Brandner WELT. „Ihre Aussagen sind eindeutig links‑ideologisch bis verfassungsfeindlich und lassen sich nicht weginterpretieren, wie sie es probiert.“
Dass insbesondere Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) keine Probleme mit ihrer „lebensfeindlichen Ideologie“ zu haben scheine, habe der Regierungschef in der Befragung der Bundesregierung „eindrucksvoll bewiesen“. „Wir gehen davon aus, dass die Kandidatin jetzt über die Sommerpause ‚salonfähig‘ gemacht werden soll, um sie seitens der Regierenden im Herbst durchzuwinken.“
„Niemand (...) hat der Kandidatin unterstellt, linksradikal zu sein“, verteidigt sich die CSU
Für die Union äußerte sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. Er warb in seiner Erklärung für mehr Respekt und weniger gegenseitige Vorwürfe im Ringen der Koalition um die Wahl von Verfassungsrichtern. Nur so könne ein gemeinsames, mehrheitsfähiges Kandidaten-Paket gelingen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Nötig seien „Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht, Respekt vor den Kandidaten und der Respekt vor der Entscheidung der Abgeordneten“.
Hoffmann reagierte auch auf die erste Stellungnahme der umstrittenen SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf nach der geplatzten Richterwahl im Bundestag.
Brosius-Gersdorf hatte darin die Bezeichnungen „ultralinks“ und „linksradikal“ als diffamierend und realitätsfern zurückgewiesen. Hoffmann betonte: „Niemand aus der Union und aus den Kirchen hat der Kandidatin unterstellt, linksradikal zu sein.“
dpa/rct/lay/krott/jac
https://www.welt.de/
Die Jagd auf „die Mitte“
Tauchsieder
Die Union lässt mal wieder alle Anstandsmasken fallen und würdigt sich zum parlamentarischen Arm einer rechtsaktivistischen Apo herab: Sie richtet eine Juristin, beschädigt die Koalition, „Karlsruhe“ – und das Konservative. Eine Kolumne.
Dieter Schnaas
15.07.2025 - 10:30 Uhr
FriedrichFriedrich Merz kann es noch immer nicht. Woher auch? Er hat nach vielen, vielen Rückschlägen und Kränkungen vor drei Jahren die CDU-Spitze erobert. Er ist nach vielen, vielen gebrochenen Versprechen, (Ent-)Täuschungen und Kehrtwenden vor zwei Monaten zum Kanzler gekürt worden.
Und er ist als Regierungsvolontär dann gleich im Chefsessel der Weltpolitik gelandet – als Außenkanzler, der seine lange aufgestauten Ich-kann-es-besser-Energien endlich überschießen lassen kann und im Tim-Bendzko-Modus unterwegs sein darf, sich selbst dabei permanent belobigend („Deutschland ist zurück auf der Weltbühne“) und allem Kleindeutschlandgeplänkel glücklich enthoben: „Nur noch kurz die Welt retten“ in Washington und Brüssel, Paris und Kiew; im Vertrauen darauf, dass Union-Fraktionschef Jens Spahn ihm innen- und koalitionspolitisch wenigstens die ersten paar Wochen den Rücken freihält. Tja.
Dazu war Jens Spahn nicht in der Lage. Oder wollte es nicht sein. Er hat in der vergangenen Woche eine (unwürdig undifferenzierte) Diskussion in der Union über Standpunkte einer potenziellen Verfassungsrichterin unterschätzt oder schlicht laufen lassen, sie nicht eingefangen oder einfangen wollen – bis zuletzt auch das Machtwort des herbeigeeilten Kanzlers (und CDU-Chefs) nichts mehr half.
WiWo+Streit in der Koalition
Diesen Freitag wird Merz' Regierung so schnell nicht verkraften
Union und SPD scheitern an der Wahl neuer Verfassungsrichter. Dieser Eklat dürfte Folgen haben – auch für den Wirtschaftsplan des Kanzlers. Eine Analyse.
von Benedikt Becker und Max Haerder
Das alles spricht gegen seine, Spahns, politische Kompetenz und die des Regierungschefs, gegen die Koalitionsfähigkeit der Unionsfraktion – und gegen den Willen vieler in CDU und CSU, Deutschland noch aus der Mitte heraus zu regieren.
Denn tatsächlich ist die Denunziation und Demontage der Potsdamer Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf nicht nur menschlich erbärmlich, peinlich für Spahn und Merz und belastend für Schwarz-Rot. Sie ist auch – nachdem Friedrich Merz der AfD im Februar ohne Not den Triumph eines gemeinsam verabschiedeten Gesetzes geschenkt hat – der zweite Frontalangriff der Union auf die Stabilität der Demokratie in diesem Land: blamabel, beschämend, unverzeihlich.
Was genau ist geschehen? Am Freitag hat die Unionsfraktion die von ihr und der SPD zuvor verabredete Nachbesetzung von drei Richterstellen für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gestoppt, weil ihr die Personalie Brosius-Gersdorf plötzlich nicht mehr genehm schien.
Erst rang die Unionsfraktion der SPD offenbar noch das Zugeständnis ab, der von ihr nominierten Kandidatin den vorgezeichneten Weg an die Spitze eines Senats zu verbauen; dann versuchte sie die Berufung Brosius-Gersdorfs mit sachgrundloser Verleumdung zu sabotieren, ließ im Bundestag munter ehrabschneidende Gerüchte zirkulieren, nahm die strittige Personalie schließlich von der Tagesordnung – und schlug der SPD vor, bitte zunächst nur die beiden übrigen Kandidaten wählen zu lassen.
Prof. Frauke Brosius-Gersdorf Foto: picture alliance / teutopress
Dilettantismus plus Chuzpe mal Niedertracht und üble Nachrede – das war zu viel für die SPD. Sie sorgte am Ende dafür, dass die Richterwahl als Ganzes verschoben wird, legte also kurz vor der Sommerpause einen politischen Schwelbrand in Berlin.
Was soll's. Ein paar Urlaubstage – und die erste Koalitionskrise könnte schon bald wieder vergessen sein. Ein düpierter Kanzler und Fraktionschef, deren Empfehlungen und Machtworte nichts zählen – im September geht der Betrieb wieder von vorne los…
Entscheidend und zutiefst verstörend ist etwas anderes – nämlich der sich verfestigende Anstandsverlust in der Union, der von ihr geduldete, unterstützte, schließlich angeführte Triumphzug der Pöbelei in diesem Land.
Die Union hat sich vor den Karren einer Schmutzkampagne gegen eine vor Wochenfrist noch weitgehend unbekannte Rechtsgelehrte spannen lassen und sogar den Versuch unternommen, sie mit Plagiatsvorwürfen öffentlich hinzurichten.
Sie hat damit abermals den politischen Comment beschädigt und ist mit Herzenslust in die Falle rechtspopulistischer Kulturkämpferei getappt. Sie hat erneut ohne Not „die Mitte“ preisgegeben und sich zum parlamentarischen Arm einer rechtsaktivistischen (Netz-Hetz-)Apo herabgewürdigt.
Sie hat die Reputation der (Rechts-)Wissenschaft beschädigt und die Legitimation des Bundesverfassungsgerichts untergraben. Sie hat das Problem der Diskursvergiftung in diesem Land verschärft und sich an so ziemlich allem versündigt, was Konservativen einmal hoch und heilig war. Und was das Schlimmste ist: CDU und CSU erwecken als Ganze nicht mehr den Eindruck, ihnen sei das alles wenigstens unangenehm.
Bundestag
Geplatzte Richterwahl erschüttert Koalition
Kanzler Merz wollte eine Koalition ohne öffentlichen Streit – anders als die Ampel. Mit diesem Anspruch ist er schon gut zwei Monate nach Amtsantritt gescheitert.
Lieber ermuntert man die Wähler, zu glauben, ein linker Aktivismus drohe nun auch noch in „Karlsruhe“ dominant zu werden, ein woker Zeitgeist zersetze schon bald die Buchstaben des Grundgesetzes – ganz so wie die AfD es bei jeder Gelegenheit tut, um die Institutionen des Rechtsstaates sturmreif zu schießen.
Ihnen allen, ihrer Zersetzungslust, ihrem Fanatismus, ihrer rasenden Eiferei, möchte man mit Voltaire ein Écrasez l’infâme ins Gesicht schreien: Nieder mit der Niedertracht!
Was Frauke Brosius-Gersdorf als Juristin anbelangt, erster Punkt: Sie scheut offenbar keine klaren Ansagen. Sie ist streitbar. Sie begibt sich gern in die Diskussionsarena. Sie vertritt einige „linke“ Positionen, aber nicht nur. Und sie bewegt sich dabei stets im Rahmen des rechtswissenschaftlichen Diskurses.
Brosius-Gersdorf hat etwa in der Coronapandemie Gründe aufgeführt, die für eine Impfpflicht sprechen und argumentiert für eine Abschaffung des Ehegattensplittings. Sie ist der Auffassung, ein Verbot der AfD komme infrage, sofern es genug Anhaltspunkte für den Nachweis ihrer Verfassungsfeindlichkeit gibt. Sie hat nichts gegen kopftuchtragende Richterinnen einzuwenden und meint, das Aufhängen von Kruzifixen in Klassenzimmern verstoße gegen das Neutralitätsgebot. Sie hält es „für nicht geboten“, Schüler aus religiösen Gründen vom Schwimmunterricht zu befreien – und es spricht aus ihrer Sicht viel dafür, die Rente mit 67 anzuheben.
Über all das lässt sich diskutieren, muss man streiten – so wie Brosius-Gersdorf es tut. Allein in der Union richten manche lieber auf der Basis dürrer Kenntnisse – und brechen den Stab über eine Juristin, die sie kaum kennen. Vor allem wegen eines Satzes: „Es gibt gute Gründe dafür, dass die Menschenwürdegarantie erst ab Geburt gilt.“
Dabei gibt Brosius-Gersdorf schon mit diesem Satz zu erkennen, dass sie auch andere Gründe anerkennt – gute Gründe, die der katholische Philosoph Robert Spaemann (1927 - 2018) in unzähligen Debattenbeiträgen einschlägig vorgebracht hat – und die man stark verkürzt vielleicht so zusammenfassen kann:
Weil wir die Würde eines Menschen nicht von seiner Fähigkeit zur Selbstbestimmung, auch nicht von ihrer wechselseitigen Anerkennung abhängig machen, sie also stattdessen etwa auch Babys, Dementen und Komapatienten zusprechen, sei auch ein Embryo, so Spaemann, also das, was sich von Menschen gezeugt auf eine erwachsene Menschengestalt hin entwickelt, von Anfang an als „jemand“ zu betrachten – und nicht als „etwas“.
Andernfalls, so Spaemann speziell mit Blick auf Euthanasie, Stammzellforschung und Reproduktionsmedizin, gerate man leicht auf eine gedankliche Rutschbahn: weg von der (absoluten) „Heiligkeit des Lebens“ zu Vorstellungen seiner (relativen) Nützlichkeit.
Und Brosius-Gersdorf? Sie sagt es so: „Bei einer Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs hat der Gesetzgeber Schutzpflichten für das Grundrecht auf Leben des Embryos…“ Und sie plädiert außerdem, in sorgfältiger Abwägung der Persönlichkeitsrechte der Mutter, für den Schutz des ungeborenen Lebens. Das ist ganz unphilosophisch. Und mit Sicherheit ganz unkatholisch. Aber unbedingt redlich und diskutabel: Wo, bitte schön, liegt das Problem?
Mehr noch: Was Brosius-Gersdorf hier auszeichnet – die Fähigkeit, Argumente zu wägen, sich selbst ins Wort zu fallen, den anderen Standpunkt mitzubedenken – das ist genau das, woran es denjenigen mangelt, die ihre Fallbeilurteile über sie fällen. Und das ist genau das, zweiter Punkt, was auch die Senate des Bundesverfassungsgerichts (idealerweise) auszeichnet:
Je acht ausgezeichnete Juristen aus der linken bis rechten Mitte prüfen komplexe Sachverhalte verfassungsrechtlich – und lassen in kontroversen Diskussionen „nach den Buchstaben des Gesetzes“ ihre politischen Voreinstellungen schon allein deshalb nicht ins Kraut schießen, um vor den anderen sieben nicht parteilich, einseitig, blind, also blamiert dazustehen.
Dass sie dabei die Verfassung nicht immer auf der Höhe der Zeit interpretiert haben, hängt übrigens nicht nur mit dem gehobenen Altersdurchschnitt der Richterinnen und Richter zusammen: Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe haben das Recht schon allein deshalb grundsätzlich „konservativ“ auszulegen, weil Änderungen des Verfassungstextes, aber auch neue Auslegungen, besonders begründungspflichtig sind.
Allerdings ist gerade mit Blick auf den Paragraphen 218 (und die Ablehnung der Fristenlösung vor genau 50 Jahren) auch festzuhalten, dass es überwiegend richtenden Männern in Karlsruhe allzu lange leicht gemacht wurde, die Rechte überwiegend abwesender Frauen in ihren Runden nicht ausreichend in ihre Überlegungen einzubeziehen.
Abgesehen davon, waren und sind sich die Richter und Richterinnen in Karlsruhe in ihren Diskussionen allein darin einig, die Verfassung (und die Verfassungsinstitution, die sie repräsentieren) vor ihrer Politisierung (geschweige denn Instrumentalisierung) zu schützen.
Und die Hochachtung vor der sachlich-fachlichen „Neutralität“ und Ausgewogenheit der Senate erstreckte sich bisher sogar insofern auf die Politiker der Parteien, die die Richter ins Rennen schickten, als jene schon bei der Auswahl etwaige Einwände der politischen Konkurrenz immer mitbedachten – weshalb Vertreterinnen und Vertreter einseitiger (extremer) Positionen es generell schwer hatten und haben, ins Bundesverfassungsgericht einzuziehen.
Man kann daher darüber diskutieren, ob die SPD vielleicht besser eine andere, weniger (politisch) prononcierte Kandidatin ins Rennen geschickt hätte. Aber natürlich vor der Nominierung durch den Wahlausschuss – und nicht auf den letzten Metern in diffamierender Absicht.
Und klar: Brosius-Gersdorfs „politische“ Verteidiger müssen sich schon fragen lassen, welche Empörungswellen durch ihre Kreise und Netzwerke schwappten, nominierte der Wahlausschuss einen Rechtsgelehrten, der sich für vorübergehende Grenzschließungen und eine Änderung des Asylrechts eingesetzt hat – und in etwa auf dem Niveau von Robert Spaemann die Argumente pro Lebensschutz am langen Ende für stichhaltiger hält als die Rechte der Frau.
Aber noch einmal: Das entscheidende Kriterium ist nicht „rechts“ oder „links“, sondern: argumentationsoffen. Es geht um Reflexionsfähigkeit im Rahmen des rechtswissenschaftlichen Diskurses. Wiese man Brosius-Gersdorf exakt die Eiferei und Kulturkämpferei nach, derer sie nach Lage der Dinge grundlos bezichtigt wird: Sie wäre die Falsche.
Wohlgemerkt also, dritter Punkt: Die Wahl neuer Verfassungsrichter und Verfassungsrichterinnen ist nicht unpolitisch. Und Diskussionen über Personalien gab es auch früher. Aber die Union hat mit der Denunziation Brosius-Gersdorfs die Grenze zur Politisierung Karlsruhes eindeutig überschritten. Sie hat sich der Jagd rechtsaktivistischer Publizisten auf eine Kandidatin der politischen Mitte angeschlossen, diese Jagd auf die Spitze getrieben – und den Verfassungsfeinden in der AfD ohne Not den Gefallen getan, das Verfassungsgericht als Spielball parteipolitischer Sonderinteressen erscheinen zu lassen.
Anders ausgedrückt: Die Friedrich-Merz-Union hat die Zentripetalkraft unserer Demokratie in Karlsruhe geschwächt und ihre Zentrifugalkraft in Berlin einmal mehr verstärkt. Wenn man nicht wüsste, dass es auch noch die, sagen wir: Hendrik-Wüst-CDU gibt – man hielte das Anständig-Konservative in diesem Land beinah’ schon für verloren.
https://www.wiwo.de/
Brief an die Medien
„Realitätsfern“: Brosius-Gersdorf wehrt sich gegen Vorwürfe
15.07.2025, 08:05 Uhr • Lesezeit: 2 Minuten
Frauke Brosius-Gersdorf
Die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf.
© Britta Pedersen/dpa | Britta Pedersen
Berlin. Die Wahl neuer Verfassungsrichter endete für Schwarz-Rot im Eklat. Nun meldet sich Frauke Brosius-Gersdorf – und stellt einiges klar.
Frauke Brosius-Gersdorf geht entschieden gegen die Art der Berichterstattung über sie im Zusammenhang mit der Wahl für das Bundesverfassungsgericht vor. Die Juristin betont in einem Brief, dass die Darstellungen in einigen Medien „unzutreffend und unvollständig, unsachlich und intransparent“ gewesen seien.
Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
In ihrer Erklärung wehrt sich Brosius-Gersdorf dagegen, als „ultralinks“ oder „linksradikal“ bezeichnet zu werden. Das sei „diffamierend und realitätsfern“. Die Mitteilung liegt dem ZDF und dem Deutschlandfunk vor.
- Interview: Merz zum Richter-Streit: „Das ist nichts, was uns umwirft“
- Engpass: Bundeswehr-Einkäuferin: „Solche Extras werden gestrichen“
- Bundespräsident: Streit um Richterwahl – Steinmeier sieht Koalition „beschädigt“
- Generaldebatte im Bundestag: Weidel reizt den Stier im Kanzler
- Pullover-Posse: Klöckner lässt Nietzard weiter in den Bundestag
So sei etwa die Behauptung verunglimpfend, sie habe sich für eine Legalisierung und eine Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs bis zur Geburt ausgesprochen. Auch ihre Positionen zu einem Kopftuchverbot und zu Paritätsmodellen für die Wahl des Bundestags seien häufig falsch dargestellt worden, betont Brosius-Gersdorf laut Deutschlandfunk in dem Schreiben. Eine eingehende Befassung mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit zeige vielmehr, dass ihre Positionen im Ganzen betrachtet der demokratischen Mitte zuzuordnen seien.
Brosius-Gersdorf: Rückendeckung von rund 300 Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftlern
Bereits am Montag stärkten rund 300 Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler Brosius-Gersdorf den Rücken und kritisierten in einem offenen Brief, über den das Rechtsmagazin „Legal Tribune Online“ zuerst berichtete, den Umgang mit ihr. An der fachlichen Qualifikation der Kandidatin gebe es keine Zweifel, erklärten die Juristen. Sie sprachen von „fehlendem politischem Rückgrat und mangelnder interner Vorbereitung“. Brosius-Gersdorf sei von den verantwortlichen Personen und Institutionen nicht vor Herabwürdigung geschützt worden, der Vorfall könne auch das Bundesverfassungsgericht beschädigen.
Am Freitag waren die Wahlen zweier neuer Richterinnen und eines Richters für Karlsruhe kurzfristig von der Tagesordnung des Bundestags abgesetzt worden. Der Druck gegen Frauke Brosius-Gersdorf war in der Union zu groß geworden. Die Fraktionsführung konnte die mit dem Koalitionspartner verabredete Unterstützung nicht mehr garantieren.
Auch interessant
Bundestag
Krach in der Koalition
Merz und die Richterwahl: Drei Szenarien sind jetzt denkbar
Von Christian Unger
Währenddessen verlangen die Grünen von der schwarz-roten Koalition, eine Sondersitzung zur Wahl der drei Verfassungsrichter noch in dieser Woche zu ermöglichen. Die Fraktionschefinnen Katharina Dröge und Britta Haßelmann forderten ihre Amtskollegen Jens Spahn von der Union und Matthias Miersch von der SPD in einem Brief auf, „die Durchführung einer Sondersitzung des Deutschen Bundestages für diese Woche zu beantragen mit dem Ziel, die Wahl der drei vom Richterwahlausschuss nominierten Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht vorzunehmen“. Das Schreiben liegt der dpa vor.
dpa/dw
https://www.morgenpost.de/
Schimmele: "Es gab das Ziel, Brosius-Gersdorf zu verhindern"
NDR Kultur
Das Journal von NDR Kultur · 15.07.2025 · 8 Min.
Prof. Frauke Brosius-Gersdorf gestikuliert; Foto vom 25. Juli 2024 in "Markus Lanz" (Aufzeichnung vom 16. Juli 2024)
Erscheinungsdatum
15.07.2025
Das Journal von NDR Kultur
Frauke Brosius-Gersdorf sollte eine der neuen Verfassungsrichterinnen werden. Doch die Wahl wurde abgesagt - wegen Vorbehalten aus der Union? Es war eine Kampagne, sagt Politik-Analystin Hannah Schimmele.
Viele der Vorbehalte gegenüber Brosius-Gersdorf sind nicht nur sachlich unbegründet. Vielmehr drängt sich der Verdacht auf, dass in einer Kampagne von bestimmten Medien und Plattformen Gerüchte und falsche Vorwürfe lanciert worden sind. Eine Gruppe von Berliner Politik-Analysten namens "Polisphere" hat sich die Kampagne genauer angeschaut und recherchiert, wer sie vor allem verbreitet hat, sodass manche Bundestagsabgeordnete Zweifel an der Person bekamen. Hannah Schimmele war an dieser Analyse beteiligt.
Podcast-Teaserbild Das Journal von NDR Kultur
Diese Episode ist Teil von:
Das Journal von NDR Kultur
NDR Kultur
Alle Episoden des Podcasts
https://www.ardaudiothek.de/
Bundesverfassungsgericht
Richter-Kandidatin wehrt sich: Bin nicht ultralinks
15.07.2025, 15:47 Uhr
Juristin Brosius-Gersdorf will einiges klarstellen.
Copyright: Britta Pedersen/dpa
Vergangene Woche scheiterte die Wahl neuer Verfassungsrichter im Bundestag. Zu viele in der Union halten die SPD-Kandidatin für unwählbar. Diese stellt nun einiges klar. Doch hilft das weiter?
Ist sie eine Linksradikale und deshalb unwählbar als Richterin am Bundesverfassungsgericht? Die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf meldet sich erstmals seit der geplatzten Wahl im Bundestag selbst zu Wort - und weist öffentliche Vorwürfe deutlich zurück. „Die Bezeichnung meiner Person als „ultralinks“ oder „linksradikal“ ist diffamierend und realitätsfern“, schreibt die Juristin in einer Stellungnahme, die sie über eine Anwaltskanzlei veröffentlichte.
Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuerst hatten ZDF und Deutschlandfunk darüber berichtet. Darin wirft Brosius-Gersdorf auch Teilen der Medien vor, ihre Berichterstattung sei „unzutreffend und unvollständig, unsachlich und intransparent“ gewesen. „Sie war nicht sachorientiert, sondern von dem Ziel geleitet, die Wahl zu verhindern.“ Kritik müssten sich auch „einzelne staatliche Funktionsträger gefallen lassen“.
Merz bleibt dabei: Richterwahl in Ruhe besprechen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) machte deutlich, dass er auch nach der Stellungnahme an seinem Kurs festhalten will, das weitere Vorgehen in den kommenden Wochen zu besprechen. „Dazu habe ich am Wochenende alles Notwendige gesagt“, sagte er nach dem Besuch einer bayerischen Kabinettssitzung auf der Zugspitze. „Wir sprechen in der Koalition in Ruhe darüber, wie wir das lösen.“ CSU-Chef Markus Söder sagte auf Nachfrage zu der Stellungnahme: „Unsere Einschätzung ist die gleiche.“
Eigentlich sollte Brosius-Gersdorf am vergangenen Freitag im Bundestag zusammen mit einer weiteren Richterin und einem Richter für Karlsruhe gewählt werden. Doch die Wahl wurde kurzfristig von der Tagesordnung genommen, weil die Führung der Unionsfraktion die mit der SPD verabredete Unterstützung für die Jura-Professorin nicht mehr garantieren konnte.
Mehrere Unionsabgeordnete bezeichneten Brosius-Gersdorf öffentlich als ungeeignet und unwählbar, andere ließen sich anonym zitieren, die Juraprofessorin sei „eine ultralinke Juristin“. Begründet wurde das unter anderem mit Äußerungen von Brosius-Gersdorf zu Corona-Impfungen und mit ihrer Haltung zu Abtreibungen.
Fraktionschef Jens Spahn räumte in dieser Woche in einem Schreiben an die Fraktion ein: „Die Dimension der grundlegenden und inhaltlich fundierten Bedenken gegen eine der Kandidatinnen haben wir unterschätzt.“ Und: „Die Notbremse am Freitag kam zu spät.“ Man sei nicht mehr in der Lage gewesen, einen Kompromiss mit der SPD zu finden.
Was Brosius-Gersdorf selbst dazu sagt
Die Juristin äußert sich in ihrer schriftlichen Stellungnahme ausführlich zu den Vorwürfen. „Ordnet man meine wissenschaftlichen Positionen in ihrer Breite politisch zu, zeigt sich ein Bild der demokratischen Mitte“, betont sie etwa. Einseitige Zuschreibungen wie „ultralinks“ und „linksradikal“ entbehrten der Tatsachen. „Sie beruhen auf einer punktuellen und unvollständigen Auswahl einzelner Themen und Thesen, zu denen einzelne Sätze aus dem Zusammenhang gerissen werden, um ein Zerrbild zu zeichnen.“
So sei die Behauptung falsch, sie sei für eine Legalisierung und eine Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs bis zur Geburt. Sie habe lediglich auf die Tatsache hingewiesen, dass nach aktueller Rechtslage auch ein Abbruch aus medizinischen Gründen - etwa bei Gefahr für Leben und Gesundheit der Frau - unzulässig sei. „Der Vorwurf, ich würde für einen Schwangerschaftsabbruch bis zur Geburt eintreten und sei „lebenskritisch“, ist falsch und entbehrt jeder Grundlage“, betont Brosius-Gersdorf.
Auch ihre Positionen zu einem Kopftuchverbot und zu Paritätsmodellen für die Wahl des Bundestags seien unzutreffend wiedergegeben worden, erklärte die Juristin.
Wie es weitergeht
Die Lage scheint festgefahren. Dass Brosius-Gersdorf ihre Kandidatur zurückzieht - wie manche in der Union sich wünschen - scheint unwahrscheinlich. Die SPD hält auch an ihr fest und sieht sich bestärkt. „Frau Professor Brosius-Gersdorf bestätigt mit ihrer Erklärung genau das, was wir seit Tagen sagen: Die ihr vorgeworfenen Äußerungen waren falsch, verkürzt dargestellt oder unzutreffend“, sagte Fraktionsvize Sonja Eichwede der Deutschen Presse-Agentur. Sie rief die Union erneut auf, das Gespräch mit Brosius-Gersdorf zu suchen.
Dazu haben sich CDU und CSU noch nicht geäußert. Die Union betont, es gebe keinen Zeitdruck für eine Lösung - macht aber auch nicht den Eindruck, ihre inhaltliche Haltung zu ändern. Ein gemeinsames, mehrheitsfähiges Kandidaten-Paket gelinge nur mit weniger gegenseitigen Vorwürfen und mehr Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht, den Kandidaten und der Entscheidung der Abgeordneten, sagte stattdessen CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur. Am späten Nachmittag will der Vorstand der Unionsfraktion das weitere Vorgehen beraten.
Wann eine neue Richterwahl angesetzt werden könnte
Bisher deutet alles darauf hin, dass man zunächst in die parlamentarische Sommerpause geht und eine neue Richterwahl im Bundestag frühestens im September anpeilt. Den Grünen ist das viel zu spät: Sie fordern eine Sondersitzung des Bundestags noch in dieser Woche. „Wir halten es für unverantwortlich, diese wichtige Entscheidung des Bundestags über Wochen offenzulassen“, mahnen die Fraktionschefinnen Katharina Dröge und Britta Haßelmann in einem Brief an ihre Amtskollegen Jens Spahn von der Union und Matthias Miersch von der SPD.
Linken-Chefin Ines Schwerdtner dagegen lehnt eine Sondersitzung zum jetzigen Zeitpunkt an. Sie sei sehr pessimistisch, dass es in einer „überstürzten Sitzung“ eine Einigung geben könne, sagte Schwerdtner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Stattdessen müsse die Union die Sommerferien nutzen, um Mehrheiten zu finden. „Die Verantwortung dafür liegt klar bei der CDU“, betonte sie. (dpa)
https://www.ksta.de/
Kulturkampf bei der Richterwahl: Das ist eine Schmutzkampagne wie aus dem Handbuch
Katharina Riehl
Meinung
Frauke Brosius-Gersdorf
Kommentar
15.07.2025, 12:06 Uhr
'Eine demokratische Pflichtübung geriet zur Koalitionskrise: Bundeskanzler Friedrich Merz (links) und der Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn (beide CDU).
(Foto: Annette Riedl/Annette Riedl/dpa)
Wir gegen sie, sie gegen uns: Die geplatzte Wahl der SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht zeigt, wie die Ideologisierung auch die Parteien der Mitte erfasst. Was sie dagegen tun müssten...
Anhand der vorerst gescheiterten Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin lassen sich gleich mehrere Geschichten erzählen: Da wäre die eines Unionsfraktionsvorsitzenden, der seine Fraktion entweder nicht versteht oder nicht führen kann. Oder die einer Koalition, die so gerne geräuschlos regieren wollte und nun nach der im ersten Anlauf gescheiterten Kanzlerwahl schon zum zweiten Mal ihrem eigenen Anspruch auf Geschlossenheit nicht gerecht wurde. Doch das auf offener Bühne ausgetragene Drama um eine demokratische Pflichtübung, die zur demokratischen Peinlichkeit wurde, ist noch etwas anderes: ein Lehrstück über den modernen Kulturkampf. Wir gegen die, die gegen uns...
https://www.sueddeutsche.de
Analyse zur Kampagne gegen Frauke Brosius-Gersdorf
14.07.2025
Gemeinsam mit zwei weiteren Kandidaten sollte die Potsdamer Juraprofessorin Dr. Frauke Brosius-Gersdorf am Freitag, den 11. Juli, vom Bundestag zur Verfassungsrichterin gewählt werden. Aufgrund fehlender Stimmen aus der Unionsfraktion wurde die Wahl der von der SPD vorgeschlagenen Brosius-Gersdorf jedoch abgesagt und von der Tagesordnung genommen. Dem vorausgegangen waren massive Diffamierungen und Vorwürfe bezüglich ihrer Kandidatur und politischen Positionierungen, zuletzt ergänzt um vermeintliche Plagiatsvorwürfe.
Hannah Schimmele und Richard Schwenn aus dem polisphere Social Media Monitoring haben sich die mediale Kampagne und mehr als 40.000 X-Posts dazu angeschaut. Die zentralen Erkenntnisse:
Entwicklung der Kampagne (Auswahl reichweitenstarker Multiplikatoren):
- 1. Juli: Apollo News (am gleichen Tag von Julian Reichelt auf X aufgegriffen)
- 2. Juli: NIUS
- 2. Juli: Tichys Einblick
- 2. Juli: Junge Freiheit
- 3. Juli: AUF1
- 4. Juli: Compact Magazin
Dabei fokussierten sich Kritik und Diffamierungen auf die folgenden Themen, bzw. angeblich “extremen Positionen” von Brosius-Gersdorf:
- Abtreibung
- Impflicht
- AfD-Verbot
- Gendern
- Kopftuch
- Plagiatsvorwurf
LinkedIn - Brosius-Gersdorf
Der Fokus lag zuerst vor allem auf dem AfD-Verbot, erst später wurde Abtreibung präsenter, nachdem klar wurde, dass hier mehr Mobilisierungspotential (auch innerhalb der Unionsfraktion) herrscht. Die haltlosen Plagiatsvorwürfe kamen in den letzten 24 Stunden in erheblicher Fallzahl dazu.
Vor allem NIUS war sehr aktiv: Mehr als 20 Artikel wurden in nur zehn Tagen seit dem 2. Juli veröffentlicht. In den letzten Tagen vor der Wahl wurde die Debatte dann auch zunehmend von Qualitätsmedien aufgenommen.
Weitere Erkenntnisse:
- “Alternative Medien” sind plattformübergreifend präsent
- X sticht als Diskursarena besonders heraus (“Wie wichtig X ist, sieht man auch am heutigen Tag!” Joana Cotar)
- Aufrufe aus der AfD, dass User ihre CDU-Abgeordneten in Kommentaren markieren und zur Nicht-Wahl auffordern sollen (“Ich brauche deine Hilfe!”)
- CitizenGo-Petition gegen Brosius-Gersdorf mit großer Reichweite
- Inhalte wurden teilweise als Werbung geschaltet
- Viel KI-”News”-Content auf TikTok
- Suchvorschläge wie “Abtreibung bis 9 Monat” (falscher Vorwurf) wurden bei Suche nach “Abtreibung” von TikTok oben angezeigt
Für Presseanfragen steht Philipp Sälhoff via philipp.saelhoff@polisphere.eu zur Verfügung.
Aktuelle Entwicklungen im Bereich Desinformation bereiten wir auch jede Woche in unserem thematischen Fachbriefing auf. Zur Anmeldung: https://mailchi.mp/polisphere/briefing-desinformation
https://www.polisphere.eu/de/analyse-zur-kampagne-gegen-frauke-brosius-gersdorf/
Streit um Richterwahl schlägt auch auf Landespolitik durch
Stand: 14.07.2025 Lesedauer: 2 Minuten
Die Verschiebung der Wahl neuer Verfassungsrichter sorgt für kontroverse Diskussionen. (Archivbild)
Quelle: Uli Deck/dpa
Nach der geplatzten Wahl neuer Verfassungsrichter bleibt unklar, mit welcher Lösung Union und SPD aus ihrem Streit herauskommen wollen. Die Auseinandersetzung hallt auch in Ländern wie MV nach.
Der Koalitionsstreit um die Wahl neuer Verfassungsrichter durch den Bundestag strahlt bis nach Mecklenburg-Vorpommern aus. «Schon das Verhalten der CDU im Bundestag bei der Wahl der Verfassungsrichter war ein Tiefpunkt», erklärte der Generalsekretär der Landes-SPD, Julian Barlen, in Schwerin. Dass sich nun auch CDU-Landeschef Daniel Peters ausgerechnet an rechte Medien wende, «um sich dort als Hardliner zu inszenieren, ist schlicht schäbig». Wer so agiere, spiele der AfD direkt in die Hände und mache sich zu deren nützlichem Werkzeug.
CDU-Landeschef Peters hatte die Eignung der von der SPD nominierten Potsdamer Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf für das Amt am Verfassungsgericht in Zweifel gezogen. Trotz ihrer fachlichen Kompetenz sei sie in der Vergangenheit immer wieder durch Positionen «einer linken Aktivistin» aufgefallen, sagte er dem Portal «Nius». Die SPD solle sich die Kritik zu Herzen nehmen und ihren Personalvorschlag dringend überdenken.
«Am besten wäre es, man geht auf die Suche nach einer neuen Kandidatin oder einem neuen Kandidaten», sagte Peters. Am Montag verwies er in Schwerin zudem auf die Bedenken aus Kirchenkreisen gegen Brosius-Gersdorf wegen deren liberaler Haltung zur Abtreibung. Auch CSU-Chef Markus Söder legte der SPD einen Austausch der umstrittenen Kandidatin Brosius-Gersdorf nahe.
Barlen rief die Union dazu auf, ihrer politischen Verantwortung gerecht zu werden und zu einem respektvollen demokratischen Umgang miteinander zurückzukehren. «Wer das Bundesverfassungsgericht parteipolitisch instrumentalisiert, rüttelt am Fundament unseres Rechtsstaats. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht Lösungen – nicht populistische Kampagnen», mahnte Barlen.
dpa-infocom GmbH
https://www.welt.de/
Politologe sieht AfD als „Gewinner“ der Debatte um Richterwahl
DTS Nachrichtenagentur
14.07.2025
Nach der kurzfristigen Absage der Verfassungsrichter-Wahl im Bundestag sieht der Politologe Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel die AfD als Profiteur der Debatte. „Gewinner ist vor allem die AfD“, sagte Schroeder den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben). „Sie kann einerseits demonstrieren, wie sich die Union entlang der Auseinandersetzung mit der SPD spaltet. Andererseits kann sie zeigen, wie stark sie Debatten beeinflussen kann – ohne selbst an der Macht zu sein.“
Politologe Sieht Afd Als &Quot;Gewinner&Quot; Der Debatte Um Richterwahl
Alice Weidel und Tino Chrupalla am 09.07.2025, via dts Nachrichtenagentur
Mit Blick auf die Diskussion über Unionsfraktionschef Jens Spahn sagte Schroeder: „Es braucht in der Union jetzt Personen an der Spitze, die Ruhe und Verlässlichkeit in Partei und Fraktion tragen.“ Dann müsse man eine Debatte zur Richterwahl nicht überbewerten, es könne eine Pause geben, ein gemeinsames Zusammensetzen mit den Kandidierenden und auch der SPD, so der Politologe.
„Und dann kann das entschieden werden. Aber es braucht Politiker, die ausreichend Autorität haben, diesen Prozess ruhig einzuleiten.“ Man erlebe gegenwärtig kein Problem mit der Stabilität der Institutionen. Es sei ein Problem der Qualität der Politiker, was sowohl die geistige Führung wie auch Handwerk des Regierens betreffe.
Am Freitag hatte die letzte Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause im Streit geendet. Die Wahlen von Brosius-Gersdorf und zweier weiterer neuer Richter für Karlsruhe waren kurzfristig von der Tagesordnung abgesetzt worden, weil der Druck gegen die Potsdamer Staatsrechtlerin in der Union zu groß geworden war und die Fraktionsführung die mit dem Koalitionspartner verabredete Unterstützung nicht mehr garantieren konnte.
https://presse-augsburg.de/
Rechte Hetze gegen Brosius-Gersdorf
Der lange vorbereitete Feldzug der FundamentalistInnen
Eine massive Kampagne von christlichen FundamentalistInnen hat die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf vorerst verhindert. Wer genau steckt dahinter?
14.07.2025
Beatrix von Storch auf einer Anti-Abtreibungs-Demo in Berlin, 2019 Wo gegen das Recht auf Selbstbestimmung mobilgemacht wird, ist die AfD nicht weit: Beatrix von Storch in Berlin, 2019
Foto: Christian Mang
Patricia Hecht
Berlin taz | Die Aufrufe aus der Anti-Choice-Szene an Politiker*innen und Journalist*innen klingen dramatisch und teils wortgleich. „Sie werden es nicht für möglich halten“, schreibt etwa die „Aktion SOS Leben“ Anfang Juli per Mail über die Nominierung der Juraprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin: Eine „Ultra-Linke und Abtreibungsaktivistin“ sei als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht vorgesehen. Die SPD sei dabei, „einen links-grünen Putsch durchzuführen und aus dem Bundesverfassungsgericht eine Zelle linker Agitation zu machen“.
Die Wahl von Brosius-Gersdorf wäre „katastrophal“, heißt es auch in einem Brief der Aktion Lebensrecht für alle (ALfA) an Abgeordnete des Bundestags. Brosius-Gersdorf, die Mitglied der Expert*innenkommission für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen war, deute „ganz bewusst“ die Verfassung um, um ideologische Ziele zu verwirklichen. So solle manchen Menschen – Föten – Grundrechte abgesprochen werden. Ohne Kinder aber habe ein „Staat keine Zukunft“.
Die Organisation 1000plus schreibt auf ihrer Website: „Das Unfassbare“ sei eingetreten: Brosius-Gersdorf sei nominiert, obwohl sie sich „klar und deutlich“ für die Legalisierung von Abtreibung ausgesprochen habe. Und die internationale Kampagnenorganisation CitizenGo schreibt, die SPD versuche, eine „radikale linke Lebensfeindin“ ins Bundesverfassungsgericht zu bringen.
Die SPD sei dabei, aus dem Verfassungsgericht eine Zelle linker Agitation zu machen
Aktion SOS Leben
Das wollen die Vereine und Organisationen, die sich gegen Schwangerschaftsabbrüche einsetzen, allerdings nicht hinnehmen – und liefern die Instrumente, Brosius-Gersdorf zu verhindern, gleich mit. Grün hinterlegt ist etwa auf der Seite von 1000plus ein Banner, auf dem steht: „Schreiben Sie dem Unions-Abgeordneten Ihres Wahlkreises“.
Druck auf Abgeordnete
Die Aktion SOS Leben lädt zum Klick auf eine Petition namens „Nein zu Abtreibungsaktivisten im Bundesverfassungsgericht – Nein zu Brosius-Gersdorf!“. Auf der Seite von CitizenGo heißt es: „Keine radikale Lebensfeindin ins Bundesverfassungsgericht: Stimmen Sie gegen Frauke Brosius-Gersdorf!“. Und die ALfA richtet sich per Brief förmlich und direkt an die Abgeordneten des Bundestags: „Ich bitte Sie daher dringend, Frau Brosius-Gersdorf nicht Ihre Stimme zu geben.“
Die Stimmung, die die Vereine und Organisationen aus der Anti-Choice-Szene gegen Brosius-Gersdorf gemacht haben, zeigte bekanntermaßen Wirkung – flankiert noch durch Hetze etwa der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch. Die behauptete bei der Generaldebatte im Bundestag vergangene Woche, Brosius-Gersdorf spreche einem neun Monate alten Fötus keine Menschenwürde zu. Auf „Nius“, dem rechten Portal des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt, sind seit Anfang Juli mehr als 20 Texte erschienen, die gegen die „Richterin des Grauens“ mobilmachten.
Bei Redaktionsschluss stand die Petition auf CitizenGo bei 146.000 Unterschriften. 37.000 E-Mails, so die Organisation 1000plus, seien an Unionsabgeordnete versandt worden. „Sie haben es geschafft!“, jubelt deshalb der Vorsitzende Kristijan Aufiero, nachdem die Wahl der RichterInnen am Freitag abgesagt wurde, obwohl sich die Koalition zuvor darauf verständigt hatte: Die Unionsfraktion habe angekündigt, Brosius-Gersdorf nicht zu wählen.
Aufiero, das am Rande, war im Februar als Sachverständiger für die AfD bei einer Anhörung im Rechtsausschuss zu Schwangerschaftsabbrüchen geladen. Und auf CitizenGo heißt es: Dass die Wahl von Brosius-Gersdorf verhindert worden sei, sei „ein großer Sieg für den Lebensschutz für die nächsten zwölf Jahre“.
Die konzertierte Kampagne gegen Brosius-Gersdorf ist kein Zufall. Ultrakonservative ChristInnen, die mit der autoritären und extremen Rechten gemeinsame Sache machen, arbeiten seit Jahren an einem Rollback von Frauenrechten und Rechten von LGBTIQ in Europa.
Finanzstarkes Netzwerk
Erst Ende Juni hatte ein progressiver Thinktank, das Europäische Parlamentarische Forum für sexuelle und reproduktive Rechte (EPF), einen Bericht namens „Die nächste Welle“ vorgelegt. Darin beschreibt EPF-Geschäftsführer Neil Datta ein weit verzweigtes Netzwerk, dem unter anderem AktivistInnen der sogenannten Lebensschutzszene, religiöse ExtremistInnen, extrem rechte PopulistInnen und AristokratInnen angehören, teils enorm finanzkräftig.
Zwischen 2019 und 2023, so der EPF-Bericht, wurden von 275 Organisationen Mittel in Höhe von fast 1,2 Milliarden Dollar aufgebracht, die in Europa an Anti-Gender-Initiativen beteiligt waren – also solchen, die gegen Schwangerschaftsabbrüche und Rechte von LGBTIQ sowie gegen Geschlechtergleichheit mobilmachen. Den AktivistInnen, so das EPF, gehe es darum, „Jahrzehnte von hart erkämpften sexuellen und reproduktiven Rechten in ganz Europa zu demontieren“.
Eine Organisation, deren Name dabei immer wieder fällt, ist CitizenGo – eine derjenigen also, die auch gegen Brosius-Gersdorf mobilmachen.
CitizenGo ist nicht irgendeine Plattform. Schon 2013 schreibt der spanische Anti-Abtreibungs-Aktivist Ignacio Arsuaga, Gründer von CitizenGo: Die Plattform solle „die einflussreichste internationale christlich inspirierte Mobilisierungswebsite“ werden. Eine, die „nationale Regierungen, Parlamente und internationale Institutionen effektiv beeinflusst“. Über die Dokumente, in denen Arsuaga das schrieb, zudem über Adresslisten, Finanzberichte und Strategiepapiere von CitizenGo berichtete die taz bereits 2021, sie liegen ihr vor.
Das Gute und das Böse
Rechtlich ist CitizenGo eine in Spanien eingetragene Stiftung. Sie setzt sich ein für „Leben, Familie und Freiheit“, so steht es auf der Website. Intern ist die Darstellung martialischer: Die Organisation sieht sich in einem Kulturkampf, zwischen der Kultur des Lebens und der des Todes, Gut gegen Böse. Das Böse sind für CitizenGo unter anderem Menschen, die sich für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche einsetzen – das Gute sind die „wahren“ ChristInnen, die den Kampagnen der globalen Linken etwas entgegensetzen. Deshalb will CitizenGo „eine Generation von konservativen Führern“ aufbauen, national und international.
Der Aktivismus von CitizenGo hat sich seit 2013 deutlich professionalisiert. Dabei nutzt die Organisation Daten von FundamentalistInnen und LGBTIQ-GegenerInnen als Währung, knüpft Kontakte zu rechtsextremen Parteien und nimmt immer mehr Einfluss – unter anderem auf das Europäische Parlament. Dort erinnert eine Aktion von CitizenGo schon Ende 2013 frappierend an die konzertierte Kampagne gegen Brosius-Gersdorf im Juli 2025.
2019 hatte er als Gesundheitsminister eine Studie in Auftrag gegeben, die zunächst die seelischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen untersuchen sollte.
Damals sollte nicht das deutsche, sondern das Europäische Parlament abstimmen, nicht über eine Richterin, sondern über ein Papier: eines, in dem sich das EU-Parlament dazu bekennt, dass allen Europäer*innen der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und Sexualaufklärung zusteht. Dreimal steht das Papier zur Entscheidung, dreimal wird es abgelehnt – eine herbe Niederlage für viele Sozialdemokrat*innen, Linke und Liberale im EU-Parlament.
Die Strategie, mit der CitizenGo damals vorging, hat sich bewährt: Christlich-fundamentalistische und rechte AktivistInnen fluten die Post- und E-Mail-Eingänge von Abgeordneten mit Mails und Petitionen, innerhalb kürzester Zeit sammeln sie Unterschriften. Bis 2013 ist eine solche Mobilisierung für die europäische Rechte beispiellos. Heute übernehmen die Strategie von CitizenGo längst Vereine und Organisationen wie ALfA, 1000plus und Aktion SOS Leben.
Jens Spahn: Mittendrin statt nur dabei
Das Thema Geschlechterpolitik funktioniert dabei als Scharnier. Es ist zum einen anschlussfähig an die gesellschaftliche Mitte, zum anderen Kernthema der Rechten. Rechte Politik ist ohne die Kontrolle weiblicher Körper nicht denkbar, schließlich geht es dabei auch um Reproduktion von Bevölkerung, um eine „Willkommenskultur für Kinder“, wie etwa die AfD in ihrem Wahlprogramm schreibt – deutsche Kinder, versteht sich.
Dabei erinnert der Kampf um die Besetzung von RichterInnenposten an die USA, wo US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit ultrakonservative RichterInnen für den Obersten Gerichtshof ernannte. Dieser kippte in der Folge 2022 in einem Grundsatzurteil das Recht auf Schwangerschaftsabbruch im Land. Auch hierzulande, so der Soziologe und Antifeminismus-Experte Andreas Kemper, versuche die Bewegung, die eigenen Ziele über konservative und rechte RichterInnen zu flankieren – und liberale RichterInnen zu verhindern.
Fraktionschef Jens Spahn musste in den vergangenen Tagen viel Kritik dafür einstecken, die Stimmung in der Fraktion entweder falsch eingeschätzt oder seine Fraktion nicht im Griff zu haben, vielleicht auch beides. Interessant dabei ist allerdings auch Spahns eigene Positionierung zu Schwangerschaftsabbrüchen.
2019 hatte er als Gesundheitsminister eine Studie in Auftrag gegeben, die zunächst „die seelischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen“ untersuchen sollte. Dieses sogenannte „Post-Abortion-Syndrom“ behauptet etwa, dass Frauen von Abtreibungen krank werden, zum Beispiel schwere Depressionen bekommen. Es gilt als Erfindung der US-amerikanischen Anti-Choice-Bewegung aus den 1980ern Jahren und ist wissenschaftlich längst widerlegt.
Im Januar 2020 postete zudem die Vorsitzende der ALfA, Cornelia Kaminski, die nun Stimmung gegen Frauke Brosius-Gersdorf macht, ein Foto auf Facebook. Man sieht Kaminski dort eng neben Jens Spahn stehen, beide lächeln freundlich-beschwingt in die Kamera.
Während sich das Gesundheitsministerium damals nicht zu „einzelnen Fotos“ äußern wollte, freute sich die ALfA offensichtlich über den Kontakt. „Beim Künzeller Treffen der CDU Hessen in Fulda“, beschrieb Kaminski das Bild. Und: „Ein gutes Gespräch.“
https://taz.de/
„Das war eine Kampagne“
Verhinderte das AfD-Umfeld die Wahl von Brosius-Gersdorf?
13.07.2025, 18:36
Dass der Bundestag die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf vertagen musste, war nach Ansicht von Experten kein Zufall. AfD-nahe Abtreibungsgegner sollen Abgeordnete der Union massiv unter Druck gesetzt haben. Chronologie eines Vorgangs, der die Koalition in eine Krise gestürzt hat...
Von Antje Hildebrandt
https://www.focusplus.de/
SPD-Kandidatin Brosius-Gersdorf
Erzbischof warnt vor »innenpolitischem Skandal« bei Richterwahl
Der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl zeichnet in einer Predigt ein düsteres Bild der Zukunft und thematisiert dabei auch die mögliche Wahl der SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht.
13.07.2025, 11.24 Uhr
- Bild vergrößern
Erzbischof Herwig Gössl: »Abgrund der Intoleranz und Menschenverachtung« Foto: Daniel Vogl / picture alliance / dpa
Nach der Auffassung von Bambergs Erzbischof Herwig Gössl wäre die Ernennung der wegen ihrer Haltung zum ungeborenen Leben umstrittenen Juristin Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin ein »innenpolitischer Skandal«. Das sagt Gössl laut einem vorab verbreiteten Redetext in seiner Predigt zum katholischen Heinrichsfest am Sonntag.
»Ich möchte mir nicht vorstellen, in welchen Abgrund der Intoleranz und Menschenverachtung wir gleiten, wenn die Verantwortung vor Gott immer mehr aus dem Bewusstsein der Menschen verschwindet«, heißt es in dem Text. »Dann haben die Schwächeren keine Stimme mehr: nicht die Ungeborenen und nicht die pflegebedürftigen Alten; nicht die psychisch Kranken und auch nicht die sozial Schwachen; nicht die Menschen, die sich aufgrund von Krieg und Verfolgung auf die Flucht begeben und auch nicht die Natur, die gewissenlos ausgebeutet und zerstört wird.«
Brosius-Gersdorf will sich Fragen der Union stellen
Der Bundestag hatte am Freitag eigentlich über die Neubesetzung von drei Richterposten beim Bundesverfassungsgericht befinden sollen. Die Unionsfraktion forderte aber kurzfristig die Absetzung der Wahl der SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf und verwies auf Plagiatsvorwürfe. Nach anderthalbstündigen Krisengesprächen zwischen den Koalitionspartnern Union und SPD wurden schließlich alle drei geplanten Richterwahlen von der Tagesordnung genommen .
- Umstrittene SPD-Kandidatin: Union will Wahl von Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin von der Tagesordnung nehmen Union will Wahl von Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin von der Tagesordnung nehmen
Debatte über Richterpersonalie: Wie weit links steht Brosius-Gersdorf wirklich? Von Dietmar Hipp, Karlsruhe
Wie weit links steht Brosius-Gersdorf wirklich?
Verschobene Richterwahl: Was es mit den Plagiatsvorwürfen gegen Brosius-Gersdorf auf sich hat Von Swantje Unterberg
Was es mit den Plagiatsvorwürfen gegen Brosius-Gersdorf auf sich hat
Die Potsdamer Juraprofessorin ist primär wegen ihrer liberalen Positionen zum Lebensschutz und zum Abtreibungsrecht umstritten. CDU-Fraktionsgeschäftsführer Steffen Bilger, CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann und Unionsfraktionschef Jens Spahn hatten in der Fraktion dafür geworben, die Staatsrechtlerin trotzdem zu wählen. Allerdings wurde der Widerstand im Laufe der Woche eher größer statt kleiner. Rechte Internetportale trommeln gegen die Juristin, aber auch katholische Bischöfe und Prälat Karl Jüsten.
Einem Bericht zufolge will die SPD Frauke Brosius-Gersdorf nun vor der Unionsfraktion auftreten lassen und mit den Abgeordneten von CDU und CSU über ihre Kandidatur sprechen.
mak/dpa
https://www.spiegel.de/
Verfassungsrichterwahl eskaliert nach Plagiatsvorwurf: „Es riecht stark nach einer Kampagne“
Stand:13.07.2025, 04:52 Uhr
Von: Peter Sieben, Andreas Schmid
Der Streit um Verfassungsrichterin Brosius-Gersdorf spitzt sich zu. Plagiatsvorwürfe stehen im Raum. Experten glauben nicht an einen Zufall.
Berlin – Allmählich hat es Schlammschlacht-Qualitäten. Der Streit um die Wahl der Verfassungsrichter ist eskaliert – die Wahlen von der Tagesordnung genommen. Damit ist die schwarz-rote Koalition beschädigt.
Es geht um die Kandidatin der SPD Frauke Brosius-Gersdorf, an der sich der Streit entzündete. Weil im Vorfeld mehrere Abgeordnete der Union angekündigt hatten, sie nicht wählen zu wollen, wackelte die Wahl bedenklich. Nach einem dramatischen Morgen im Bundestag wurde ihre Wahl zur Bundesverfassungsrichterin von der Tagesordnung des Bundestags abgesetzt. Das hatte die Union gefordert.
Die Begründung: ein Plagiatsverdacht, der die fachliche Expertise von Brosius-Gersdorf in Zweifel ziehe, hieß es aus der Unionsfraktion. Konkret geht es um die Dissertation Brosius-Gersdorfs aus dem Jahr 1997 und Textpassagen aus der Dissertation ihres Mannes, die ein Jahr später veröffentlicht wurde.
Verfassungsrichterwahl eskaliert nach Plagiatsvorwurf gegen SPD-Kandidatin
Der selbsternannte „Plagiatsjäger“ Stefan Weber hatte Vorwürfe gegen Brosius-Gersdorf am Donnerstagabend publik gemacht. Eine angehende Verfassungsrichterin müsse über jeden Zweifel erhaben sein, hieß es jetzt in der Fraktion. Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) und Bundeskanzler sowie CDU-Chef Friedrich Merz hatten der SPD die Unions-Entscheidung mitgeteilt. Schon im Vorfeld hatten Unionspolitiker deutlich gemacht, Brosius-Gersdorf stehe politisch zu links für das Amt.
Doch kurz nachdem die Wahlen abgesagt wurden, meldete sich Plagiatsprüfer Weber wieder zu Wort und schrieb auf X: „Die Sichtweise der #CDU, dass Plagiatsvorwürfe gegen Frau #FraukeGersdorf erhoben wurden, ist falsch.“ Es gebe mehrere Möglichkeiten, wie übereinstimmende Passagen mit einer anderen Arbeit zustande gekommen sein könnten.
Manche Beobachter wittern eine Kampagne der Union, weil sie mit dem Plagiatsvorwurf einen einfachen Weg hatte, eine unliebsame Kandidatin loszuwerden. Andere vermuten, dass rechtsextreme Kräfte ihre Hände im Spiel hatten. Und Verwunderung bis Unverständnis gibt es bei der SPD-Fraktion. „Frau Brosius-Gersdorf erscheint mir eine passende Nominierung. Dass einige Kolleginnen und Kollegen aus der Union Ihr die Eignung absprechen und Sie aufgrund einer spezifischen und völlig legitimen juristischen Positionierung als ‚ultralinks‘ bezeichnen, empfinde ich das als gänzlich inakzeptable Schmähung. Nun kommen noch aus dem Nichts Plagiatsvorwürfe zutage“, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Geschäftsordnungsausschusses, Macit Karaahmetoglu, im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau von IPPEN.MEDIA.
„Das heutige Verhalten der Unionsfraktion ist für mich in keiner Weise nachvollziehbar“, so der SPD-Politiker weiter. „Am Tag der Wahl einen laufenden Prozess der Richterwahl so zu sabotieren, beschädigt nicht nur das Parlament und die vorgeschlagene Kandidatin sondern auch das Bundesverfassungsgericht.“ Die Union habe alle drei Nominierungen im Wahlausschuss mitgetragen. „Dann kann sie nicht einmal so viel Ordnung und Verantwortungsgefühl aufbringen, diese Entscheidung auch im Plenum zu treffen, während die SPD-Fraktion immer wieder schwere Entscheidungen, wie die Aussetzung des Familiennachzugs, trotz großer Bauchschmerzen mitträgt.“ Er erhoffe sich vom Koalitionspartner in Zukunft mehr Disziplin, „um dieser Regierung und unserem Land in schweren Zeiten mehr Stabilität zu verleihen“, so Karaahmetoglu.
Frauke Brosius-Gersdorf
Soll neue Richterin am Bundesverfassungsgericht werden: Frauke Brosius-Gersdorf. © Britta Pedersen/dpa
„Spahn und Merz sind beschädigt“: Union da, wo „AfD sie haben möchte“
Deutlich wird auch Politikberater Johannes Hillje. „Es riecht stark nach einer Kampagne auf dem Rücken der demokratischen Institutionen“, so der Experte gegenüber dieser Redaktion. „Rechte und rechtspopulistische Kreise diskreditieren schon seit Tagen laustark Frauke Brosius-Gersdorf. Einzelne Unionsabgeordnete schließen sich mindestens medial dieser Kampagne an.“ Das sei „unverantwortlich“, so Hillje: „Sie trugen die Plagiatsvorwürfe aktiv in die Medien. Spahn und Merz sind beschädigt. Die Union hat sich dorthin bewegt, wo die AfD sie haben möchte.“
Die Union selbst wehrte sich gegen diese Lesart. „Von einer Kampagne kann hier keine Rede sein“, sagte uns der CSU-Politiker Stephan Pilsinger. Er hat Bedenken gegenüber der Personalie Brosius-Gersdorf und attestiert ihr „gesellschaftspolitische Extrempositionen“. Konkret: „Ihre Haltungen unter anderem zur Impfpflicht, zur Menschenwürde erst ab der Geburt sowie ihre Haltung zur Zulässigkeit des Kopftuchs bei Rechtsreferendarinnen trotz anderslautender Rechtsprechung zeigen deutlich, dass sie für mich nicht die nötige Verfassungsbindung und Neutralität für das höchste Gericht mitbringt.“ Auch mehrere andere Unionspolitiker hatten intern diese Bedenken geäußert – ein Grund, warum die Wahl am Freitag gescheitert ist.
Ates Gürpinar, Parteivize der Linken, sagte im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau: „Die Union ist mit ihrem Koalitionspartner maximal unwürdig umgegangen. Eine Koalitionskrise nach hundert Tagen – das muss man erstmal schaffen.“ Schlimmer noch sei „allerdings der Umgang mit den Kandidatinnen und dem Kandidaten des Bundesverfassungsgerichts“, so die Politikerin. „Mit rechten Erzählungen spielen und sich nicht um demokratische Mehrheiten kümmern, das heißt, die höchsten demokratischen Institutionen zu beschädigen.“ Jens Spahn sei „mit seiner Aufgabe offensichtlich überfordert und wird damit auch für Friedrich Merz ein massives Problem“.
https://www.fr.de/
Frauke Brosius-Gersdorf:
Und diese Frau soll links sein?
Frauke Brosius-Gersdorf gilt als progressive Aktivistin. Eine Analyse ihrer Schriften zeigt allerdings: Sie steht näher bei Ludwig Erhard als bei Rosa Luxemburg.
Von Mark Schieritz
12.07.2025, 16:15 Uhr
Frauke Brosius-Gersdorf bei einer Aufzeichnung der Talkshow "Markus Lanz" im Juli 2024 © teutopress/imago images
Das Urteil über Frauke Brosius-Gersdorf war in gewissen Kreisen schnell gefällt. Die SPD habe eine "linke Kulturkämpferin" als Richterin am Bundesverfassungsgericht nominiert, schrieb Alexander Marguier im Cicero. Julian Reichelt bezeichnete die Rechtsprofessorin im Portal Nius als "ultralinke Juristin", im Focus argumentierte Jan Fleischhauer, Brosius-Gersdorf erfülle "jedes Klischee einer Aktivistin", und in der Neuen Zürcher Zeitung meinte Marc Felix Serrao, mit der Ablehnung der Kandidatin durch die Fraktion der Union sei der "Ruf des Bundesverfassungsgerichts" gerettet worden...
https://www.zeit.de/
Politik
Eine Regierungskrise ganz im Sinne der AfD
12.07.2025, 16:39 Uhr
Die Spitze der AfD dürfte sich nach diesem 11. Juli 2025 die Hände gerieben haben: Uneinigkeit zwischen Union und SPD kommt ihr sehr gelegen.
(Foto: Soeren Stache/via REUTERS)
Für die Partei von Alice Weidel läuft alles nach Plan: Der Eklat um die abgesagte Richterwahl passt erschreckend gut zur kürzlich geleakten AfD-Strategie. Die zielt auf nichts Geringeres als die Zerstörung der Koalition ab...
Gastbeitrag von Volker Weiß
Die AfD hat sich einmal mehr als Meisterin darin erwiesen, die Öffentlichkeit an der Nase herumzuführen. Erst kürzlich ging die Meldung um, die Partei habe sich auf der Klausurtagung ihrer Bundestagsfraktion neue Benimmregeln auferlegt. Ein neuer Verhaltenskodex solle das Image der Partei aufpolieren und dafür sorgen, dass ihre Abgeordneten der auch weltanschaulich stets beschworenen „Bürgerlichkeit“ entsprechen. Das wäre notwendig, denn tatsächlich gilt die AfD seit Beginn ihrer Parlamentskarriere als bar der bürgerlichen Tugenden und ausgesprochen verhaltensauffällig. Ganz in der Manier von NPD, DVU und Republikanern früher dient ihren Abgeordneten das Parlament hauptsächlich als Bühne, sind nicht die anderen Parlamentarier Adressaten ihrer Beiträge, sondern die Gefolgschaft draußen an den Bildschirmen....
https://www.sueddeutsche.de/
Linke Hardlinerin oder verkannte Juristin? Der Fall Brosius-Gersdorf
12.07.2025 Harald Neuber
Bundesverfassungsgericht. Bild: U. J. Alexander/ Shutterstock.com
Streit um Richterwahl eskaliert. SPD-Kandidatin Brosius-Gersdorf polarisiert mit Thesen zu Abtreibung. Union blockiert Wahl. Ist sie zu links für Karlsruhe?
Das Bundesverfassungsgericht – Garant für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Doch ausgerechnet um die Neubesetzung dreier Richterstellen an diesem Bollwerk unserer Verfassung tobt ein erbitterter Streit zwischen den Koalitionspartnern CDU/CSU und SPD. Im Zentrum der Kontroverse: Die von der SPD nominierte Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf, Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Potsdam.
Die renommierte Verfassungsrechtlerin polarisiert mit ihren Positionen zu ethischen Grundsatzfragen wie dem Lebensschutz und Abtreibungen. In einem Fachaufsatz für die Festschrift ihres Doktorvaters Horst Dreier vertrat sie die umstrittene Auffassung, dass die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes erst ab der Geburt gelte:
Warum Brosius-Gersdorf für die Freiheit aller Frauen steht
Telepolis
Frauke Brosius-Gersdorf
Dramatische Wende bei Lanz: Verfassungsrichterin in spe erwägt Aufgabe
Telepolis
Abtreibung bis zur Geburt? Brosius-Gersdorf weist Vorwürfe zurück – Papier gibt ihr Recht
Telepolis
Stefan Weber mit Lupe und Doktorhut
Plagiatsforscher Weber rechnet ab: "'Spiegel'-Journalisten sind Polit-Aktivisten"
Telepolis
Mehr anzeigen
"Die Annahme, dass Menschenwürde überall gelte, wo menschliches Leben existiert, ist ein biologistisch-naturalistischer Fehlschluss. Es gibt gute Gründe dafür, dass die Menschenwürdegarantie erst ab Geburt gilt."
Für viele konservative Unionspolitiker und Kirchenvertreter wie den Prälaten Karl Jüsten sind das untragbare Positionen für eine künftige Verfassungsrichterin. Auch ihre Äußerungen in einer Expertenanhörung des Bundestags zur Reform des Abtreibungsrechts, wo sie für eine Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen eintrat, sorgen für Empörung.
Rechte auf den Barrikaden
Rechte Internetportale wie freiewelt.net schießen sich auf die "linke Hardlinerin" ein und unterstellen ihr, Abtreibungen bis zum neunten Monat zu befürworten und das Lebensrecht von Ungeborenen zu negieren.
Doch die SPD-Führung steht eisern zu ihrer Kandidatin. Fraktionschef Matthias Miersch wirft der Union in drastischen Worten "die bewusste Demontage unseres höchsten deutschen Gerichts und unserer demokratischen Institutionen" vor.
Betroffene sieht Herzjagd
Brosius-Gersdorf selbst sieht sich einer regelrechten "Hetzjagd" ausgesetzt, ihre Positionen seien völlig verzerrt dargestellt worden. Um die Wogen zu glätten und Vorbehalte auszuräumen, erklärt sie sich bereit, persönlich in der Unionsfraktion vorzusprechen und sich den kritischen Fragen zu stellen.
Unionsfraktionschef Jens Spahn steckt in der Zwickmühle. Eigentlich hatte er der SPD fest zugesichert, Brosius-Gersdorf mitzuwählen: "So haben wir es miteinander vereinbart", erklärte er noch zu Wochenbeginn.
Widerstand in der Union
Doch in den eigenen Reihen formierte sich massiver Widerstand gegen die Personalie. Über 50 Unionsabgeordnete drohten, die Juristin bei der geheimen Wahl durchfallen zu lassen. Vergeblich versuchte Spahn in Einzelgesprächen, die Bedenken zu zerstreuen und für die Paketlösung mit der SPD zu werben.
Doch am Freitagmorgen, kurz vor der geplanten Abstimmung im Bundestag, zog Spahn schließlich die Reißleine. Per SMS an SPD-Fraktionschef Miersch forderte er, die Wahl von Brosius-Gersdorf von der Tagesordnung zu nehmen.
Die Plagiatsvorwürfe
Als offizielle Begründung dienten plötzlich aufgetauchte Plagiatsvorwürfe gegen die Kandidatin. Der selbsternannte Plagiatsjäger Stefan Weber hatte auf Twitter Passagen aus ihrer Doktorarbeit mit Textstellen aus der später veröffentlichten Habilitationsschrift ihres Mannes Hubertus Gersdorf verglichen.
Dabei ist höchst fraglich, wie stichhaltig diese Vorwürfe sind. Zwar gibt es in der Tat textliche Übereinstimmungen zwischen den beiden Arbeiten. Doch Weber selbst spricht nur von „gemeinsamen Textpassagen“, nicht von einem Plagiat.
Wie Medien Partei ergreifen
Teile der deutschen Medienlandschaft, allen voran das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, versuchen, diese Zweifel zu zerstreuen. Weber wird dort in ungewöhnlicher Schärfe als „äußerst umstritten“ präsentiert, seine Motivation hinterfragt.
Die Universität Hamburg, wo Brosius-Gersdorf 1997 promovierte, sieht jedenfalls keinen Anlass für eine Überprüfung; vielleicht auch aus Selbstschutz.
Für die SPD ist der Plagiatsvorwurf nur ein vorgeschobenes Argument, mit dem die Union den Rückzieher bei der mühsam ausgehandelten Personalabsprache rechtfertigen will.
Der Schaden ist da
Fakt ist: Die Besetzung des Verfassungsgerichts, die eigentlich eine Routineangelegenheit sein sollte, hat sich zum Kulturkampf zwischen den Koalitionspartnern ausgewachsen. Das gegenseitige Vertrauen ist schwer beschädigt. Sogar vom Ende des schwarz-roten Bündnisses ist die Rede. "Führung und Verantwortung sind nicht nur etwas für Sonntagsreden", mahnt SPD-Vizekanzler Lars Klingbeil.
Klar ist: Union und SPD müssen schnell einen Weg aus der verfahrenen Situation finden. Sonst droht aus dem Streit um eine Richterin eine handfeste Koalitionskrise zu werden - mit unabsehbaren Folgen für die Stabilität und Handlungsfähigkeit der Regierung. Nutznießer des Schlamassels ist die AfD, die sich diebisch über das "Desaster" im Regierungslager freut. "Uns geht's Bombe", frohlockt Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel.
Auch die Opposition wittert ihre Chance. Die Grünen-Fraktionschefinnen Britta Haßelmann und Katharina Dröge fordern eine Sondersitzung des Bundestags – und stellen die Eignung von Jens Spahn als Fraktionschef infrage, sollte er keine Mehrheit für die Richterkandidaten organisieren können.
Der Druck auf Spahn, der mit der Zusage an die SPD wohl zu weit vorgeprescht ist, wächst. Seine Autorität in den eigenen Reihen hat er verspielt. Auch für Kanzler Merz ist die Lage heikel, wenngleich er die Richterwahl als Sache des Parlaments sieht.
Alles in allem also ein Trauerspiel, ein Offenbarungseid der Koalition, die eigentlich mit Aufbruch und Zuversicht in die Sommerpause starten wollte.
Stattdessen herrscht Krisenstimmung.
https://www.telepolis.de/
Politik:
Er redet nicht mit Linken, stürzt Friedrich Merz in die Krise: Was hat Jens Spahn vor?
CDU, CSU und SPD scheitern im Bundestag an der Wahl von drei neuen Bundesverfassungsrichterinnen. Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hat recht: Jens Spahn trägt dafür die Verantwortung
Von Sebastian Puschner
11.07.2025
Nach nicht einmal drei Monaten steckt die Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD in ihrer zweiten großen Krise. Jens Spahns Anteil daran ist groß. „Immer wenn man denkt, die Union kann nicht noch tiefer sinken, kommen Sie, Herr Spahn, und packen die Schaufel aus“, sagte Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek im Bundestag.
Nach dem fulminant gescheiterten ersten Wahlgang der Merz-Kanzlerwahl mussten Union und SPD nun die Wahl von zwei neuen Bundesverfassungsrichterinnen und einem neuen Bundesverfassungsrichter kurzfristig von der Tagesordnung des Bundestags nehmen. Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für die von der SPD nominierte Juraprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf drohte nicht zustande zu kommen.
Ohnehin wäre sie denkbar knapp ausgefallen – wären an diesem Freitag alle Bundestagsabgeordneten anwesend gewesen, wären CDU/CSU und SPD nicht nur auf die Stimmen der Grünen, sondern auch auf einzelne Stimmen der Linken angewiesen gewesen – mit der die Union aber keine Gespräche führen wollte. Dann aber zeigt sich, dass mehr als 50 Unions-Abgeordneten Brosius-Gersdorf die Stimme verweigern könnten. Der Grund: Deren liberale Haltung zum Recht auf Schwangerschaftsabbruch und zur Frage, ob schon einem Embryo oder erst einem Menschen ab Geburt Menschenwürde zukommt.
Im Bundestag-Wahlausschuss waren Anfang der Woche noch zwei Drittel der Stimmen zusammengekommen, um Brosius-Gersdorfs Wahl im Plenum aufrufen zu können, ebenso wie die der beiden anderen Kandidatinnen, der Jura-Professorin Ann-Katrin Kaufhold (ebenso auf Vorschlag der SPD) und des Bundesarbeitsrichters Günter Spinner (von der Union nominiert). Der Wahlausschuss hat aber nur zwölf Mitglieder, der Bundestag insgesamt 630.
Heidi Reichinneks Bild von der Schaufel
Unions-Fraktionschef Jens Spahn ist also entweder daran gescheitert, diese Mehrheit zu übersetzen und sie in seiner Gesamtfraktion zu organisieren, und das keine zwei Tage, nachdem sich sein Bundeskanzler und CDU-Parteichef Merz dezidiert für die Wahl von Brosius-Gersdorf ausgesprochen hatte. Oder aber Spahn ist im Bunde mit jenen Unions-Abgeordneten, die lieber Parlament und Verfassungsgericht zum Spielball machen, als eine Frau zur Richterin zu berufen, die juristisch für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch argumentiert. Damit würde er Merz brutal in den Rücken fallen.
Entweder also hat Spahn seine Fraktion nicht unter Kontrolle. Oder aber, um in Heidi Reichinneks Bild zu bleiben, er ließ all das bewusst geschehen: Eine „Schaufel“ nimmt man schließlich nicht versehentlich zur Hand, um ein Loch tiefer zu graben.
Zu Beginn der Legislatur hatte sich Spahn dafür ausgesprochen, AfD-Abgeordneten nicht weiter parlamentarische Ämter wie die der Ausschussvorsitzenden vorzuenthalten. Arbeitet er also daran, die AfD salonfähig zu machen, die Brandmauer zum Einsturz zu bringen und diejenigen bloßzustellen, die an ihr festhalten? Die Haltung der Brosius-Gersdorf-Kritiker in der Union entspricht der der AfD-Fraktion. Aber bereitet Spahn wirklich eine Öffnung der CDU zur AfD vor?
Der angebliche Plagiatsvorwurf gegen Frauke Brosius-Gersdorf
Als Grund dafür, die Richterinnenwahl von der Tagesordnung nehmen zu wollen, soll Spahn vor seiner eigenen Fraktion einen angeblichen Plagiats-Vorwurf gegen Brosius-Gersdorf angeführt haben. Doch dieser Lesart widerspricht sogar der Mann, dem der Vorwurf zugeschrieben wird. Der als „Plagiatsjäger“ firmierende Stefan Weber sagte der Süddeutschen Zeitung: „Es geht hier nicht um ein Plagiat, sondern um unethische Autorenschaft.“ Wörtlichen Übereinstimmungen in der Dissertation von Brosius-Gersdorf und in der Habilitationsschrift ihres Mannes Hubertus Gersdorf hätten womöglich von beiden gekennzeichnet werden müssen.
Für die bewusste Provokation einer Regierungskrise ist das eine dünne Grundlage. Damit mögen sich rechte Echokammern auf Online-Plattformen bedienen lassen. Doch Spahns Reputation als Fraktionschef ist das nicht zuträglich.
Ob Friedrich Merz schon bereut, dass er Spahn doch noch in den engsten Zirkel der Macht geholt hat? Spahn stieg nach der Bundestagswahl im letzten Moment in den Kreis derer auf, die sich an das Aushandeln der Schwarz-Roten Koalition machten, wurde schließlich Unions-Fraktionschef im Bundestag. Seine Karriereambitionen sind auch seinem Parteifreund Merz bekannt, ein gewachsenes Vertrauensverhältnis zwischen dem Bundeskanzler und ihm hingegen nicht. Doch Spahns Fachkompetenz und Erfahrung habe ihn unentbehrlich gemacht, hieß es.
Fehlt es Spahn womöglich an Fachkompetenz und Erfahrung im Amt eines Fraktionschefs? Er hat dabei versagt, seiner Aufgabe, der Beschaffung von Mehrheiten, gerecht zu werden, und dafür in letzter Minute eine krude Begründung geliefert. Das spricht eher für die Ohnmacht Jens Spahns gegenüber einem Teil seiner Fraktion als für eine gezielte Merz-Demontage. Spahn mag manch Finsteres im Schilde führen. In erster Linie aber agiert er als Fraktionschef wie ein Amateur – und beschädigt sich erheblich selbst.
Friedrich Merz müsste den Fehler mit Jens Spahn eigentlich schnell korrigieren
Diesen Eindruck hatte auch schon Spahns Parlamentarischer Geschäftsführer Steffen Bilger (CDU) Anfang der Woche vermittelt, als es um die Frage ging, woher zwei Drittel der Stimmen kommen sollten, die man für die Richterinnenwahl benötigt. Das von der Linken für ihre Zustimmung erbetene Gespräch ignorierte Spahn. Man setze darauf, dass im Plenum so viele AfD- und Linken-Abgeordnete fehlen würden, dass man mit Schwarz-Rot-Grün allein auf die Zwei-Drittel-Mehrheit komme, erklärte Bilger die bemerkenswert naive Strategie.
Doch so weit kam es gar nicht erst. Allein die Uneinigkeit in der Unions-Fraktion und die Unfähigkeit von deren Führung, diese aufzulösen, waren ausschlaggebend dafür, dass der Bundestag die Wahl der Bundesverfassungsrichterinnen von der Tagesordnung nehmen musste – und dass diese Bundesregierung schon nach einigen Wochen daran scheitert, ihr Versprechen vom guten, geräuschlosen Regieren nach dem Ampelkoalitions-Chaos einzulösen.
Vielleicht war Jens Spahn in den vergangenen Wochen auch zu sehr mit der Aufarbeitung und Verteidigung seines milliardenschweren Erbes als Bundesgesundheitsminister beschäftigt – er muss sich seit Wochen seinen folgenschweren Masken-Deals während der Corona-Zeit stellen. Für die Vorbereitung einer Verfassungsrichterinnenwahl scheint er nicht mehr die nötige Zeit und Kapazität aufzubringen imstande gewesen zu sein.
Bei Friedrich Merz sollten jedenfalls alle Alarmglocken schrillen. Nimmt er zum Maßstab, was von einem Fraktionschef erwartet wird, und wie sein eigener Jens Spahn zunächst mutmaßlich bei der Kanzlerwahl und nun bei der Richterinnenwahl diese Erwartungen enttäuscht, wie er den Herausforderungen heutiger parlamentarischer wie politischer Verhältnisse nicht gewachsen scheint – dann kann er eigentlich nur zum Schluss kommen, dass diese personelle Fehlbesetzung schnellstmöglich korrigiert werden muss. Gerade die Union braucht in diesen volatilen Zeiten Fachkompetenz und Erfahrung.
https://www.freitag.de/
Reaktionen auf abgesagte Richterwahl
»Wir müssen stark aufpassen, dass wir nicht in Muster der Ampel zurückfallen«
Soll Frauke Brosius-Gersdorf Richterin am Bundesverfassungsgericht werden? Nein, findet die Union und bricht damit Streit in der Koalition vom Zaun. Nicht nur die Opposition zeigt sich entsetzt.
11.07.2025, 17.54 Uhr
- Der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) spricht im Bundestag Foto: Niklas Treppner / picture alliance / dpa
Der Streit über die Neubesetzung der Richterposten am Bundesverfassungsgericht erschüttert das politische Berlin. Die Kritik trifft vor allem Bundeskanzler Friedrich Merz und Unionsfraktionschef Jens Spahn (beide CDU). Beide wurden aus der Opposition heftig attackiert – aber auch vom eigenen Koalitionspartner SPD.
So sagte etwa Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach zum SPIEGEL: »Das ist eine gefährliche Situation. Wir müssen stark aufpassen, dass wir nicht in Muster der Ampel zurückfallen.« In einer Koalition müsse man sich aufeinander verlassen können. »Bis gestern Abend gab es die Zusage der Union, dass sie unseren Kandidatinnen zustimmen. Seitdem gab es keine neuen Erkenntnisse zu den Kandidaten. Deshalb wäre es richtig gewesen, alle drei Richter heute zu wählen.« Lauterbach sprach von einem »Warnschuss« für die Koalitionäre. »Wir werden uns das nicht oft leisten können. Die Mehrheit von Schwarz-Rot ist nicht groß. Die Unionsspitze muss Führungsstärke zeigen und beweisen, dass wir uns auf den Koalitionspartner verlassen können.«
Grüne sprechen von »Desaster« für Spahn und Merz
In den Augen der Grünen waren die aktuellen Geschehnisse im Bundestag ein Fiasko für die deutsche Politik. Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann machte ihrem Ärger dafür während der Sitzungsunterbrechung im Parlament Luft: »Dieser Tag heute ist ein Desaster für das Parlament, ist vor allem ein Desaster für Jens Spahn und Friedrich Merz und mit ihm die Koalitionsfraktionen von CDU, CSU und SPD«, sagte Haßelmann.
Sie verwies darauf, dass die Kandidaten für die drei eigentlich geplanten Wahlen mit Zweidrittelmehrheiten im Wahlausschuss des Bundestages nominiert worden seien. Nun entziehe die Union als größte Fraktion einer Kandidatin die Mehrheit. »Das ist ein Vorgang, den wir im Deutschen Bundestag zur Wahl von Richterinnen und Richtern zum Bundesverfassungsgericht noch nie erlebt haben«, sagte Haßelmann. »Und dafür trägt allen voran Jens Spahn die Verantwortung.«
Die Grünenführung sei »entsetzt« über das Vorgehen der Union. »Das ist kein Roulette, das man hier spielt«, sagte Haßelmann weiter. Es gehe »um das Ansehen des höchsten Gerichtes.« Sie warf insbesondere Spahn »Dilettantismus« bei der Vorbereitung der Richterwahl vor und legte Spahn den Rückzug von seinem Amt nahe: Die Fraktion »läuft ihm davon und auch dem Kanzler, und das ist nicht nur ein Ansehensverlust, das beschädigt ihn auch in seiner Autorität als Fraktionsvorsitzender so erheblich, dass ich mich frage, ob er sein Amt ausführen kann«, sagte die Grünenpolitikerin.
Während der anschließend fortgeführten Sitzung äußerte sie sich ähnlich. Obwohl die Union selbst die drei Kandidierenden mit abgesegnet habe, seien zuletzt immer wieder Attacken gegen Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf aus der Union gekommen, kritisierte Haßelmann. Brosius-Gersdorf sei völlig zu Unrecht verunglimpft worden. Sie rate allen Frauen, die hierzulande Ähnliches erlebten: »Wehrt euch!«
Koalitionspartner SPD spricht von »schockierenden« Vorgängen
Ähnlich äußerte sich Sebastian Roloff, Vorstandsmitglied der SPD. Zum SPIEGEL sagte er: »Es ist sehr bedenklich, wie viele Abgeordnete der Union auf die völlig haltlose Kampagne von Rechtsaußen gegen eine hochgeschätzte Juristin aufspringen. Die Unionsfraktionsführung scheint dem leider wenig entgegenzusetzen zu haben. Das muss sich zukünftig ändern.«
Auch Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger (SPD) kritisierte das Vorgehen scharf, vor allem den Umgang mit Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf: »Ich finde es auch ausdrücklich bedauerlich, wie man hier mit einer Richterin und einer Frau umgeht«, sagte Rehlinger am Rande einer Bundesratssitzung. Rehlinger nannte den Eklat um die Richterwahl »ein außerordentlich missliches Verfahren«. Die Reputation eines Verfassungsorgans, des Bundesverfassungsgerichts, sei in Gefahr: »Insofern ist das kein guter Weg, der bislang hier beschritten worden ist«, betonte Rehlinger. Die saarländische Ministerpräsidentin ist zurzeit amtierende Präsidentin des Bundesrats.
Anke Rehlinger Foto: Odd Andersen / AFP
Adis Ahmetović, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, sprach von einem »schweren Tag für die Demokratie. Die Union hat im letzten Moment einen gemeinsamen Vorschlag mit Grünen und SPD fallen lassen. Die Gründe dafür überzeugen mich nicht.« Auch Ahmetović kritisierte, »dass so das Verfassungsorgan beschädigt wurde, das in der Bevölkerung sehr großes Vertrauen genießt«.
Thüringens Innenminister und SPD-Landesvorsitzender Georg Maier zeigte sich ebenfalls »schockiert. Die Union hat nichts aus den Fehlern der Ampel gelernt und beschädigt die Koalition, ihren eigenen Bundeskanzler und das Bundesverfassungsgericht. Das war völlig unnötig und macht mir Sorgen, was die Zukunft der Koalition angeht«, sagte er zum SPIEGEL.
Wahl der Verfassungsrichter gescheitert: eine Blamage für die schwarz-rote Koalition?
Zur Debatte
Linke vergleicht schwarz-rote Koalition mit Ampelregierung
Die Linke zog ebenfalls, genau wie Lauterbach, Vergleiche zwischen der aktuellen und der Vorgängerkoalition: »Gegen diese Regierung war die Ampel eine geordnete Formation«, erklärte Dietmar Bartsch gegenüber der »Rheinischen Post«.
Lorenz Gösta Beutin, Mitglied im Parteivorstand der Linken, sagte zum SPIEGEL: »Was wir heute erlebt haben, lässt mich an die Spätphase der Weimarer Republik denken. Es ist die Verantwortung der Union, von Spahn und Merz, die es zugelassen haben, dass eine rechtsradikale Kampagne gegen eine überzeugende Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht wirken konnte.« Gewinnerin sei die AfD, »deren Ziel die Aushöhlung unserer Demokratie und unserer Institutionen ist. Es bleibt dabei: Wer rechte Politik macht, wer das Spiel der Rechten mitspielt, der stärkt nur die Rechten, aber schwächt unsere Demokratie. Es wäre Zeit, innezuhalten und die Strategie der AfD zu durchbrechen. Das ist Aufgabe aller demokratischen Kräfte«, so Beutin.
Jan Dieren, Sprecher der Parteilinken Gruppierung Forum DL 21, erklärte, die Union habe sich »vor den Karren einer Hetzkampagne von Rechtsextremen spannen lassen. Dieses Playbook kennen wir aus den USA und vielen anderen Ländern: Rechtsextreme untergraben systematisch Institutionen des Rechtsstaates, indem sie einzelne Personen in einem Kulturkampf diffamieren. Gleichzeitig nehmen sie in Kauf, dass ihre eigenen Kandidaten nur mit Stimmen von Rechtsextremen gewählt werden. Teile der Union springen Rechtsextremen in diesem Kulturkampf nun zur Seite.« Man habe bereits im Januar gesehen, »dass die Union im Zweifel auch bereit ist, Mehrheiten mit Rechtsextremen zu bilden. Dadurch etabliert die Union rechtsextreme Positionen und macht sie mehrheitsfähig«, sagte Dieren zum SPIEGEL. »Man weiß nicht, was besorgniserregender wäre: Steckt dahinter die Naivität zu glauben, man könne Rechtsextremen das Wasser abgraben, indem man sich ihre Positionen zu eigen macht? Oder sogar verdeckte Absicht?«
Union drängte auf Absetzung von Richterinnenwahl
Der Bundestag sollte am Freitag eigentlich über die Neubesetzung drei frei werdender Stellen beim Verfassungsgericht befinden. Die Unionsfraktion forderte aber kurzfristig die Absetzung der Wahl von Brosius-Gersdorf und verwies auf angebliche Plagiatsvorwürfe. Gegen die Juristin hatte es schon zuvor massive Vorbehalte bei CDU/CSU unter anderem wegen ihrer liberalen Haltung beim Thema Abtreibung gegeben.
Später wurde die Wahl aller drei Kandidierenden für den Sitzungstag abgesagt und verschoben.
Debatte über Richterpersonalie: Wie weit links steht Brosius-Gersdorf wirklich? Von Dietmar Hipp, Karlsruhe
Wie weit links steht Brosius-Gersdorf wirklich?
Richterwahl im Bundestag: Wie die Union fahrlässig die AfD stärkt
Der SPIEGEL-Leitartikel von Sebastian Fischer
Wie die Union fahrlässig die AfD stärkt
Für die Richterwahl wird eine Zweidrittelmehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden Bundestagsabgeordneten gebraucht. Wollen Union und SPD nicht von der AfD abhängig sein, brauchen sie neben Stimmen der Grünen auch Unterstützung der Linken.
mkh/dpa/Reuters
https://www.spiegel.de/
Wahlen der Verfassungsrichter nach Berichten der freien Medien verschoben
Triumph für Reichelt: Regierungsparteien lassen sich am Nius-Nasenring führen
11.07.2025 um 11:56 Uhr
von Alexander Wallasch
Die Wahl wurde verschoben – Bernd Baumann ist außer sich© Quelle: Bundestag.de/Screenshots
Die Öffentlichkeit ist für den Moment wieder hergestellt, die übliche Propagandaarbeit der regierungsnahen Mainstream-Medien fand nicht statt. Die SPD verliert Machtprobe, die Union stellt sich gegen den Koalitionspartner. Merz ist waidwund.
Unabhängig davon, was man von Frauke Brosius-Gersdorf hält, ist das, was jetzt um die Personalie der Juristin als Richterin am Bundesverfassungsgericht herum passiert ist, ein großer Erfolg für Julian Reichelt.
Der Macher von Nius hatte in mehreren scharfen Artikeln, Kommentaren und in den sozialen Medien darauf hingewiesen, dass die von der SPD vorgeschlagene Brosius-Gersdorf für den Posten nicht geeignet sei.
Zuletzt bekam der ursprünglich von der „Bildzeitung“ kommende Blattmacher Reichelt eine Art unerwarteten Ritterschlag ausgerechnet von der ehemaligen grünen Parteichefin Ricarda Lang. Diese schrieb nämlich ganz aufgebracht via X:
„Wenn Julian Reichelt mehr Einfluss auf die Position der Unionsfraktion hat als Friedrich Merz, sagt das viel über den Zustand der Union und noch mehr über die Fraktionsführung von Jens Spahn aus.“
Was Frau Lang damit andeutete, war nicht weniger als die Überzeugung, dass „Nius“ und Reichelts Berichterstattung ursächlich dafür verantwortlich seien, dass die Unionsfraktion der SPD drohte, sich der notwendigen Unionsstimmen in der geheimen Abstimmung zu enthalten.
Reichelt konterte umgehend und schlagfertig:
„Das ist sehr schmeichelhaft von Ricarda Lang, aber das Debakel hat ganz allein Friedrich Merz mit seinem JA zu der schrecklichen Ideologie von #Brosius_Gersdorf angerichtet.“
X-Userin „Patrizia von der Lahn“ hatte noch einen anderen Verdacht:
„Das war das Verdienst von Frau von Storch, die hier strategisch brillant gehandelt und Merz vorgeführt hat.“
Die AfD-Bundestagsabgeordnete Frau von Storch hatte in einer Frage im Rahmen der Regierungsbefragung die Haltung von Brosius-Gersdorf zur Menschenwürde von Ungeborenen abgefragt und Merz dazu verleitet, der Juristin indirekt zuzustimmen, dass es diese Menschenwürde vor der Geburt nicht gebe, was wiederum für Empörung sorgte, weil diese Haltung von verschiedenen Gegnern der Personalie gleichgesetzt wird mit dem Zugeständnis, Abtreibungen bis zum neunten Monat zuzulassen.
Aber den finalen Blattschuss bekam Frauke Brosius-Gersdorf dann doch aus einer eher neutralen Ecke, als gegen sie noch eine Plagiatsaffäre in Stellung gebracht wurde. Angebliche „23 Verdachtsstellen auf Kollusion und Quellenplagiate“ in ihrer Doktorarbeit nutzte die Unionsfraktion dazu, sich ohne direkte Bezugnahme auf die Angriffe zu „Menschenwürde“ und Abtreibungen von der SPD-Kandidatin distanzieren zu können. Die SPD beantragte für heute 10:30 Uhr eine Sitzungsunterbrechung, die genehmigt wurde.
Kurtz vor 12 Uhr wurde die Sitzung wieder aufgenommen. Die Regierungsparteien und die Grünen lassen den Tagespunkt der Wahlen zu den Verfassungsrichter platzen bzw. verschieben.
Der Abgeordnete Dirk Wiese (SPD) will den Spieß umdrehen und spricht von einer Beschädigung des Verfassungsgerichts und spricht von einer Hetzkampagne und Hetzjagd. Von rechten Hetzportalen ist die Rede mit Blick wohl auf Nius. Von Morddrohungen gegen Frauke Brosius-Gersdorf ist die Rede bei Wiese.
Und Wiese erinnert noch einmal daran, dass es im Ausschuss bereits eine Zweidrittelmehrheit gegeben habe. Curio von der AfD bekommt einen Ordnungsruf, weil er in einem Zwischenruf die Kandidatin „Linksextremistin nannte. Bernd Baumann (AfD) hat das Wort und erkennt eine „Instabilität der Regierung“ und eine „massive Beschädigung des hohen Gerichtes“. Bernd Baumann wird dann erneut ermahnt von der Bundestagspräsidentin, er solle zur Geschäftsordnung sprechen. Er will „hier und jetzt“ abstimmen. Die AfD sei „der eigentliche Stabilitätsanker“ in der Republik. Tosender Applaus der AfD-Fraktion.
Die Grüne Britta Haßelmann macht anschließend in einfacher Sprache den Unionsfraktionschef Jens Spahn verantwortlich. Auch haßelmann bezieht sich direkt auf Nius. Ihre Rede endet mit einer Schreiattacke.
Ein großer Erfolg für Julian Reichelt und die neuen Medien.
https://www.alexander-wallasch.de/
Felix Banaszak
11. Juli um 17:24 ·
Ich bin besorgt. Und ja, ich bin auch wütend.
Vor einiger Zeit waren es rechte Netzwerke um Julian Reichelts NIUS, die mit Hilfe des „Plagiatswebers Stefan Weber“ eine renommierte Journalisten in den Suizidversuch trieben. Nun gehen dieselben Leute gegen eine Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht vor, eine Frau, die die Selbstbestimmung von Frauen über sich und ihren eigenen Körper etwas ernster nimmt als das unter Rechten so üblich ist. So weit, so erbärmlich, so erwartbar.
Aber was noch erbärmlicher ist? Wie leicht sie‘s bei Jens Spahn und seiner Fraktion hatten. Obwohl Frauke Brosius-Gersdorf als gemeinsame Kandidatin von Union und SPD im Richterwahlausschuss am Montag nominiert wurde, versagte ihr Friedrich Merz‘ Fraktion ihr heute die Zustimmung. Eine Zäsur, wieder einmal. Ein kolossales Führungsversagen. Ein riesiger Schaden für das Verfassungsgericht, für den Respekt vor den Institutionen, für die Kandidatinnen und den Kandidaten selbst.
Ist es Unfähigkeit oder zynisches Kalkül, das Jens Spahn da angetrieben hat? Einer Union, die sich von rechtsextremer Hetze in die Demontage des Verfassungsgerichts treiben lässt, fehlt die demokratische Klarheit und die demokratische Resilienz. Eine solche Union verabschiedet sich aus der demokratischen Mitte, ein zunehmend verwaister Platz. Man kann nur hoffen, dass sie den Weg zurückfindet.
Denn es ist nicht das erste Mal. Ich habe nicht vergessen, wie Friedrich Merz, Jens Spahn und ihre Fraktion am 29. Januar mit Leuten einen Antrag im Deutschen Bundestag durchgebracht haben, die sich selbst als „das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus“ bezeichnen - wenige Stunden, nachdem Holocaust-Überlebende am Redepult gesprochen hatten. Sie scheinen daraus nichts, aber auch gar nichts gelernt zu haben.
Dieses Desaster geht auf das Konto von Jens Spahn. Und auf das von Friedrich Merz, der Spahn erst die Macht gegeben hat, dem Land die Ohnmacht der Union gegenüber dem rechtsautoritären Ruck unter Beweis zu stellen. Ein Scheitern mit Ansage.
Es ist ein bitterer Tag, wieder einmal. Sorgen wir dafür, dass es nicht zur neuen Normalität wird.
https://www.facebook.com/felix.banaszak
Update SPD trifft sich zur Krisensitzung: Klingbeil kritisiert fehlende Führung und Verantwortung in der Union
Drei Richter hätten am Freitag für das Bundesverfassungsgericht berufen werden sollen. Dass das nun nicht geklappt hat, sorgt in der SPD für Frust. Noch heute will sie beraten, wie es weitergehen soll.
11.07.2025, 20:46 Uhr
Nach der geplatzten Wahl von Verfassungsrichtern herrscht in der SPD Krisenstimmung: Wie der Tagesspiegel erfahren hat, will sich heute Abend der Parteivorstand und die komplette Bundestagsfraktion virtuell zusammenzuschalten, um zu besprechen, wie man mit der politischen Lage umgeht. Ein weiteres Treffen mit der gleichen Besetzung soll auch am Montagabend stattfinden.
Kaweh Mansoori, Mitglied des SPD-Parteivorstands und stellvertretender Ministerpräsident in Hessen, sagte dem Tagesspiegel: „Das Maß an Verantwortungslosigkeit gegenüber unseren demokratischen Institutionen und die Rücksichtslosigkeit gegenüber einer hochverdienten und angesehenen Juristin seitens der Union ist inakzeptabel.“
Zuvor hatte bereits SPD-Chef Lars Klingbeil mit deutlichen Worten seinen Unmut geäußert. „Führung und Verantwortung sind nichts für Sonntagsreden. Sondern wenn hier strittige Abstimmungen sind, dann muss es Führung und Verantwortung auch geben“, sagte der Bundesfinanzminister in einer Haushaltsrede im Bundestag.
Klingbeil fügte hinzu, er wolle eine „sehr klare Erwartung formulieren: Wenn wir dieses Land durch schwierige Zeiten durchmanövrieren wollen, (...) dann heißt das auch, dass man manch schwierige Entscheidung mittragen muss“. Beim Eklat um die Richterwahl sei der traditionelle breite Konsens der demokratischen Mitte im Parlament gebrochen worden.
Wegen massiven Widerstands in der Unionsfraktion gegen die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf wurden die Abstimmungen über die insgesamt drei Vorschläge für das Bundesverfassungsgericht kurzfristig von der Tagesordnung genommen. In der Unionsfraktion gab es Vorbehalte gegen die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf, unter anderem wegen ihrer aus Sicht mancher Abgeordneter zu liberalen Haltung zu Abtreibungen.
Klingbeil sagte, die Gleichheit der Geschlechter und das Selbstbestimmungsrecht der Frauen hätten in Deutschland zu Recht Verfassungsrang. „Das zu schützen ist übrigens Aufgabe von Richterinnen und Richtern, erst recht am Bundesverfassungsgericht.“
Es habe in Deutschland immer Kontroversen zum Paragraphen 218 und zu Fragen der Abtreibung gegeben. Die SPD habe eine klare Position. „Aber wir respektieren andere Meinungen.“ Das Land gehe „kaputt“, wenn politische Debatten immer nach dem Motto geführt würden: Wer nicht zu 100 Prozent der eigenen Meinung sei, sei ein Gegner, so der SPD-Chef.
„Wenn eine Richterin eine kritische Position zu 218 hat, dann ist das mehr als legitim in unserem Land. Das Bundesverfassungsgericht ist eine der wichtigsten Institutionen unseres Landes, und es lebt von Unabhängigkeit und von Vertrauen“, sagte Klingbeil. Es habe im Bundestag immer einen breiten Konsens der demokratischen Mitte gegeben zur Ernennung von Richterinnen und Richtern. „Und das ist heute nicht passiert.“
Wiese spricht von „Hetzjagd“ gegen Brosius-Gersdorf
Noch drastischer formulierte es der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese. „Es ist kein guter Tag für die Demokratie in diesem Land“, sagte Wiese am Freitag im Bundestag. Er sprach von einer Hetzjagd gegen Frauke Brosius-Gersdorf.
Wiese machte seine Unzufriedenheit mit dem Vorgehen der Union deutlich. Denn am Montag habe es im Richterwahlausschuss noch eine Mehrheit für alle drei Kandidaten gegeben. Am Freitagmorgen hatte die Union dann vorgeschlagen, die Abstimmung über Brosius-Gersdorf wegen angeblicher Plagiatsverdachtes zu verschieben.
Er macht Unionsfraktionschef Jens Spahn und Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) direkt für die geplatzte Richterwahl verantwortlich. „Was wir hier heute erlebt haben und in den letzten Tagen, ist ein Hinweis auf fehlende Durchsetzungskraft in der eigenen Fraktion von Jens Spahn, aber auch von Friedrich Merz“, sagte Wiese, der Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion ist.
„Was wir an dem heutigen Tag zudem erleben, ist eine Beschädigung des Bundesverfassungsgerichtes, die ich mir in dieser Form nicht hätte vorstellen können“, sagte Wiese.
Weiter sagte Wiese: „Manches kommt zeitversetzt über den Atlantik, aber dass wir hier Debatten haben wie beim Supreme Court, wie bei der Besetzung der Richterstellen in Polen, dass das in so einer Art und Weise auch heute hier einzieht, hätte ich mir nicht träumen lassen.“
Er kritisierte, es gebe Beeinflussung „von Rechtsauslegern, rechten Nachrichtenportalen und auch Vertretern der katholischen Kirche, deren Einmischung ich für absolut inakzeptabel halte“.
Drohungen gegen Kandidatin
Wiese mache deutlich, dass die SPD nicht auf Distanz zu Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf geht – im Gegenteil. „Ich gehe davon aus, dass sich die Plagiatsvorwürfe, so wie ich es jetzt wahrnehme, nicht bestätigen werden. Das war ja zum Schluss der Grund der Union, diesem Wahlvorschlag heute nicht zuzustimmen, beziehungsweise sich zu enthalten“, sagte er.
In den vergangenen Tagen habe es für Brosius-Gersdorf große Belastungen gegeben. „Eine hoch angesehene Staatsrechtlerin wird verleumdet und kriegt Morddrohungen nach Hause. Gestern musste der Lehrstuhl an der Universität geräumt werden wegen der Bedrohungslage“, sagte Wiese. Das seien beispiellose Grenzüberschreitungen im Hinblick auf die Staatsrechtlerin, aber auch das Bundesverfassungsgericht als angesehenste Institution des Landes.
Wir halten an unseren Kandidatinnen fest. Ich erwarte, dass die Mehrheit steht.
Matthias Miersch, SPD-Fraktionschef
Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch will weiter an Brosius-Gersdorf festhalten und schließt eine Lösung über einen Kompromisskandidaten mit der Union praktisch aus: „Für mich ist klar: Wir halten an unseren Kandidatinnen fest. Ich erwarte, dass die Mehrheit steht“, schrieb Miersch in einer persönlichen Erklärung zum Beginn der parlamentarischen Sommerpause.
Die gelte zumal, da Vorwürfe eines Plagiats von dem eigentlichen Verfasser nicht aufrechterhalten würden. Eine herausragende Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht mit einwandfreiem Werdegang und bester Qualifikation sei „Opfer einer beispiellosen Schmutzkampagne“ geworden, betonte Miersch und stellte sich damit vor die Jura-Professorin Frauke Brosius-Gersdorf.
„Der heutige Tag hätte sich nie so abspielen dürfen, gerade weil wir unsere Kandidatinnen mit der Unionsführung abgestimmt haben. Wir haben uns auf den gemeinsamen Vorschlag geeinigt“, schreibt Miersch. Entsprechend habe der gemeinsame Vorschlag am Montag die nötige Zweidrittelmehrheit im Richterwahlausschuss erhalten.
Es ist buchstäblich brandgefährlich.
Manja Schüle (SPD), Brandenburgs Wissenschaftsministerin
Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) und frühere SPD-Bundestagsabgeordnete, schrieb bei Facebook: „Ich will den Erfolg der Großen Koalition im Bund. Deshalb behalte ich für mich, was ich als Staatsbürgerin von dem halte, was die Unionsfraktion heute im Bundestag abgeliefert hat.“ Sie nannte den Umgang mit der Juristin Brosius-Gersdorf „völlig inakzeptabel“.
Schüle warnte vor amerikanischen Verhältnissen. „Wir dürfen und müssen inhaltlich streiten, auch wenn wir in einer gemeinsamen Koalition sind. Aber es ist buchstäblich brandgefährlich, die wissenschaftliche Integrität einer hoch angesehenen Expertin anzuzweifeln, wenn einem politische Argumente fehlen.“
Die Grünen legen Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) nun den Rückzug von seinem Amt nahe. Spahn habe es nicht geschafft, seine Fraktion hinter den auch von ihm mitgetragenen Vorschlag zur Berufung dreier Richterinnen und Richter zum Bundesverfassungsgericht zu bringen, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann in Berlin.
Die Fraktion „läuft ihm davon und auch dem Kanzler, und das ist nicht nur ein Ansehensverlust, das beschädigt ihn auch in seiner Autorität als Fraktionsvorsitzender so erheblich, dass ich mich frage, ob er sein Amt ausführen kann“, sagte die Grünen-Politikerin.
Sie sagte auch: „Dieser Tag heute ist ein Desaster für das Parlament, ist vor allen Dingen ein Desaster für Jens Spahn und Friedrich Merz und mit ihnen die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD.“ Der Richterwahlausschuss habe mit Zweidrittelmehrheit die drei Kandidatinnen und Kandidaten von Union und SPD gewählt und dem Plenum des Bundestags vorgelegt. Spahn habe auch zusammen mit SPD-Fraktionschef Matthias Miersch bei den Grünen für die drei Vorschläge geworben.
Haßelmann macht Spahn verantwortlich
Dass nun die größte Regierungsfraktion, nämlich die Union, einer einzelnen Kandidatin die Unterstützung entziehe, sei ein Vorgang, den man so noch nie erlebt habe, sagte Haßelmann. „Dafür trägt allen voran Jens Spahn die Verantwortung.“ Sie sprach von einem „absoluten Versagen“.
Die Art, wie hier eine Kandidatin verunglimpft wird, ist absolut indiskutabel.
Franziska Brantner, Grünen-Chefin
Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner sagte: „Es ist erschütternd, wie leichtsinnig das Vertrauen in das höchste deutsche Gericht beschädigt wird. Die Art, wie hier eine Kandidatin verunglimpft wird, ist absolut indiskutabel.“ Auch Brantner sagte, hier zeige sich, „dass Jens Spahn entweder nicht fähig oder Willens ist, sein Amt als Fraktionsvorsitzender auszufüllen“.
AfD spricht von „Regierungskrise“
Die AfD sieht nach der Verschiebung der Wahl von den Verfassungsrichtern eine „Regierungskrise“. „Es zeigt sich einmal mehr, dass wir es hier mit einer instabilen Koalition zu tun haben“, sagte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Zugleich zeigte sich Co-Fraktionschef Tino Chrupalla erleichtert, dass die Wahl vorerst nicht stattfand.
Union und SPD hätten Kandidaten aufgestellt, die nicht mehrheitsfähig gewesen seien, sagte Chrupalla. „Und deshalb ist es heute auch ein guter Tag, dass diese Wahlen in Gänze abgesetzt wurden.“ Die AfD wünsche sich, dass nicht dieselben Kandidaten noch einmal aufgestellt würden, vor allen Dingen nicht jene der SPD, fügte er hinzu.
Linke bezichtigt Union der Annäherung an AfD
Die Linke wiederum wirft der Union eine Annäherung an die AfD vor. „Wie die Union die von ihrer Koalitionspartnerin vorgeschlagene Kandidatin attackiert und diskreditiert, ist unwürdig“, erklärte Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek schriftlich. „In trauter Einigkeit mit Rechtspopulisten und Rechtsextremisten hat die Union eine Kampagne gefahren, die nicht weniger als skandalös ist.“
In einem Statement im Bundestag ergänzte Reichinnek, Unionsfraktionschef Jens Spahn habe für den Richtervorschlag der Union bewusst Stimmen der AfD in Kauf genommen. „Für mich zeichnet sich am Horizont auch nach heute immer deutlicher eine blau-schwarze Koalition ab“, sagte Reichinnek.
Mehr auf Tagesspiegel.de
Klöckner für neuen Anlauf im September Wie es mit der Wahl der Verfassungsrichter weitergehen könnte
Koalition vertagt Richterwahl Wie es zur Absage der Abstimmung kam
Richterwahl ist Sache des Bundestages Wo Julia Klöckner dann mal recht hat
Die Regierungsfraktionen Union und SPD haben im Bundestag beantragt, alle am Freitag geplanten Wahlen für Richter beim Bundesverfassungsgericht abzusetzen. Dies teilte Bundestagsvizepräsidentin Josephine Ortleb (SPD) am Freitag mit. Auch die Grünen verlangten demnach in einem eigenen Antrag, die Richterwahlen von der Tagesordnung zu nehmen. Zuvor war die Sitzung mehr als eine Stunde unterbrochen. (Tsp mit dpa, AFP, Reuters)
https://www.tagesspiegel.de/
Ehemalige Grünen-Chefin bricht Schweigen
"Kein Zufall": Baerbock solidarisiert sich mit Brosius-Gersdorf
Von
t-online
,
afp
11.07.2025
Annalena Baerbock: Die ehemalige Grünen-Chefin meldet sich nach langer Pause wieder auf X zu Wort. (Quelle: Valentyn Ogirenko/reuters)
Nach der ausgesetzten Wahl solidarisieren sich immer mehr Politiker mit Frauke Brosius-Gersdorf. Annalena Baerbock berichtet von ähnlichen Erfahrungen.
Die ehemalige Grünen-Chefin und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich zu der gescheiterten Wahl der Bundesverfassungsrichter geäußert. Ohne Namen zu nennen, nahm sie dabei SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf in Schutz und kritisierte den selbst ernannten "Plagiatsjäger" Stefan Weber. Dieser hatte in der Vergangenheit auch gegen Baerbock Plagiatsvorwürfe erhoben.
- Plagiat? Diese Anschuldigung gibt es gegen Frauke Brosius-Gersdorf
- "Skandalös": So reagiert die Politik auf die gestrichene Wahl
- Kommentar: Chaos um Verfassungsrichterwahl – So kann das nicht weitergehen
In mehreren Einträgen auf X schrieb Baerbock am Freitag: "Kein Zufall, mit welch diskreditierenden Methoden (erneut) eine hochqualifizierte Frau zu Fall gebracht werden soll. Kein Zufall, dass es ausgerechnet diejenige trifft, die für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen eintritt. Kein Zufall, dass es dieselben rechten Plattformen sind, die vor kurzem eine renommierte Journalistin in den Selbstmordversuch trieben."
Baerbock vermutet gar eine Kampagne hinter der verhinderten Richterwahl: "Kein Zufall, dass es erneut bei der Wahl einer Verfassungsrichterin passiert. Es geht um mehr als um eine Richterin. Es geht um Artikel 3 des Grundgesetzes. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin." Die Posts sind Baerbocks erste Wortmeldung auf X seit Ende Februar.
Weber will ohne Auftrag gearbeitet haben
Der selbst ernannte "Plagiatsjäger" Stefan Weber ist Privatdozent und Autor mehrerer Bücher zu den Themen Plagiate und Medien. Recherchen des "Spiegel" zufolge soll er sich jahrelang an Hochschulen auf Professuren beworben haben – ohne Erfolg. Seit 2002 beschäftigt er sich mit der Plagiatsprüfung. In vielen Fällen bestätigten sich seine Plagiatsvorwürfe nicht.
Stefan Weber (Archivbild): Der "Plagiatsjäger" ist höchst umstritten.
Vergrößern des Bildes
Stefan Weber (Archivbild): Der "Plagiatsjäger" ist höchst umstritten. (Quelle: imago-images-bilder)
Für Kritik sorgte 2024 auch sein Vorgehen gegen die damalige stellvertretende Chefredakteurin der "Süddeutschen Zeitung", Alexandra Föderl-Schmid. Weber untersuchte im Auftrag des rechtsgerichteten Internetportals Nius die Dissertation und mehrere Artikel der Journalistin und warf ihr anschließend massive Plagiate vor. Föderl-Schmid zog sich aus der Chefredaktion zurück, galt sogar vorübergehend als vermisst. Am Ende wurden die Vorwürfe widerlegt, die Reputation Föderl-Schmids blieb aber beschädigt.
Mehr zum Thema
Am Freitag sollte der Bundestag eigentlich drei neue Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht wählen, darunter die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Die Union forderte jedoch kurz vorher die Absetzung ihrer Wahl – auch wegen angeblicher Plagiatsvorwürfe. Diese hatte Weber am Donnerstagabend erhoben. Er fand nach eigenen Angaben "23 Textparallelen" zwischen Brosius-Gersdorfs Dissertation aus dem Jahr 1997 und der Habilitationsschrift ihres Mannes, des Juristen Hubertus Gersdorf von 1998. Die wissenschaftlichen Arbeiten des Ehepaars will er dabei ohne Auftraggeber untersucht haben.
https://www.t-online.de/
„Stellungnahme zur Causa „Frauke Brosius-Gersdorf“
14.07.2025
Als Vertreterinnen und Vertreter der universitären – insbesondere rechtswissenschaftlichen – Forschung und Lehre sowie der Justiz protestieren wir nachdrücklich gegen die Art und Weise, wie im Rahmen der Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht in der Politik und in der Öffentlichkeit mit Frauke Brosius-Gersdorf umgegangen wurde. Dieser Umgang ist geeignet, die Kandidatin, die beteiligten Institutionen und mittelfristig über den Verfall der angemessenen Umgangskultur die gesamte demokratische Ordnung zu beschädigen.
Zunächst ist zu betonen, dass Frauke Brosius-Gersdorf eine hoch angesehene Staatsrechtslehrerin ist. Das ist in Fachkreisen völlig unstreitig. Alle Äußerungen, die ihre wissenschaftliche Reputation in Frage stellen, sind daher schlicht unzutreffend und unsachlich. Das schließt es selbstverständlich nicht aus, dass man einzelne ihrer juristischen Positionen kritisieren oder andere Meinungen vertreten kann. Darstellungen aber, die diese Positionen als von vornherein abseitig oder radikal einordnen, sind jedenfalls durch Unkenntnis der rechtswissenschaftlichen Diskussion geprägt. Äußerungen einzelner Bundestagsabgeordneter, ihre Universität möge aufgrund dieser Positionen Maßnahmen gegen Frauke Brosius-Gersdorf ergreifen, stellen einen Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit selbst dar.
Im Rahmen des Nominierungsprozesses können zwar selbstverständlich sowohl die – hier aber ohne Zweifel bestehende – fachliche Qualifikation als auch einzelne zuvor geäußerte Ansichten der Kandidatinnen und Kandidaten zum Gegenstand gemacht und kritisiert werden. Umso wichtiger ist es dann aber, dass im Zuge dieses Prozesses die beteiligten Personen und Institutionen nicht beschädigt werden. Im Richterwahlausschuss eine Kandidatin zunächst zu bestätigen, um dann gegenüber ideologisierten Lobbygruppen und mit Unwahrheiten und Diffamierungen gespickten Kampagnen zurückzurudern, zeugt zumindest von fehlendem politischem Rückgrat und mangelnder interner Vorbereitung. Dass dann ausgesprochen unglaubhafte Plagiatsvorwürfe als Vorwand für eine Vertagung herhalten müssen und dadurch eine weitere Beschädigung der Kandidatin in Kauf genommen wird, ist ein Angriff auf das Ansehen der Wissenschaft und ihrer Vertreterinnen und Vertreter.
Das Bundesverfassungsgericht und die deutsche Staatsrechtslehre haben ihr hohes – auch internationales – Ansehen nicht zuletzt durch die wohl einzigartige Verbindung von Verfassungspraxis und Verfassungsrechtswissenschaft gewonnen. Dies setzt aber voraus, dass Rechtswissenschaftler und Rechtswissenschaftlerinnen, die sich an dieser Praxis beteiligen sollen, von der Politik vor Herabwürdigung geschützt werden. Im Fall von Frauke Brosius-Gersdorf ist dies den dafür verantwortlichen Personen und Institutionen bisher nicht gelungen.“
Beck, Susanne, Prof.’in Dr. LL.M. (LSE), Universität Hannover
Huster, Stefan, Prof. Dr., Ruhr-Universität Bochum
Thiele, Alexander, Prof. Dr., Business & Law School Berlin
➡️Abraham, Markus, PD Dr., Universität Hamburg
➡️Achenbach, Jelena, Prof.’in Dr., LL.M. (NYU), Universität Erfurt
➡️Ackermann, Thomas, Prof. Dr., LMU München
➡️Ahrends, Franziska, Ass. jur., Universität Osnabrück
➡️Ahrens, Martin, Prof BR. Dr., Universität Göttingen
➡️Aktas, Belgin, Universität Konstanz
➡️Albrecht, Anna H., Prof.’in, Universität Potsdam
➡️Ambos, Kai, Prof. Dr. Dr. h.c., Universität Göttingen
➡️Anderheiden, Michael, Prof. Dr., Andrásy Universität Budapest/Universität Heidelberg
➡️Apolinário Oliveira, Elisabete, Universität Marburg
➡️Arnauld, Andreas von, Prof. Dr., Universität Kiel
➡️Asholt, Martin, Prof. Dr., Universität Bielefeld
➡️Ashrafzadeh Kian, Shaghayegh, Dr., Universität Göttingen
➡️Aust, Helmut Philipp, Prof. Dr., FU Berlin
➡️Baer, Susanne, Prof.’in Dr., LL.M., Richterin des Bundesverfassungsgerichts a.D., HU Berlin
➡️Battis, Ulrich, Prof. Dr. Dr. h.c, HU Berlin
➡️Bauer, Hartmut, Prof. Dr., Universität Potsdam
➡️Bäumler, Jelena, Prof.’in Dr., LL.M. (UWC), Universität Lüneburg
➡️Becker, Christian, Prof. Dr., Universität Bremen
➡️Bernstorff, Jochen von, Prof. Dr., LL.M., Universität Tübingen
➡️Blocher, Janine, Universität Konstanz
➡️ Bock, Stefanie, Prof.’in, Universität Marburg
➡️Boddin, Maximilian, Université de Fribourg
➡️Boehm, Monika, Prof.’in, Universität Marburg
➡️Boele-Woelki, Katharina, Prof.’in Dr., Bucerius Law School B
➡️ Bögelein, Nicole, PD’in Dr., Universität zu Köln
➡️Böhm, Monika, Prof.’in Dr., Universität Marburg
➡️Börner, René, Prof. Dr., BSP Business and Law School
➡️Boysen, Sigrid, Prof.’in Dr., Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
➡️Brand, Gwendolin, Dipl. Jur.’in LL.B., Universität zu Köln
➡️Breuer, Marten, Prof. Dr., Universität Konstanz
➡️Britz, Gabriele, Prof.’in, BVR´in a.D., Universität Frankfurt am Main
➡️Brodowski, Dominik, Prof. Dr., LL.M. (UPenn), Universität des Saarlandes
➡️Brüning, Janique, Prof.’in Dr., Universität Kiel
➡️Bublitz, Christoph, Dr., Universität Hamburg
➡️Bull, Hans Peter, Prof. Dr., Universität Hamburg
➡️Bülte, Jens, Prof. Dr., Universität Mannheim
➡️Bumke, Christian, Prof. Dr., Bucerius Law School
➡️Bung, Jochen, Prof. Dr. Universität Hamburg
➡️Burchard, Christoph, Prof. Dr. LL.M. (NYU), Universität Frankfurt a.M.
➡️Burghardt, Boris, Prof. Dr., Universität Marburg
➡️Butzer, Hermann, Prof. Dr., Universität Hannover
➡️Buyx, Alena, Prof. Dr., TU München
➡️Cancik, Pascale, Prof.’ in Dr., Universität Osnabrück
➡️Çelebi, Dilken, Universität Münster
➡️Chebout, Lucy, Dr., M.A., HU Berlin
➡️Chiofalo, Valentina, FU Berlin
➡️Conze, Eckart, Prof. Dr., Universität Marburg
➡️Danker, Claudia, Prof.’in Dr., Hochschule Stralsund
➡️Davy, Ulrike, Prof.’in Dr., Universität Bielefeld
➡️Deister, Sören, Dr., Universität Hamburg
➡️Denga, Michael, Prof. Dr., BSP Business and Law School
➡️Dern, Susanne, Prof.’in, Hochschule Fulda
➡️Dethloff, Nina, Prof’in Dr., LL.M. (Georgetown), Universität Bonn
➡️Dietz, Laura, Dipl.Jur.’in, Universität Hannover
➡️Dorneck, Carina, Prof.’in Dr. M. Mel., Universität Trier
➡️Dörr, Oliver, Prof. Dr., LL.M., Universität Osnabrück
➡️Dreier, Horst, Prof. Dr., Universität Würzburg
➡️Drenkhahn, Kirstin, Prof.’in, FU Berlin
Effer-Uhe, Daniel, Prof. Dr., BSP Business and Law School
➡️Egidy, Stefanie, Prof.’in Dr., Universität Mannheim
➡️Eichenhofer, Johannes, Prof. Dr., Universität Leipzig
➡️Eisenhardt, Annika, Dipl. Jur.’in, Universität Osnabrück
➡️El Hassan, Paiman, Universität Mainz
➡️El-Ghazi, Mohamad, Prof. Dr., Universität Trier
➡️Elsuni, Sarah, Prof.’in, Frankfurt University of Applied Sciences
➡️Enders, Christoph, Prof. Dr., Universität Leipzig
➡️Engländer, Armin, Prof. Dr., LMU München
➡️Ennuschat, Jörg, Prof. Dr., Ruhr-Universität Bochum
➡️Epik, Aziz, Prof. Dr., LL.M., Universität Hamburg
➡️Epping, Volker, Prof. Dr. Universität Hannover
➡️Ernst, Christian, Prof. Dr., HSU Hamburg
➡️Farthofer, Hilde, Priv.-Doz.’in, FAU Erlangen-Nürnberg
➡️Fateh-Moghadam, Bijan, Prof. Dr., Universität Basel
➡️Fehling, Michael, Prof. Dr., LL.M., Bucerius Law School
➡️Feichtner, Isabel, Prof.’in Dr., LL.M. (Cardozo), Universität Würzburg
➡️Felix, Dagmar, Prof.’in Dr., Universität Hamburg
➡️Fornasier, Matteo, Prof. Dr., Ruhr-Universität Bochum
➡️Frankenberg, Günter, Prof. Dr. Dr. em., Goethe-Universität Frankfurt am Main
➡️Franzius, Claudio, Prof. Dr., Universität Bremen
➡️Frau Robert, Prof. Dr., TU Berg Akademie Freiberg
➡️Frister, Helmut, Prof. Dr., Universität Düsseldorf
➡️Funke, Andreas, Prof. Dr., Universität Erlangen-Nürnberg
➡️Gaede, Karsten, Prof. Dr., Bucerius Law School
➡️Geis, Max-Emanuel, Prof. Dr., Universität Erlangen-Nürnberg
➡️Geneuss, Julia, Prof.’in Dr. LL.M. (NYU), Universität Potsdam
➡️Germelmann, Claas Friedrich, Prof. Dr., Universität Hannover
➡️Gisbertz-Astolfi, Philipp, Dr. Dr., Universität Göttingen
➡️Gmelin, Lena, Universität Konstanz
➡️Goeckenjan, Ingke, Prof.’in Dr., Universität Bochum, RiOLG
➡️Goldhammer, Michael. Prof. Dr., LL.M. (Michigan), EBS Universität für Wirtschaft und Recht
➡️Goos, Christoph, Prof. Dr., Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
➡️Götze, Roman, Prof. Dr., Hochschule Harz
➡️Gräb Schmidt, Elisabeth, Prof.’in Dr., Universität Tübingen
➡️Groh, Kathrin, Prof.’in Dr., Universität der Bundeswehr München
➡️Gruber, Franziska, Philipps-Universität Marburg
➡️Grünberger, Michael, Prof. Dr., LL.M. (NYU), Bucerius Law School
➡️Gsell, Beate, Prof.’in Dr., LMU München
➡️Gutmann, Thomas, Prof. Dr., Universität Münster
➡️Hahn, Johanna, Dr. LL.M. (Harvard), Universität Erlangen-Nürnberg
➡️Hähnchen, Susanne, Prof.’in, Universität Potsdam
➡️Haisch, Verena, djb Hamburg
Hanschmann, Felix, Prof. Dr., Bucerius Law School
➡️Haratsch, Andreas, Prof. Dr., FernUniversität in Hagen
➡️Harrer, Teresa, Fernuniversität Hagen
➡️Haug, Laila, Universität Konstanz
➡️Haverkamp, Rita, Prof.’in Dr., Universität Tübingen
➡️Heiderhoff, Bettina, Prof.‘in Dr., Universität Münster
➡️Heinrich, Bernd, Prof. Dr., Universität Tübingen
➡️Henking, Tanja, Prof.’in Dr., LL.M., Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
➡️Henn, Wolfram, Prof. Dr., Universität Homburg/Saar
➡️Hermes, Georg, Prof. Dr., Universität Frankfurt am Main
➡️Hestermeyer, Holger, Prof. Dr., LL.M. (Berkeley), Diplomatische Akademie Wien
➡️Höffler, Katrin, Prof.’in, HU Berlin
➡️Hoffmann-Riem, Wolfgang, Prof. Dr., Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D., Bucerius Law-School
➡️Hofmann, Rainer, Prof. Dr. Dr., Universität Frankfurt am Main
➡️Hohenstatt, Klaus, Prof. Dr., Bucerius Law-School
➡️Hörnle, Tatjana, Prof.’in Dr., M.A. (Rutgers), Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht
➡️Hoven, Elisa, Prof.’in Dr., Universität Leipzig, RiVGH Sachsen
➡️Hufen, Friedhelm, Prof. Dr., Universität Mainz
➡️Ibold, Victoria, PD’in Dr., Universität Halle-Wittenberg
➡️Jakobi, Luis, Universität Konstanz
➡️Jansen, Nils, Prof. Dr., Universität Münster
➡️Kaltenborn, Markus, Prof. Dr., Ruhr-Universität Bochum
➡️Karakoc, Reyhan Esra, Dipl. Jur.’in, Universität Hannover
➡️Kaspar, Johannes, Prof. Dr., Universität Augsburg
➡️Kemme, Stefanie, Prof.’in Dr. iur. Dipl.Psych.’in, Universität Münster
➡️Kießling, Andrea, Prof.’in Dr., Universität Frankfurt am Main
➡️Kingreen, Thorsten, Prof. Dr., Universität Regensburg
➡️Klein, Laura Anna, Dr., Johannes Gutenberg-Universität Mainz
➡️Klesczewski, Diethelm, Prof. Dr., Universität Leipzig
➡️Klinck, Fabian, Prof. Dr., Ruhr-Universität Bochum
➡️Knauff, Matthias, Prof. Dr., LL.M. Eur., Universität Jena
➡️Kocak, Aleyna, Universität Konstanz
➡️Koch, Thorsten, Prof. Dr., Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
➡️Kölbel, Ralf, Prof. Dr., Universität München
➡️Kotzur, Markus, Prof. Dr., LL.M. (Duke Univ.), Universität Hamburg und Europa-➡️Kolleg Hamburg
➡️Kraft, Julia, Prof.’in, LL.M. (KU Leuven), Universität Potsdam
➡️Krajewski, Markus, Prof. Dr., Universität Erlangen-Nürnberg
➡️Krämer-Hoppe, Rike, Prof.’in Dr., Universität Regensburg
➡️Krell, Paul, Prof. Dr., Bucerius Law School
➡️Krieger, Heike, Prof. Dr., FU Berlin
➡️Kuch, David, Prof. Dr., Universität Konstanz
➡️Kühling, Jürgen, Prof. Dr., Universität Regensburg
➡️Kupka, Alexandra, Dipl. Jur.’in, Universität Hannover
➡️Kuschel, Linda, Prof.’in Dr., Bucerius Law School
➡️Lange, Pia, Prof.’in, LL.M. (UCT), Universität Bremen
➡️Lanzerath, Dirk, Prof. Dr., Universität Bonn
➡️Lehlbach, Leonie Kristin, Dipl. Jur.’in, Universität Göttingen
➡️Lepsius, Oliver, Prof. Dr., LL.M. (Chicago), Universität Münster
➡️Lettl, Tobias, Prof. Dr., Universität Potsdam
➡️Lindemann, Michael, Prof. Dr., Universität Bielefeld
➡️Mangold, Anna-Katharina, Prof.’in Dr., LL.M. (Cambridge), Universität Flensburg
➡️Marckmann, Georg, Univ.-Prof. Dr., MPH, Universität München
➡️Martinez, José, Prof. Dr., Universität Göttingen
➡️Mauritz, Franziska, Richterin, Hamburg
➡️Meder, Stephan, Prof. Dr., Universität Hannover
➡️Mehde, Veit, Prof. Dr. Mag. rer. publ., Universität Hannover
➡️Meier, Bernd-Dieter, Prof. Dr., Universität Hannover
➡️Meier, Sonja, Prof.’in Dr. LL.M. (London), Universität zu Köln
➡️Meinel, Florian, Prof. Dr., Universität Göttingen
➡️Merkel, Grischa, Prof.’in Dr., Universität Greifswald
➡️Michaels, Ralf, Prof. Dr., LL.M. (Cambridge), Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht
➡️Möhlmann, Merle, Dipl. Jur.’in, Universität Osnabrück
➡️Momsen, Carsten, Prof. Dr., Freie Universität Berlin
➡️Morgenstern, Christine, Prof.’in, Ruhr-Universität Bochum
➡️Morlok, Matin, Prof. Dr., Universität Düsseldorf
➡️Müller-Mall, Sabine, Prof.’in, TU Dresden
Münkler, Laura, Prof.’in Dr., Universität Bonn
➡️Nalik, Tabea, BSP Business and Law School
➡️Neubacher, Frank, Prof. Dr. M.A., Universität zu Köln
➡️Neubert, Wendelin, Dr., BSP Business and Law School
➡️Nida-Rümelin, Julian, Prof. Dr. phil. Dr. h.c., Staatsminister a. D.
➡️Niehaus, Manuela, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
➡️Nussbaum, Maximilian, Dr. LL.M. (Hannover), Universität Hannover
➡️Oğlakcıoğlu, Mustafa Temmuz, Prof. Dr., Universität des Saarlands, RiOLG
➡️Oppermann, Bernd, Prof. Dr. Dr. h.c. LL.M. (UCLA), Universität Hannover
➡️Paulus, Andreas L., Prof. Dr. Dr. h.c., Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D., Universität Göttingen
➡️Peters, Anne, Prof.’in Dr. Dr. h.c. mult., LL.M., Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
➡️Petersen, Niels, Prof. Dr., Universität Münster
➡️Pichl, Maximilian Prof. Dr. Dr., Hochschule RheinMain
➡️Pielow, Johann-Christian, Prof. Dr., Ruhr-Universität Bochum
➡️Pieroth, Bodo, Prof. Dr., Universität Münster
➡️Pohlreich, Erol, Prof. Dr., Universität Frankfurt a.d.O.
➡️Pollmann, Arnd, Prof. Dr., Alice-Salomon-Hochschule Berlin
➡️Preetz, Nicolai, Dr., Universität Konstanz
Pünder, Herrmann, Prof. Dr., LL.M. (Iowa), Bucerius Law School
➡️Puschke, Jens, Prof. Dr., Universität Marburg
➡️Quante, Michael, Prof. Dr., Universität Münster
➡️Rademacher, Timo, Prof. Dr. M.Jur. (Oxford), Universität Hannover
➡️Rauber, Jochen, Prof. Dr., Universität Hannover
➡️Remé, Johann, Dr., Universität Potsdam
➡️Renda, Anna, Universität Konstanz
➡️Riedel, Eibe, Prof. Dr., LL.B. (London), Universität Mannheim
➡️Risini, Isabella, Prof.’in, Technische Hochschule Georg Agricola
➡️Röhner, Cara, Prof.’in, Hochschule RheinMain
➡️Rosenau, Henning, Prof. Dr., Universität Halle-Wittenberg
➡️Rux, Johannes, Prof. Dr., Universität Tübingen
➡️Sacksofsky, Ute, Prof.’in Dr. h.c., M.P.A. (Harvard), Goethe-Universität Frankfurt
➡️Salloch, Sabine, Prof.’in Dr., Medizinische Hochschule Hannover
➡️Sanders, Anne, Prof.’in, Universität Bielefeld
➡️Šarčević, Edin, Prof. Dr., Universität Leipzig
➡️Schefold, Dian, Prof. Dr., Universität Bremen
➡️Scheiwe, Kirsten, Prof.’in, Universität Hildesheim
➡️Scheliha, Henrike von, Prof.’in, Bucerius Law School
➡️Schiedermair, Stephanie, Prof.’in Dr., Universität Leipzig
➡️Schiemann, Anja, Prof.’in Dr., Universität zu Köln
➡️Schladebach, Marcus, Prof. Dr., LL.M., Universität Potsdam
➡️Schmidt, Anja, PD’in Dr., Universität Lüneburg
➡️Schmidt, Lara, BSP Business and Law School
➡️Schmitt-Leonardy, Charlotte, Prof.’in Dr., Universität Bielefeld
➡️Schöndorf-Haubold, Bettina, Prof.’in Dr., Universität Gießen
➡️Schöne-Seifert, Bettina, Prof.’in em. Dr., Universität Münster
➡️Schramm, Jonathan, Pressesprecher der Bucerius Law School
➡️Schuchmann, Inga, Dr., HU Berlin
➡️Schuler-Harms, Margarete, Prof.’in Dr., Universität der Bundeswehr Hamburg
➡️Schulze-Fielitz, Helmuth, Prof. Dr., Universität Würzburg
➡️Schumann, Antje, apl. Prof.’in, Universität Leipzig
➡️Schumann, Eva, Prof.’in, Georg-August-Universität Göttingen
➡️Schwarz, Sebastian, Bucerius Law School
➡️Schwarz-Ladach, Juliane, Dr., Universität Rostock
➡️Schwarze, Roland, Prof. Dr., Universität Hannover
➡️Schweigler, Daniela, Prof.’in, Universität Duisburg-Essen
➡️Seckelmann, Margrit, Prof.’in Dr., M.A., Leibniz-Universität Hannover
➡️Seibt, Christoph H., Prof. Dr., LL.M. (Yale), Bucerius Law School
➡️Simon, Judith, Prof.’in Dr. Universität Hamburg
➡️Singelnstein, Tobias, Prof. Dr., Universität Frankfurt a.M.
➡️Solomon, Dennis, Prof. Dr. Dr. h.c., LL.M. (Berkeley), Universität Passau
➡️Starski, Paulina, Prof.’in Dr., LL.B., Universität Freiburg
➡️Stefanopoulou, Georgia, Prof.’in Dr., BSP Business & Law School Berlin
Steiger, Dominik, Prof. Dr., Technische Universität Dresden
➡️Steinberg, Georg, Prof. Dr., Universität Potsdam
➡️Steinberg, Rudolf, Prof. Dr., em. Präsident der Goethe-Universität Frankfurt am Main
➡️Steinl, Leonie, Jun.-Prof.’in Dr. LL.M., Universität Münster
➡️Steinrötter, Björn, Prof. Dr., Universität Potsdam
➡️Stoll, Peter-Tobias, Prof. Dr. Dr. h.c., Universität Göttingen
➡️Strewe, Stefan Ansgar, esb Rechtsanwälte, RiVGH Sachsen
➡️Stübinger, Malte, Dr., Syndikusrechtsanwalt Hamburg
➡️Suchrow-Köster, Martin, Dr., Universität Hannover
➡️Swoboda, Sabine, Prof.’in Dr., Universität Bochum
➡️Tabbara, Tarik, Prof. Dr., LL.M. (McGill), Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
➡️Temming, Felipe, Prof. Dr., Universität Hannover
➡️Teufel, Magdalena, Ass.’in Jur., Uni Heidelberg
➡️Thielbörger, Pierre, Prof. Dr., M.PP. (Harvard), Ruhr-Universität Bochum
➡️Thöne, Meik, Prof. Dr., M.Jur. (Oxford), Universität Potsdam
➡️Tomerius, Carolyn, Prof. Dr., Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
➡️Truger, Achim, Prof. Dr., Universität Duisburg-Essen
➡️Tschentscher, Axel, Prof. Dr., LL.M., Universität Bern
➡️Uerpmann-Wittzack, Robert, Prof. Dr., Universität Regensburg
➡️Unruh, Peter, Prof. , Universität Göttingen
➡️Valentiner, Dana-Sophia, Prof.’in, Universität Rostock
➡️Verrel, Torsten, Prof. Dr. Universität Bonn
➡️Viellechner, Lars, Prof. Dr., Universität Bremen
➡️Volkmann, Uwe, Prof. Dr., Universität Frankfurt am Main
➡️Völzmann, Berit, Prof.’in Dr., Universität zu Berlin
➡️Vormbaum, Moritz, Prof. Dr., Universität Münster
➡️Walter, Christian, Prof. Dr., LMU München
➡️Wapler, Friederike, Prof.’in, Universität Mainz
➡️Waßer, Ursula, Prof.’in Dr., Universität Halle Wittenberg
➡️Waßmer, Martin, Prof. Dr. Dr. h.c., Universität zu Köln
➡️Weber-Guskar, Eva, Prof.’in Dr., Ruhr-Universität Bochum
➡️Wegner, Kilian, Prof. Dr. Universität Frankfurt a.d.O.
➡️Weigend, Thomas, Prof. Dr., Universität zu Köln
➡️Weiß, Norman, Prof. Dr., Universität Potsdam
➡️Weißer, Bettina, Prof.’in Dr., Universität zu Köln
➡️Wersig, Maria, Prof. Dr., Hochschule Hannover
➡️Wieland, Joachim, Prof. Dr., Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
➡️Wienands, Helen, Georg-August-Universität Göttingen
➡️Wieseman, Claudia, Prof.’in, Universität Göttingen
➡️Windsberger, Alexandra, Dr., Universität Konstanz
➡️Winkler, Eva, Prof.’in Dr. Dr., Universität Heidelberg
➡️Winkler, Markus, Prof. Dr., Universität Mainz
➡️Winter, Prof. Dr. Gerd Universität Bremen
➡️Wischmeyer, Thomas, Prof. Dr., Universität Bielefeld
➡️Witte, Jonas, Dipl.Jur., Universität Hannover
➡️Wittig, Petra, Prof.’in Dr., Universität München
➡️Wollinger, Gina Rosa, Prof.’in , HSPV Nordrhein-Westfalen
➡️Wörner, Liane, Prof.’in Dr. LL.M. (UW-Madison), Universität Konstanz
➡️Würkert, Felix, Dr., Universität Hamburg
➡️Zabel, Benno, Dr. M.A., Universität Frankfurt a.M.
➡️Zimmer, Reingard, Prof.’in Dr., Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
➡️Zimmermann, Andreas, Prof. Dr., LL.M (Harvard), Universität Potsdam
https://verfassungsblog.de/
2.5.2 Online-Artikel zu Angriffen ausgehend von der Neuen Rechten, u.a. aus der AFD, mit geschichtsrevisitionistischen, volksverhetzenden und herabwürdigenden Diffamierungen der Befürworter einer Prüfung zum AFD-Parteiverbotsverfahren als Nazis
Debatte um AfD-Verbot: Weidel zieht Hitler-Vergleich
Stand:08.07.2025, 04:52 Uhr
Von: Konstantin Ochsenreiter
Alice Weidel kritisiert die SPD-Pläne für ein AfD-Verbot: Sie zieht abermals einen Hitler-Vergleich, der Verwirrung stiftet.
Berlin – Die Diskussion um ein mögliches Verbotsverfahren gegen die Partei Alternative für Deutschland (AfD) hat eine neue Eskalationsstufe erreicht: AfD-Chefin Alice Weidel fühlt sich durch den Beschluss der SPD, ein solches Verfahren voranzutreiben, an „dunkle Zeiten“ erinnert. Sie zieht einen scharfen Vergleich zur NS-Zeit.
SPD fordert Voraussetzungen für AfD-Verbotsantrag: Weidel zieht Hitler-Vergleich
„Also wir haben das gesehen: Adolf Hitler hat – oh, jetzt kommt der Name – der hat als Erstes gemacht, andere Parteien zu verbieten, Pressefreiheit einzuschränken, hier und da“, so zitiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) Weidel. Die Äußerung soll vor Journalisten am Rande einer Klausur der Bundestagsfraktion ihrer Partei in Berlin gefallen sein. Sie fügt hinzu, die Diskussion, die AfD „doch ernsthaft mit einem Verbotsantrag zu überziehen“, erinnere sie „an ganz dunkle Zeiten“.
Hintergrund für ihre Äußerungen ist ein jüngst auf dem SPD-Parteitag verabschiedeter Antrag. Dieser zielt darauf ab, dass die antragsberechtigten Verfassungsorgane – Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat – unverzüglich die Voraussetzungen schaffen, um einen Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der AfD beim Bundesverfassungsgericht stellen zu können.
Die AfD auf Rechtskurs: Von Bernd Lucke bis Alice Weidel – Streit war gestern
AfD-Bundesparteitag in Riesa mit Alice Weidel
Fotostrecke ansehen
Debatte über AfD-Verbotsverfahren: Weidels Hitler-Vergleich im Faktencheck
Weidels NS-Vergleich erscheint gewagt: Wie die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) berichtet, schränkten die Nationalsozialisten nach 1933 die Pressefreiheit ein und schalteten politische Gegner aus. Doch das Verbot anderer Parteien war keineswegs einer der ersten Schritte, sondern das Ergebnis eines bereits etablierten Repressionsapparats. Hitlers Regime entmachtete demokratische Institutionen mit Notverordnungen, dem Ermächtigungsgesetz und durch systematische Gewalt. Politische Parteien wurden so lange verfolgt, entrechtet oder zur Selbstauflösung gedrängt, bis schließlich am 14. Juli 1933 das Einparteiengesetz in Kraft trat.
Ganz anders als die Lage heute: Die Bundesrepublik ist eine wehrhafte Demokratie, die sich auf rechtsstaatliche Mittel stützt. Ein Parteiverbot ist nach Artikel 21 des Grundgesetzes möglich – aber nur unter eng gefassten Voraussetzungen. Die betroffene Partei muss aktiv und aggressiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeiten, und das Verbot darf nur vom Bundesverfassungsgericht ausgesprochen werden. Befürworter stützen sich auf das vorerst zurückgenommene Urteil des Verfassungsschutzes, welches die AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ einstuft. Gegner hingegen warnen vor einer möglichen Märtyrerrolle und politischen Folgen.
Während Hitlers Regime politische Oppositionen zerstörte, soll ein mögliches AfD-Verbot der demokratische Schutzmechanismus gegen Verfassungsfeinde sein, so die Argumentation der Befürworter.
Sitzungen der Bundestagsfraktionen
Alice Weidel kritisiert die SPD-Pläne für ein AfD-Verbot mit einem Hitler-Vergleich. Die letzte Referenz stieß bei Experten auf ein Stirnrunzeln. (Symbolbild) © Michael Kappeler/picture alliance/dpa
AfD-Verbot: Intensivierte Diskussion nach Verfassungsschutz-Einstufung
Über ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD wird bereits seit Längerem debattiert. Befürworter sehen sich in dieser Forderung durch eine jüngste Neueinstufung der Partei durch das Bundesamt für Verfassungsschutz bestätigt. Der Verfassungsschutz hatte die AfD zur „gesichert rechtsextremistischen Bestrebung“ hochgestuft. Allerdings wehrt sich die Partei juristisch gegen diese Einstufung. Bis zu einer Entscheidung über den Eilantrag hat der Verfassungsschutz seine Einstufung deshalb vorerst wieder zurückgenommen.
Über ein Parteiverbot müsste in Deutschland auf Antrag von Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden.
Hitler ein Linker? AfD-Chefin Weidel sorgt nicht das erste Mal für Aufregung
Bereits in der Vergangenheit sorgten Weidel mit Aussagen zu Hitler für Aufsehen. Die wohl prominenteste Aussage entfuhr ihr während des X-Gesprächs, mit Elon Musk. Weidels Behauptung: „Er (Hitler, Anm. d. Red.) war ein Kommunist und hat sich selbst als Sozialist bezeichnet“ Alice Weidel bekräftigte diese Aussage auch nach dem Gespräch.
Faktencheck stellte jedoch klar, dass diese Darstellung des Nazi-Regimes als politisch links ein seit Jahren verbreiteter Verschwörungsmythos ist. Obwohl der Name von Hitlers Partei, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP), etwas anderes suggerieren mag, waren die Nationalsozialisten keine Linken. Historiker wie Werner Suppanz von der Universität Graz wiesen gegenüber dem Standard darauf hin, dass Hitler selbst 1928 erklärte, seine Partei sei nicht sozialistisch. Zudem wurde die kommunistische KPD von den Nazis verboten und Kommunisten unter Hitler verfolgt und ermordet wurden.
Die Grundlage der nationalsozialistischen Weltanschauung, die Ungleichwertigkeit der Menschen und der Rassenwahn, steht im „genauen Gegenteil des linken Gleichheitsideals“, wie der Extremismusforscher Jürgen P. Lang gegenüber dem Bayrischen Rundfunk betonte. (kox)
https://www.fr.de/
Fraktionsklausur am Wochenende
Die neue Strategie der AfD
Die Fraktionsvorsitzenden der AfD, Alice Weidel (l) und Tino Chrupalla, sprechen bei einem Statement im Reichstagsgebäude.
Auf der AfD-Fraktionsklausur hat die Partei eine neue Strategie entwickelt: Der Auftritt soll gemäßigter und professioneller werden, die CDU mit Kulturkampf-Themen vor sich hergetrieben werden. Aber die Chefin kann nicht aus ihrer Haut.
Jan Sternberg
06.07.2025, 15:17 Uhr
Alice Weidel hat Befürworter eines AfD-Verbotsverfahrens mit Adolf Hitler und den Nationalsozialisten verglichen. Auf einer Pressekonferenz im Bundestag sagte die Partei- und Fraktionschefin der AfD am Samstag: „Adolf Hitler hat als erstes andere Parteien verboten und die Pressefreiheit eingeschränkt. Die AfD zu kriminalisieren, das erinnert mich an ganz dunkle Zeiten.“
Weidel bezog sich auf den Beschluss des SPD-Parteitags vom vergangenen Wochenende, ein AfD-Verbotsverfahren vorzubereiten. Eine Arbeitsgruppe soll Belege sammeln, ob die AfD verfassungswidrig ist.
„Genau das hatten wir 1933″
Über Parteienverbote entscheidet in der Bundesrepublik das Bundesverfassungsgericht in einem rechtsstaatlichen Prozess. Die Organe des Staates können ein Verbotsverfahren beantragen.
Laut Weidel wollen „diese Loserparteien, die nichts hinkriegen“, die unliebsame Konkurrenz der AfD beseitigen. „Genau das hatten wir 1933″, sagte die Parteichefin auf der Pressekonferenz.
Die AfD-Bundestagsfraktion traf sich an diesem Wochenende zur Klausurtagung. Unter anderem wurde eine neue Strategie und eine Vereinbarung zum Verhalten im Plenum verabschiedet werden. Ziel ist eigentlich, seriöser und sachlicher aufzutreten.
Bereits im April hatte AfD-Chef Tino Chrupalla dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gesagt: „Wir werden als Oppositionsführer die Regierung kritisch begleiten: parlamentarisch hart im Ton und konstruktiv in der Debatte. Dabei wollen wir stärker unsere Lösungskompetenz und Lösungsvorschläge aufzeigen. Was schlecht läuft, wissen die Bürger selbst. Wie ein Deutschland aussehen wird, das von der AfD regiert wird, das müssen wir ihnen erklären.“
Weidel hingegen sagte am Samstag, die Bundesregierung betreibe nur deshalb eine verstärkte internationale Krisenpolitik, „um von innenpolitischen Problemen abzulenken. Das ist ein gigantisches Ablenkungsmanöver. Es geht in Deutschland alles den Bach runter.“
Sieben-Punkte-Papier beschlossen
Am Samstag beschloss die Fraktion ein Sieben-Punkte-Papier, um das im Vorfeld lange gerungen wurde. Darin wurden wesentliche AfD-Positionen bekräftigt, die an Aktualität nichts verloren hätten, sagte Chrupalla.
In dem Papier fordert die Fraktion „effektiven Grenzschutz” eine Abschiebeoffensive „insbesondere nach Syrien und Afghanistan“, Steuersenkungen sowie eine Reparatur und Inbetriebnahme der Nord-Stream-Gasleitungen aus Russland.
Interessanter ist da fast, was nicht im Papier steht: In Arbeitsfassungen sei auch der Begriff „Remigration“ verwendet worden, der in der verabschiedeten Fassung fehlt. Weidel begründete auf Nachfragen nicht, warum der Begriff gestrichen wurde. Maßgeblich sei allein die verabschiedete Fassung. Im Wahlkampf hatte Weidel den aus rechtsextremen Kreisen stammenden Begriff noch offensiv in den Wahlkampf eingeführt. Noch vor Kurzem hatte der Parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann gesagt: „Remigration ist immer ein Thema. Wir lassen uns doch nicht vorschreiben, welche Worte wir benutzen dürfen.“
Nun scheint man vorsichtiger geworden zu sein – schließlich stehen Gerichtsverfahren über die Hochstufung der AfD durch den Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch” an.
Der nun gestrichene Begriff „Remigration“ war im Papier ohnehin nur an einer Stelle genannt, ausgerechnet bei der Frage, wie günstiger Wohnraum geschaffen werden könne. Im Gegensatz dazu hatten die ostdeutschen Landes-Fraktionschefs in einem vor wenigen Wochen verabschiedeten Papier noch von einer „Abschiebe- und Remigrationsoffensive“ gesprochen und den Begriff verteidigt. Der Thüringer Landeschef und Bundestagsabgeordnete Stefan Möller schrieb am Samstag auf X: „Mal kurz zur Klarstellung: Leitkultur und Remigration sind in der AfD nicht gestrichen.“
Am Sonntag verteidigte Möllers Co-Landeschef Björn Höcke in einem länglichen Beitrag in den sozialen Medien den österreichischen Rechtsextremen Martin Sellner und dessen Verständnis von „Remigration“. Er ließ durchblicken, dass für ihn auch Menschen „mit einer doppelten Staatsbürgerschaft“, deren „Loyalität nicht ungeteilt ist“, keinen Platz mehr in Deutschland hätten – was verfassungswidrig wäre.
Kulturkampf soll die CDU ins rechte Lager treiben
Fraktionsvize Beatrix von Storch stellte auf der Klausur ein Strategiepapier vor, wie die AfD aus ihrer Sicht perspektivisch in Regierungsverantwortung kommen könne. Durch eine Betonung gesellschafts- und kulturpolitischer Themen, plant von Storch, solle ein Bruch zwischen dem rechten und linken Lager herbeigeführt und die schwarz-rote Koalition gespalten werden. Wenn sich Union, SPD und Grüne so weit entfremdet hätten, dass sie nicht mehr koalitionsfähig wären, mache das den Weg frei für schwarz-blaue Bündnisse.
Fraktion berät auch über Benimmregeln
Bei der Klausur gab sich die Fraktion auch Benimmregeln. Beschlossen wurde sollen ein Verhaltenskodex und eine Vereinbarung zum Verhalten im Bundestagsplenum. Darin hieß es unter anderem: „Die Mitglieder sind um ein geschlossenes und gemäßigtes Auftreten im Parlament bestrebt, um die politische Handlungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit der Fraktion sicherzustellen.“
Geplatzte Richterwahl erschüttert Koalition
11.07.2025, 20:00 Uhr
Christoph Mestmacher, ARD Berlin, zu der verschobenen Wahl der neuen Bundesverfassungsrichter
11.07.2025, 18:00 Uhr
Unterdessen schloss das Landesschiedsgericht Nordrhein-Westfalen den AfD-Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich vorläufig aus der Partei aus. Helferich, der sich selbst als „das freundliche Gesicht des NS“ (Nationalsozialismus) bezeichnet hatte, kündigte an, vor dem Bundesschiedsgericht und zivilgerichtlich gegen den Ausschluss vorzugehen. In der Bundestagsfraktion wird er bis zu einem rechtskräftigen Urteil bleiben.
Die AfD-Fraktion hat sich nach der Bundestagswahl auf 151 Abgeordnete verdoppelt. Und auch die Partei ist stark gewachsen. 2023 gab es noch 34.000 Mitglieder. Aktuell sind es 64.000, teilte Bundesschatzmeister Carsten Hütter dem RND mit. Der Bundestagswahlkampf hat für einen Mitgliederboom gesorgt. Die Hochstufung durch den Verfassungsschutz führte zwar zu einigen Austritten, aber auch zu einem Solidarisierungseffekt. Netto 4000 Mitglieder mehr verzeichnet die Partei seit Anfang Mai.
https://www.rnd.de/
Zur AfD-Fraktionsklausur
„Remigration“ raus, Hitler-Vergleich rein: Die AfD kann einfach nicht seriös
Alice Weidel und Tino Chrupalla AfD, bei einem Statement der AfD am 05.07.25 in Berlin.
Eigentlich wollte die AfD gemäßigter auftreten, anschlussfähiger. Im Positionspapier der Bundestagsfraktion fehlt der Begriff „Remigration“. Doch Parteichefin Alice Weidel zeigt: Diese Partei kann nur schrill und maßlos.
Jan Sternberg
Ein Kommentar von Jan Sternberg
05.07.2025, 15:30 Uhr
Die AfD will seriöser werden. Sachlicher. So agieren, dass es der Union schwerfällt zu erklären, warum sie sich im Bund an die Sozialdemokraten bindet und die Brandmauer stabil bleibt. Und am Ende will sie regieren. Das ist der Plan. Darauf haben die Chefs der Rechtspartei ihre Bundestagsfraktion auf der Klausurtagung an diesem Wochenende einstimmen wollen.
Ein „Positionspapier“ soll den Weg weisen, soll „Pflöcke“ für die künftige Arbeit einschlagen. Auffällig dabei ist, was dabei fehlt: Der von Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel noch im Wahlkampf adoptierte rechtsextreme Kampfbegriff „Remigration“ gehört nicht mehr dazu.
Die Parteioberen sind vorsichtig geworden
Die Hochstufung durch den Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ und das „Compact“-Urteil scheinen die Parteioberen zur Vorsicht getrieben zu haben. Auch im Parlament soll die AfD seriöser auftreten, auf dezente Kleidung wird nach den wohlklingenden Vereinbarungen ebenso geachtet wie auf weniger aggressive Sprache. Zwischenrufe sind allerdings weiter erwünscht.
Und wenn ausgerechnet der Ordnungsruf-Meister der vergangenen Legislaturperiode, Fraktionsvize Stephan Brandner, für das Papier verantwortlich zeichnet, hat er entweder eine 180-Grad-Wende im Außenauftritt vor oder das Papier wird schnell vergessen sein.
Schwarz-Rot muss Richterwahl im Bundestag nach Eklat um SPD-Kandidatin abblasen
11.07.2025, 17:00 Uhr
Mehr zum Thema
Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion.
„Rassismus ist kein Fangesang“
Rassistischer Fußball-Post von AfD-Politiker: Linken-Politikerin erstattet Anzeige
Die Fraktionsvorsitzenden der AfD, Alice Weidel (l) und Tino Chrupalla, sprechen bei einem Statement im Reichstagsgebäude.
Fraktionsklausur am Wochenende
Die neue Strategie der AfD
BSW-Co-Parteichefin Amira Mohamed.
Mohamed Ali bestreitet Annäherung
BSW-Co-Chefin: „Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD“
Vergessen hat am Samstag auch Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel alle Mäßigungsappelle. Sie muss wissen, was ein Hitler-Vergleich in der deutschen Politik auslöst. Über Sinn und Unsinn eines AfD-Verbotsverfahrens lässt sich streiten, und dass die Betroffenen das als einen Angriff auf die Demokratie sehen, wie sie sie verstehen, ist naheliegend. Aber das Bundesverfassungsgericht und die SPD mit den Nazis zu vergleichen, wie Weidel es öffentlich getan hat, überschreitet jede Grenze. Die AfD bleibt an der Spitze, wie wir sie kennen: schrill und extrem. Und weit von einer Regierungsfähigkeit entfernt.
https://www.paz-online.de/
Verhaltenskodex im Bundestag
AfD verordnet sich neue Benimmregeln – kurz darauf vergleicht Weidel die SPD mit Hitler
Von dpa | 05.07.2025, 21:31 Uhr 9 Leserkommentare
AfD-Chefin Alice Weidel unterstellt Befürworter eines Verbotverfahrens NS-Methoden.Foto: IMAGO/Metodi Popow
Die AfD-Fraktion gibt sich Regeln für mehr Seriosität – doch nur Stunden später kontert Weidel mit NS-Vergleichen und Spott im Netz.
Die AfD-Fraktion im Bundestag hat sich Benimmregeln verpasst. Bei einer Klausurtagung in Berlin beschlossen die Abgeordneten einen Verhaltenskodex, wie ein Fraktionssprecher bestätigte. In dem Papier heißt es unter anderem: „Die Mitglieder sind um ein geschlossenes und gemäßigtes Auftreten im Parlament bestrebt, um die politische Handlungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit der Fraktion sicherzustellen.“ Daneben gibt es „Regeln zur Prävention von Bestechlichkeit“ und zum „Ausschluss von Interessenkonflikten“.
Co-Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla hatte mit Blick auf eine gewachsene Wählerschaft seiner Partei von mehr Verantwortung gesprochen und einen anderen Ton der AfD im Parlament angekündigt. Ein seriöseres Auftreten soll auch den Anspruch der AfD unterstreichen, irgendwann in eine Regierung einzutreten.
Lesen Sie auch
„Das nützt doch nur der AfD“
AfD als Opfer? Dieses Narrativ sollte niemand übernehmen
Hat es sich in der Opferrolle gemütlich gemacht: die AfD im Bundestag.
Deutschlands Polarisierung
Weidel, Brosius-Gersdorf und der Kulturkampf um die AfD
Frauke Brosius-Gersdorf: Ihre Nominierung als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht hat eine politische Krise ausgelöst.
„Geschlossen und gemäßigt“ will die AfD-Fraktion im Bundestag auftreten. Foto: dpa/Kay Nietfeld
Lesen Sie auch: Was die AfD als zweitstärkste Kraft im Bundestag treibt: alles Strategie?
Weidel zieht Hitler-Vergleich und schimpft über „Loser-Parteien“
Parteichefin Alice Weidel schlug am Rande der Klausur allerdings scharfe Töne an. Befürworter eines AfD-Verbotsverfahrens attackierte sie und zog Vergleiche zur NS-Diktatur unter Adolf Hitler. Der habe als erstes Parteien verboten und die Pressefreiheit eingeschränkt. Weidel griff speziell die SPD an, die sich auf ihrem Parteitag dafür starkgemacht hatte, ein AfD-Verbotsverfahren voranzutreiben.
Erst ein Brennen, dann kommt der Dauerschmerz
Was wie ein harmloser Ausschlag beginnt, kann langanhaltende Nervenschmerzen auslösen. Wer frühzeitig reagiert, kann das Risiko deutlich senken.
Diese ganzen „Loser-Parteien“ im Bundestag wollten doch tatsächlich einen Verbotsantrag diskutieren, sagte Weidel. „Und genau das hatten wir 1933.“ Die Fraktion postete den Ausschnitt aus Weidels Statement bei X und schrieb dazu: „Alice Weidel zieht über die Loser-Parteien her“, versehen mit einem Lach-Smiley.
https://www.noz.de/
2.5.3 Online Artikel zu offensivem aggressiven Agieren der rechtsextremen Szene in Spremberg
Berlin & Brandenburg
Engagement von Sprembergs Bürgermeisterin wird gewürdigt
01.10.2025, 09:42 Uhr
In der Lausitz ist die Sorge groß, dass sich der Rechtsextremismus weiter ausbreitet. Christine Herntier wendet sich mit einem Brandbrief an die Menschen in der Region. Dafür wird sie geehrt.
Berlin (dpa/bb) - Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier (parteilos) erhält den diesjährigen Preis für Zivilcourage gegen Antisemitismus, Rechtsradikalismus und Rassismus. Die mit 2.000 Euro dotierte Auszeichnung wird ihr gemeinsam mit den Bürgerinitiativen "Unteilbar Spremberg" und "AG Spurensuche" verliehen, wie der Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas mitteilte.
Herntier und die Initiativen werden ausgezeichnet für ihr Engagement gegen einen wachsenden Einfluss von Rechtsextremisten in der Stadt in der Lausitz. Die Bürgermeisterin rief dazu auf, das Problem nicht länger zu verschweigen. Es hatte Gewaltvorfälle bei Jugendclubs in Senftenberg und Spremberg gegeben. Ein alternatives Wohnprojekt in Cottbus wurde im Mai attackiert. Mit einem öffentlichen Brief an die Bürger erregte sie bundesweite Aufmerksamkeit.
"Entschlossener Einsatz"
"Das unermüdliche Engagement der Preisträgerinnen für ein demokratisches, friedliches und solidarisches Zusammenleben in der Stadt Spremberg/Grodk sowie ihr kontinuierlicher und entschlossener Einsatz gegen die vielen rechtsradikalen und antisemitischen Attacken ist der Würdigung durch den Preis für Zivilcourage unbedingt wert", erklärte die Vorsitzende des Förderkreises Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Lea Rosh.
Der Förderkreis setzt sich für die Bekämpfung von Antisemitismus und Rechtsradikalismus ein und fördert demokratische Werte sowie die Erinnerung an die Holocaust-Opfer.
Der Preis soll am 24. November im Rahmen eines Charity-Dinners im Hotel "Adlon" am Brandenburger Tor in Berlin verliehen werden. Bei dem Charity-Dinner kommen in jedem Jahr hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft zusammen.
https://www.n-tv.de/
Appell gegen Rechtsextremismus
Mitglieder der Lausitzrunde stellen sich hinter Spremberger Bürgermeisterin
Mi 30.07.25 | 13:10 Uhr
Archivbild: Treffen der "Lausitzrunde" im Barbarasaal der LEAG-Hauptverwaltung in Cottbus am 08.12.2022.
Audio: Antenne Brandenburg | Studio Cottbus | 30.07.2025 | Anke Blumenthal | Bild: picture alliance/Andreas Franke
Mitglieder der Lausitzrunde unterstützen mit einer gemeinsamen Erklärung die Spremberger Bürgermeisterin Christine Herntier. Die parteilose Politikerin hatte Anfang Juli mit einem öffentlichen Appell auf den erstarkenden Rechtsextremismus in ihrer Stadt im Brandenburger Landkreis Spree-Neiße aufmerksam gemacht.
In der Erklärung heißt es unter anderem, die Mitglieder unterstützen Herntier bei ihrer Initiative "zur Stärkung einer demokratischen Gesellschaft und ihrem aktiven Handeln gegen Stillschweigen" [lausitzrunde.de]. Nicht die Menschen, die offen über verfassungsfeindliche Straftaten sprechen, würden dem Ruf der Lausitz schaden - sondern die, die diese begehen, verharmlosen oder bestreiten, so die Mitglieder weiter.
Ein Aufkleber mit der Aufschrift "Vaterland" ist an einem Pfeiler in der Stadt Spremberg.
dpa/Pleul
Erstarkender Rechtsextremismus
Bürgermeisterin von Spremberg bekräftigt: "Die Lage ist ernst"
Pressesprecherin: "Befürwortende Mehrheit" im Bündnis
Das kommunale Bündnis aus sächsischen und brandenburgischen Gemeinden, die vom Strukturwandel betroffen sind, besteht aus knapp 60 Mitgliedern, haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeistern und Amtsdirektoren. 18 von ihnen haben die Erklärung bis Mittwoch unterzeichnet [Stand: 13 Uhr]. Sie rufen auch die Zivilgesellschaft auf, gemeinsam aktiv gegen demokratiefeindliche Strömungen einzutreten.
Weitere Unterzeichner würden folgen, so Kerstin Holl, die Pressesprecherin der Lausitzrunde. Man befinde sich in der Urlaubszeit, nicht alle Mitglieder seien unmittelbar erreichbar. Man habe sich aber zu einem schnellen Handeln verpflichtet gefühlt, so Holl weiter. Es gebe eine "befürwortende Mehrheit" innerhalb des Bündnisses. Nur ein Mitglied habe laut der Pressesprecherin bislang abgelehnt, die Erklärung zu unterzeichnen.
Bei einer Demo tragen Neonazis Deutschlandflaggen.(Quelle:rbb)
rbb
Rechtsextremismus
Neue Generation von Neonazis macht sich in der Lausitz breit
Anfeindungen und Zuspruch für Herntier
Herntiers Appell hat für ein breites Echo im Land gesorgt. Der Brandenburger Innenminister René Wilke (parteilos) hatte der Stadt Spremberg Unterstützung zugesichert, es folgte ein Treffen zwischen Stadt, Schulamt und dem Verfassungschutz.
Die Bürgermeisterin sieht sich seit ihren Äußerungen aber auch Anfeindungen ausgesetzt. Im Vorfeld einer Stadtverordnetenversammlung hatte eine Gruppe Menschen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (DPA) zuletzt auf einem Plakat den Rücktritt der Politikerin gefordert. Dem Deutschlandfunk sagte Herntier, sie habe wegen der harschen Kritik mittlerweile ihren Facebook-Account abgeschaltet.
Sendung: Antenne Brandenburg, 30.07.2025, 13:30 Uhr
https://www.rbb24.de/
Rechtsextremismus
Bürgermeisterin von Spremberg erntet im Ort Protest
Die parteilose Bürgermeisterin Christine Herntier rüttelt mit einem Brandbrief zu rechten Umtrieben in ihrer Stadt auf. Einige Bürgerinnen und Bürger fordern ihren Rücktritt.
Von dpa
Aktualisiert: 23.07.2025, 15:04
Einige Spremberger fordern die Bürgermeisterin wegen ihrer Kritik am wachsenden Rechtsextremismus zum Rücktritt auf. Patrick Pleul/dpa
Spremberg - Der Brandbrief der Bürgermeisterin von Spremberg zum Erstarken des Rechtsextremismus trifft bei einigen Menschen in der südbrandenburgischen Stadt auf Widerspruch. Vor einer Sitzung der Stadtverordneten am Nachmittag demonstrierte auf dem Marktplatz eine kleine Gruppe Menschen. Auf einem Plakat wurde der Rücktritt von Bürgermeisterin Christine Herntier gefordert.
Darauf hieß es, dem Ansehen der Stadt Spremberg sei mit den Auftritten in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten massiv geschadet worden. „Als Bürger der Stadt Spremberg fühle ich mich mit Ihren Auftritten in die rechtsradikale Schiene gedrückt.“ Das werfe kein gutes Licht auf die Stadt, sagte eine Teilnehmerin. Andere beklagten unter anderem ein fehlendes Sicherheitsgefühl in der Stadt, zu wenig Augenmerk auf deutsche Bürger, fehlende Ärzte und eine marode Schwimmhalle.
Hilferuf der Bürgermeisterin
Bürgermeisterin Herntier hatte sich mit einem Schreiben an die knapp 22.000 Einwohner der Stadt in der Kohleregion Lausitz in Südbrandenburg gewandt. Darin hatte sie beklagt, dass sich das Gedankengut der rechtsextremen Szene in Spremberg zunehmend bemerkbar mache.
Es dürfe nicht länger darüber geschwiegen werden, sagte die parteilose Politikerin. Sie schilderte, dass Lehrer und Schüler aus Oberschulen voller Wut und Angst zu ihr in das Rathaus kämen. Bürger fragten sie unter anderem, ob sie wegziehen müssten, seien verzweifelt und weinten. Ihre Sicht wiederholte sie diese Woche in einem Interview des ZDF.
Für den Nachmittag ist eine Sitzung der Spremberger Stadtverordnetenversammlung geplant. In einer Telegram-Gruppe wurde zu Protesten aufgerufen. Auch in dieser Gruppe wurde Herntier beschimpft und angefeindet.
https://www.mz.de/
Brandenburg
Proteste und Beschimpfungen gegen Bürgermeisterin von Spremberg nach Brandbrief gegen Rechtsextremismus
Die Bürgermeisterin der Stadt Spremberg in Brandenburg sieht sich mit Protest und Rücktrittsforderungen aus der Bevölkerung konfrontiert. Die parteilose Christine Herntier hatte öffentlich ein Erstarken der rechtsextremen Szene in Spremberg beklagt. Manche Einwohner fühlen sich „in die rechte Ecke gedrückt“.
23.07.2025
Einige Teilnehmer einer Protestveranstaltung gegen die Bürgermeisterin der Stadt Spremberg im Landkreis Spree-Neiße haben sich auf dem Marktplatz versammelt.
Nach Hilferuf der Bürgermeisterin – Protest in Spremberg (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)
In einem Brief an die knapp 22.000 Einwohner der Stadt hatte Herntier kritisiert, dass sich rechtsextremes Gedankengut in Spremberg immer stärker bemerkbar mache. Sie verwies unter anderem auf Hakenkreuze an Hausfassaden und verbotene Parolen in der Öffentlichkeit. Kinder würden von der Partei Dritter Weg, die laut Verfassungsschutz ein rechtsextremistisches Staats- und Gesellschaftsbild vertritt, auf dem Schulweg angesprochen, schilderte die Bürgermeisterin der „Zeit“. Verängstigte Bürger überlegten, aus Spremberg fortzuziehen. Herntier betonte, angesichts dieser Entwicklung dürfe man nicht länger schweigen, auch wenn es dem Ansehen der Stadt möglicherweise schade. Sie wiederholte ihre Aussagen unter anderem in einem Interview mit dem ZDF.
„Dem Ansehen Sprembergs geschadet“
Das kam nicht bei allen Menschen in Spremberg gut an. Vor einer für den Nachmittag geplanten Stadtverordnetensitzung demonstrierte auf dem Marktplatz eine Gruppe Menschen. Auf einem Plakat wurde der Rücktritt von Herntier gefordert. Sie habe mit ihren Interviewaussagen dem Ansehen Sprembergs massiv geschadet. Man fühle sich „in die rechtsradikale Schiene gedrückt“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur Teilnehmer der Versammlung. Andere hätten ein fehlendes Sicherheitsgefühl in der Stadt, zu wenig Augenmerk auf deutsche Bürger, fehlende Ärzte und eine marode Schwimmhalle beklagt.
Auch auf Telegram wurde aus Anlass der Stadtverordnetensitzung zu Protesten aufgerufen. Herntier wurde beschimpft und angefeindet.
Problem ist nicht neu
Das Problem mit Rechtsextremismus ist in Spremberg nicht neu. Vor mehr als zehn Jahren wurden dort Attacken rechtsextremer Gewalttäter bekannt. Immer wieder verweisen Verfassungsschützer gerade in Südbrandenburg auf eine rechtsextremistische Szene. Bei der Bundestagswahl im Februar gingen in Spremberg 32 Prozent der Erststimmen an den AfD-Kandidaten Lars Schieske.
Diese Nachricht wurde am 23.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
https://www.deutschlandfunk.de/
Hilferuf wegen Neonazi-Umtrieben
Bürgermeisterin von Spremberg nach Brandbrief angefeindet
23.07.2025, 18:21 Uhr
Ein Aufkleber in den deutschen Nationalfarben an einer Mauer am Busbahnhof der Stadt Spremberg. Darauf wird gegen Jugendliche arabischer Herkunft (Talahons) Stimmung gemacht.
(Foto: picture alliance/dpa)
Bürgermeisterin Herntier beklagt in einem Schreiben das Erstarken des Rechtsextremismus in der Kleinstadt Spremberg im Südosten Brandenburgs. Durch TV-Interviews sorgt die Parteilose auch bundesweit für Aufsehen. In der Stadt formiert sich Widerstand gegen sie - die AfD will eine Abwahl prüfen.
Nach ihrem Brandbrief zum Rechtsextremismus hat sich die Bürgermeisterin von Spremberg, Christine Herntier, gegen den Vorwurf verteidigt, sie schade vor allem dem Image der Stadt. "Geht das Problem weg, wenn wir es nicht benennen?", sagte Herntier in der Sitzung der Stadtverordneten am Nachmittag.
Sie rief dazu auf, Straftaten wie verfassungsfeindliche Symbole und Volksverhetzung nicht hinzunehmen, gemeinsam dagegen vorzugehen und ein "Bekenntnis" dagegen abzugeben. Dazu zeigte sie auch Bilder mit rechten Schmierereien und Plakaten aus der 22.000-Einwohner-Stadt in der Lausitz südlich von Cottbus. "Wer findet es gut, wenn wir Gäste am Bahnhof so begrüßen?", sagte Herntier.
NAZI2.jpg
01:53 min
Panorama
21.05.25
RTL-Reporterin deckt Terror auf
Rechtsextreme Teenies festgenommen - wegen dieser Szenen
Viele in der Stadtverordnetenversammlung signalisieren Unterstützung. Wenn sich die rechte Jugendkultur erst festgesetzt habe, dann habe die Stadt in drei, vier oder fünf Jahren rechte Gewalttäter, sagt der Stadtverordnete und Sozialarbeiter Benny Stobinski (Wählergruppe "Die Spremberger"). "Dann haben wir diese Baseballschläger-Jahre." Es sei richtig gewesen, die Entwicklung öffentlich zu machen, sagt Stobinski.
Bürgermeisterin Herntier hatte sich mit einem Schreiben an die knapp 22.000 Einwohner der Stadt in der Kohleregion Lausitz in Südbrandenburg gewandt. Darin hatte sie beklagt, dass sich das Gedankengut der rechtsextremen Szene in Spremberg zunehmend bemerkbar mache.
Es dürfe nicht länger darüber geschwiegen werden, sagte die parteilose Politikerin. Sie schilderte, dass Lehrer und Schüler aus Oberschulen voller Wut und Angst zu ihr ins Rathaus kämen. Bürger fragten sie unter anderem, ob sie wegziehen müssten, seien verzweifelt und weinten. Ihre Sicht wiederholte sie diese Woche in einem Interview des ZDF. In einer Telegram-Gruppe wurde zu Protesten aufgerufen. Dort wurde Herntier auch beschimpft und angefeindet.
AfD versucht abzuwiegeln
Aus den Reihen der AfD kam in der Sitzung der 27 Stadtverordneten der Vorwurf des Imageschadens an die Bürgermeisterin. Auch einige Bürger kritisierten zuvor bei einer Versammlung am Marktplatz, sie schade dem Ansehen der Stadt.
Der AfD-Landtagsabgeordnete und Stadtverordnete Michael Hanko sprach von einer "Randerscheinung". "Ich glaube, dass das irgendwelche dummen Jungs waren." Hanko sagte, es werde in der Sommerpause geprüft, ob ein Abwahlverfahren gegen die Bürgermeisterin angestrebt werde. Er sprach wörtlich vom "Potsdamer Weg". In der Stadt Potsdam war der SPD-Bürgermeister nach viel Kritik aus dem Stadtparlament per Bürgerentscheid abgewählt worden.
536832176.jpg
Politik
21.07.25
Reaktion auf Brandbrief
Innenminister verspricht Spremberg Hilfe gegen Rechtsextreme
Vor der Sitzung der Stadtverordneten hatte auf dem Marktplatz eine kleine Gruppe Menschen demonstriert. Einige fordern den Rücktritt Herntiers. Auch hier heißt es, die Bürgermeisterin habe dem Ansehen geschadet. "Als Bürger der Stadt Spremberg fühle ich mich mit ihren Auftritten in die rechtsradikale Schiene gedrückt." Das werfe kein gutes Licht auf die Stadt, sagte eine Teilnehmerin. Sie habe hier keine Angst vor Rechtsextremen, sondern vor zugereisten Männern. An Schulen seien nicht Rechtsextreme das Problem, sondern ausländische Jugendliche. Eine andere Frau sagte, die Stadt werde in den Dreck gezogen. Sie habe noch nicht gehört, dass es hier eine rechtsextreme Szene gebe.
Verfassungsschützer warnen
Tatsächlich ist die Bürgermeisterin, die zuletzt 2021 mit mehr als 60 Prozent wiedergewählt wurde, mit ihrer Sicht nicht allein. Immer wieder verweisen Verfassungsschützer gerade in Südbrandenburg auf eine rechtsextremistische Szene. In Spremberg wurden schon vor mehr als zehn Jahren Attacken rechtsextremer Gewalttäter bekannt.
Lorenz Blumenthaler von der Amadeu Antonio Stiftung sieht in der Region "rechtsextreme Landnahme aus dem rechtsextremen Playbook". Gemeint ist das Besetzen von Räumen: Billige Immobilien in der vom Kohleausstieg betroffenen Region werden aufgekauft, öffentliche Plätze zum Beispiel mit Plakaten und Aufklebern als Revier markiert, Jugendliche ohne viele Freizeitoptionen angesprochen.
526498196.jpg
Politik
18.06.25
Aktion in Brandenburg
Durchsuchungen im Umfeld der rechten "Kaiserreichsgruppe"
Der "Dritte Weg" kommuniziert das ganz offen auf seiner Homepage. "Gespräche mit der Deutschen Jugend vor Ort bestärkten in unserem Handeln", schreibt die laut Verfassungsschutz rechtsextremistische Gruppe. Es gebe gesteigertes Interesse bei Jugendlichen.
Blumenthaler sagt, es handele sich um "eine militant streng hierarchisch organisierte Neonaziformation" mit Führerprinzip und NS-Ideologie. Sie biete Jugendlichen Ideologie, Kampfsport, aber auch "kulturell völkische Veranstaltungen" wie etwa Sonnenwendfeiern. Etabliert habe sich die Gruppe in einem Umfeld, in dem auch die AfD stark sei. Bei der Bundestagswahl im Februar erreichte die AfD in Spremberg 45,5 Prozent der Zweitstimmen.
Experte: Spremberg ist kein Einzelfall
Klar ist für den Experten, dass Spremberg kein Einzelfall sei. Das sieht auch der brandenburgische Verfassungsschutz. Die Zahl der Rechtsextremisten in Brandenburg hat nach dessen Erkenntnissen im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Erfasst wurden 3650 Personen - fast ein Fünftel mehr als im Jahr zuvor. Vier von zehn Rechtsextremisten werden als gewaltorientiert angesehen.
faktenzeichen afd.jpg
12:15 min
Politik
06.06.25
"ntv Faktenzeichen" sichtet Belege
Wie rechtsextremistisch ist die AfD wirklich?
Blumenthaler sieht die Corona-Pandemie als Beschleuniger der Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren: Es sei eine existenzielle Krisenerfahrung, die den selbsterklärten Widerstand gegen "die da oben" scheinbar legitimiert habe. Jugendliche hätten im Lockdown Ohnmacht erlebt und zugleich viel Zeit für Tiktok und Co gehabt, wo die AfD und andere rechte Gruppen stark seien.
Aber was soll die Entwicklung stoppen? "Das gebe ich ja gerne zu, dass wir bisher nicht das richtige Rezept gefunden haben", sagt Bürgermeisterin Herntier zuletzt im ZDF. "Aber mit Sicherheit ist es falsch, so zu tun, als ob das alles nicht stattfinden würde." Sie erhofft sich Erkenntnisse und neue Ansatzpunkte von Verfassungsschützern, die sich für Freitag zum Gespräch angekündigt haben.
Quelle: ntv.de, gut/dpa
https://www.n-tv.de/
Bürgermeisterin von Spremberg : Sie will den Rechten nicht das Feld überlassen
22.07.2025 | 15:26
Bürgermeisterin Christine Herntier will ihre Stadt in Brandenburg nicht den Rechtsextremen überlassen. Nun kämpft sie für Aufmerksamkeit - mitunter gegen den Willen ihrer Bürger.
"Ich bin keine Schönwetterbürgermeisterin", sagt Christine Herntier, Bürgermeisterin von Spremberg in der Lausitz. Sie werde vor den Rechten nicht einknicken.
21.07.2025 | 6:04 min
Hakenkreuze und Aufkleber an Hausfassaden, verbotene Parolen, Schüler in Angst: Die rechtsextreme Szene und ihr Gedankengut machen sich in der Lausitz-Stadt Spremberg in Brandenburg zunehmend bemerkbar. Jetzt dürfe nicht länger darüber geschwiegen werden - auch wenn es dem Ansehen der Stadt schade, sagt die parteilose Bürgermeisterin Christine Herntier und wendet sich an die Öffentlichkeit.
In einem Schreiben an ihre Bürger prangert sie an, was in der Stadt passiert. Dass sich etwa die neonazistische Partei Dritter Weg im Netz inszeniert, indem sie Jugendliche beim militärisch anmutenden Sport am bekannten Spremberger Bismarckturm zeigt - viele von ihnen in Kleidung mit rechten Symbolen. Bürger, die voller Angst und Wut zu ihr kommen, die überlegen, wegzuziehen. Aber auch Bürger, die sich mehr um das Image der Stadt als um den Rechtsruck sorgen.
"Mantel des Schweigens" gewünscht
Sie sei angefleht worden, "doch bloß nichts zu sagen". "Einen Mantel des Schweigens" über die rechte Bedrohung zu breiten und so zu tun, als ob alles gut sei, das stärke jedoch mit Sicherheit diese Gruppierung, so Herntier.
Spremberg kämpft mit dem Strukturwandel und gegen den Rechtsextremismus. Die Bürgermeisterin schlägt Alarm, doch in der Stadt gehen die Meinungen weit auseinander.
21.07.2025 | 2:30 min
Kinder und Jugendliche im Visier
Andere Spremberger nehmen das Problem zwar wahr, sehen es jedoch gelassener. "Das ist grundsätzlich nicht in Ordnung, aber hier ist noch nie jemand erschlagen worden", sagt etwa ein Spremberger im ZDF heute journal. Eine Aussage, die Herntier schockiert.
Ich sage dazu: 'Wehret den Anfängen'".
„
Christine Herntier, Bürgermeisterin von Spremberg
Jeder, der mit offenen Augen durch Spremberg laufe, sehe, dass das Problem zugenommen habe - insbesondere die Präsenz des Dritten Wegs, berichtet sie im ZDF heute journal. Die Rechten sprächen die Kinder und Jugendlichen an.
Kinder und Jugendliche mit Hass aufwachsen zu lassen - ist es nicht unsere Aufgabe, dagegen zu wirken?
„
Christine Herntier
2024 gab es rund 38.000 rechtsextreme Straf- und Gewalttaten – knapp 6.000 waren es bei Linksextremen. ZDF-Hauptstadtkorrespondent Karl Hinterleitner ordnet die Zahlen ein.
10.06.2025 | 1:54 min
Hoffnung auf Hilfe durch Verfassungsschutz, Polizei und Politik
Gleichzeitig seien ihre Möglichkeiten als Bürgermeisterin begrenzt, etwa weil ihr die rechtliche Befugnis fehle, Vorgänge zu verbieten. Sie fordert etwa mehr Polizeipräsenz in Spremberg, aber auch verstärkte Prävention an Schulen.
Deshalb habe sie sich an die Öffentlichkeit gewandt. Mit Erfolg: Sowohl der Verfassungsschutz als auch Brandenburgs Innenminister René Wilke (parteilos) kündigten bereits an, Spremberg im Kampf gegen den Rechtsextremismus zu unterstützen.
Deutschland protestiert wieder! Die Menschen gehen auf die Straßen. Sie sind viele, sie sind laut, und einige von ihnen sind radikal.
22.08.2024 | 44:08 min
Auf der Suche nach Verbündeten
In der Vergangenheit sei viel zu wenig gegengesteuert worden, bemängelt Herntier. Zwar gebe es unzählige Initiativen gegen Rechts, es gebe Bündnisse und Workshops, aber Jugendliche müssten anders angesprochen werden.
Um herauszufinden, wie sich das rechte Gedankengut in Spremberg so stark ausbreiten konnte, setze sie nun auch auf den Verfassungsschutz und dessen Erkenntnisse. "Dann bin ich hoffentlich etwas schlauer und kann gezielter handeln, gemeinsam, nicht nur ich alleine, sondern mit ganz vielen Verbündeten", sagt Herntier im ZDF.
In Deutschland verbreiten sich zunehmend rechtsextreme Einstellungen. Es sind auffällig viele Frauen, die dagegen offen ihre Stimme erheben. "37°" begleitet drei mutige Frauen.
29.10.2024 | 29:15 min
Herntier: Werde vor rechtsradikalen Parolen nicht einknicken
Allein ist sie mit dem Problem jedenfalls nicht. "In ganz Brandenburg und auch in Südbrandenburg nimmt der Rechtsextremismus erheblich zu", berichtet sie unter Berufung auf den brandenburgischen Verfassungsschutzbericht.
Angst vor den rechtsextremen Gruppen in Spremberg habe sie nicht. Sie sei keine "Schönwetterbürgermeisterin". Sie mache den Job nicht nur, um "irgendwo bunte Bändchen" durchzuschneiden.
Ich werde nicht vor diesen rechtsradikalen Parolen einknicken.
„
Christine Herntier
Das Interview mit Christine Herntier führte Christian Sievers, zusammengefasst hat es Marie Ahlers.
Quelle: dpa, ZDF
https://www.zdfheute.de/
Hilferuf der Bürgermeisterin
Rechtsextremismus in Spremberg – Brandenburgs Innenminister kündigt Hilfe an
Nach einem Brandbrief von Sprembergs Bürgermeisterin will Brandenburgs Innenminister Wilke den Verfassungsschutz einschalten. Auch weitere Stimmen beklagen nun einen wachsenden Einfluss Rechtsextremer in Stadt und Region.
20.07.2025, 14.07 Uhr
Brandenburgs Innenminister René Wilke: »So etwas kann keine Bürgermeisterin alleine bewältigen« Foto: Hannes P Albert / picture alliance / dpa
Schmierereien, verfassungsfeindliche Parolen, Verherrlichung von Adolf Hitler: In einem Brief an die Bürger hat Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier zahlreiche Umtriebe von Rechtsextremisten in der brandenburgischen Stadt beklagt – nun soll der Ort in der Lausitz mit knapp 22.000 Einwohnern Hilfe des Verfassungsschutzes bekommen.
Es werde einen Termin mit dem Verfassungsschutz vor Ort geben, »um zu schauen, wie wir die Stadt unterstützen können«, sagte Brandenburgs Innenminister René Wilke (parteilos) der Nachrichtenagentur dpa. Er wolle auch die Prävention an Schulen stärken.
Wilke sagte, er halte das Vorgehen der Bürgermeisterin für richtig: »Prinzipiell hat man ja als Bürgermeisterin oder Bürgermeister in solchen Fällen mindestens zwei Möglichkeiten. Die einen sagen: Oh Gott, bloß nicht öffentlich machen, denn das könnte den Ruf der Gemeinde irgendwie beschädigen. Die andere Strategie ist, Scheinwerferlicht zu erzeugen und zu sagen: Wir haben hier ein Problem, wir müssen uns darum kümmern, wir dürfen das nicht ignorieren. Das finde ich prinzipiell die richtige Herangehensweise.«
Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier klagte in einem Brief an die Bürger über rechte Umtriebe
Bild vergrößern
Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier klagte in einem Brief an die Bürger über rechte Umtriebe Foto: Soeren Stache / dpa-Zentralbild / dpa
Aus Sicht Wilkes sollten jetzt konkrete Maßnahmen in Spremberg folgen: »So etwas kann keine Bürgermeisterin allein bewältigen. Es braucht den Schulterschluss vieler. Alle müssen an einem Strang ziehen und sich mit ihren Möglichkeiten einbringen.« Um gegen eine Radikalisierung von Jugendlichen in Brandenburg anzugehen, soll es bei der Prävention laut Wilke einen größeren Schwerpunkt im Bereich der Medienbildung geben. Denn ein wesentlicher Teil der Radikalisierung finde online statt, sagte der Innenminister.
»Das Gefühl von Angst ist ziemlich weitverbreitet.«
Joschka Fröschner, Beratungsstelle Opferperspektive
Unterdessen zeigte sich über die Lage in der Stadt auch die Beratungsstelle Opferperspektive besorgt. »Die Leute, die sich demokratisch engagieren, sind in Spremberg sehr vorsichtig geworden. Das Gefühl von Angst ist ziemlich weitverbreitet in demokratischen Initiativen«, sagte der Berater Joschka Fröschner der dpa.
Bei den Bundestagswahlen erwies sich Spremberg zuletzt als Hochburg der AfD. Bei der Bundestagswahl im Februar dieses Jahres kam die AfD bei den Zweitstimmen auf 45,51 Prozent – weit vor CDU und SPD.
Mehr zum Thema
- Rechtsextremismus in Brandenburg: Wachsender Neonazi-Einfluss in Spremberg – Bürgermeisterin schlägt Alarm
Wachsender Neonazi-Einfluss in Spremberg – Bürgermeisterin schlägt Alarm
Projekt gegen Extremismus an Brandenburger Schule: »Wenn ich an diese Worte denke, schießen mir Tränen in die Augen« Von Silke Fokken
»Wenn ich an diese Worte denke, schießen mir Tränen in die Augen«
»Dass sich teils 12- bis 15-Jährige so offen rechts zeigen und äußern, das hatten wir seit Jahrzehnten nicht«, sagte Berater Fröschner weiter. Die rechtsextreme Szene sei sehr aktiv, um immer neue Jugendliche zu gewinnen.
Fröschner rief dazu auf, Angebote für Jugendliche zu stärken, die mit der rechten Szene nichts zu tun hätten. »Wenn nur noch die Rechten die Freizeitangebote bestimmen, ist es klar, wo es hingeht.« Wie der Spremberger Sozialarbeiter Benny Stobinski sagte, gelingt es Rechtsextremisten, Jugendliche mit Lagerfeuer, Sport und gemeinsamen Ausflügen zu gewinnen.
Das Problem mit Rechtsextremismus ist in Spremberg nicht neu. Vor mehr als zehn Jahren wurden dort Attacken rechtsextremer Gewalttäter bekannt. Lorenz Blumenthaler, der sich bei der Amadeu Antonio Stiftung mit Rechtsextremismus befasst, sagt, in der Lausitz komme es seit vier, fünf Jahren zu einer rechtsextremen »Landnahme«.
Immer wieder verweisen Verfassungsschützer gerade in Südbrandenburg auf eine rechtsextreme Szene. In Burg im Spreewald hatten bereits 2023 eine Lehrerin und ein Lehrer geschildert, wie sie täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert sind (lesen Sie hier dazu die große SPIEGEL-Reportage aus dem Jahr 2024).
Mehr zum Thema
Burg im Spreewald: Nazihausen, wirklich? Von Jonah Lemm und Sebastian Wells (Fotos)
Nazihausen, wirklich?
sol/dpa
https://www.spiegel.de/
2.5.4 Angriffe ausgehend von der Neuen Rechten, wie u.a. aus der AFD, gegen die politischen, gesellschaftlichen und juristischen Aufarbeitungen des Deutschen Kolonialismus
Forschung unter Verdacht
Parlamentarische Anfragen als politische Waffe?
Die AfD in Sachsen-Anhalt übt gezielt Druck auf kritische Forschung, internationale Studierende und studentische Vertretungen aus.
Foto: Mika Baumeister auf Unsplash, CC0
15.09.2025 - Kerstin Schöneich
Anfang Juni stellte die AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt eine Kleine Anfrage. Sie nimmt in der Anfrage postkoloniale Forschung an den Hochschulen im Land ins Visier. Liest sie sich zunächst oberflächlich wie eine reine Informationsanfrage, offenbart sie bei genauerem Hinsehen eine gefährliche Stoßrichtung: Die AfD möchte wissen, welche Wissenschaftler*innen sich in welchem Umfang an welchen Hochschulen in Sachsen-Anhalt mit postkolonialen Theorien beschäftigen, welche Fördermittel sie erhalten, verlangt eine detaillierte Auflistung von Lehrveranstaltungen, Teilnehmendenzahlen und Publikationen, auch studentischer Abschlussarbeiten. Ebenfalls wird abgefragt, ob es Kooperationen mit Wissenschaftler*innen ehemals kolonialisierter Länder gab und ob es landesseitig politische Initiativen zur Förderung der Aufarbeitung kolonialer Geschichte an Hochschulen gäbe.
Die Unterstellung, postkoloniale Studien seien per se ideologisch aufgeladen, zeugt nicht nur von Unkenntnis wissenschaftlicher Praxis. Sie ist ein Versuch, bestimmte Forschungsansätze zu diskreditieren und sie als „linksideologisch“ abzustempeln. Dabei wird Wissenschaft nicht als Erkenntnissuche verstanden, sondern als Feld, das in eine nationale, autoritäre Ordnung gepresst werden soll.
Die AfD-Anfrage zur Postkolonialismus-Forschung ist kein isolierter Vorfall. Vielmehr fügt sie sich in ein klares Muster ein: Die Partei betreibt eine systematische Wissenschaftsfeindlichkeit, indem sie bestimmte Forschungsbereiche immer wieder ins Visier nimmt, insbesondere solche, die sich kritisch mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen, Geschlecht, Rassismus oder Demokratie beschäftigen.
Vor dem Fokus auf Postkolonialismus wurde sich beispielsweise ausgiebig am Bereich Gender abgearbeitet. So erkundigte sich die AfD detailliert danach, an welchen Standorten und Lehrstühlen zu Genderstudies, Sexualwissenschaft und Sexueller Bildung geforscht wurde, in welchen Fachbereichen entsprechende Lehrangebote existieren und wie diese finanziert werden (DS 8/3660, 25.01.2024). Es folgte, gut ein halbes Jahr später ein Antrag, der in Trumpischer Manier die Wissenschaft gegen angebliche Einflüsse aus „Cancel Culture“, „Wokeismus“ und „Politische Korrektheit“ verteidigen wollte. Dabei unterstellte die AfD, dass an sachsen-anhaltinischen Hochschulen eine „linksliberale bis linksextremistische Hegemonie“ herrsche (DS 8/4243 vom 04.06.2024). Diskriminierung aufgrund politischer Einstellung wolle man entgegentreten – allerdings nur, wenn sie in das eigene Denken passt: Wiederum ein Jahr später folgte der Antrag „Wissenschaft statt Manipulation – Genderpolitik an Hochschulen einstellen!“ (DS 8/5572 vom 04.06.2025), der die Genderstudies aus den Hochschulen verbannen wollte, mit der Begründung, sie verfolge eine politische Agenda und sei nicht wissenschaftlich.
Es wird klar: kritische Wissenschaft soll als ideologische Spielwiese diffamiert werden. Dabei werden bestimmte Forschungsbereiche gezielt ins Visier genommen, mit dem Ziel, ihre gesellschaftliche sowie wissenschaftliche Relevanz in Zweifel zu ziehen. Dazu sollen sie öffentlich delegitimiert werden, indem sie immer wieder zum Gegenstand von parlamentarischen Angriffen gemacht werden.
Zur Wissenschaftsfeindlichkeit der AfD kommt ein weiteres Element hinzu: Der Rassismus der AfD, der sich zwar verdeckt, aber dennoch deutlich in Anfragen zu internationalen Studierenden zeigt. Auch hier geht es nicht um eine faire Auseinandersetzung mit hochschulpolitischen Fragen, sondern um eine Politik der Misstrauensrhetorik. In ihrer Anfrage 8/3015 vom 11.06.2025 werden so beispielsweise Verfahrensweisen zu Abschiebungen von ausländischen Studierenden hinterfragt, und ob es „auffällige Häufungen“ nach Fachrichtung und Herkunft unter den Betroffenen gebe und ob NGOs oder Organe der Studentischen Selbstverwaltung wie StuRa oder AStA die Betroffenen unterstützen würden.
Diese Art der Fragestellung ist perfid. Sie suggeriert nicht nur ein Fehlverhalten, wo keines ist, sondern schürt gezielt Ressentiments. Hochschulen, die sich für internationale Zusammenarbeit und studentische Solidarität einsetzen, werden auf diese Weise in ein diffamierendes Licht gerückt. Das Ziel: Angst erzeugen, Netzwerke der Unterstützung diskreditieren und den Druck auf internationale Studierende erhöhen.
Auch sonst wurden Gremien der Studierendenschaft bereits mit kleinen Anfragen anvisiert, besonders der Studierendenrat der MLU Halle (DS 8/81 und DS 8/4133) wegen Kooperationen mit linken und antifaschistischen Gruppen bei Veranstaltungen.
Die AfD nutzt parlamentarische Mittel systematisch, um Wissenschaftler*innen, Studierende und Gremien unter Druck zu setzen. Der Effekt: Einschüchterung. Wer zu Kolonialismus, Gender, Rassismus oder sozialer Ungleichheit forscht, muss befürchten, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden.
Kritische Wissenschaft, die bestehende Machtverhältnisse hinterfragt, gerät so ins Visier eines autoritären Reflexes, der auf Kontrolle und Konformität zielt. Das ist ein Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit und ein alarmierendes Zeichen für ein Denken, das autokratische Züge trägt.
Die GEW steht für eine wirklich freie Wissenschaft. Eine Wissenschaft, die sich nicht einschüchtern lässt, die kritisch bleibt und sich nicht der Logik rechter Kulturkämpfe beugt. Wir müssen wachsam bleiben. Und wir müssen uns einmischen, mit Haltung, Solidarität und klarer Kante gegen Wissenschaftsfeindlichkeit.
https://hallespektrum.de/
AfD-Anfrage im Landtag Sachsen-Anhalt: Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit?
11.06.2025
Zwischen Transparenz und Einschüchterung: Warum die AfD-Kritik an postkolonialer Forschung gefährlich ist
Mit einer parlamentarischen Anfrage zur postkolonialen Forschung an Hochschulen in Sachsen-Anhalt sorgt die AfD-Fraktion im Landtag für Irritation – nicht nur unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Kritiker sehen in der detaillierten Auflistung von Lehrveranstaltungen, Forschungsprojekten, Personalstellen und Drittmitteln einen gezielten Versuch, kritische Wissenschaft zu delegitimieren und politisch unter Druck zu setzen.
Die AfD, vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, stellt dabei unter anderem die Frage, welche Hochschulen sich mit „vermeintlichem kolonialem Raubgut“ beschäftigen, wie viele Mittel für entsprechende Projekte verwendet wurden und ob Kooperationen mit Wissenschaftlern aus ehemaligen Kolonien bestehen. Auch die Rolle kolonialer Aufarbeitung in Hochschulstrategien, etwa in Leitbildern oder Diversity-Konzepten, wird abgefragt.
Wissenschaft unter Generalverdacht?
Was auf den ersten Blick wie eine sachliche Informationsanfrage wirkt, hat bei genauerer Betrachtung politische Sprengkraft. Die Formulierungen und der Kontext lassen erkennen: Hier geht es nicht um wissenschaftliche Neugier, sondern um Misstrauen gegenüber kritischer Forschung. Die AfD unterstellt postkolonialen Studien eine politische Schlagseite und zieht ihre Wissenschaftlichkeit offen in Zweifel.
„Solche Anfragen haben eine klare Funktion: Einschüchterung, Delegitimierung und letztlich Kontrolle“, warnt ein Mitarbeiter eines Institus der Uni Halle, der anonym bleiben möchte. „Wer Forschung zu Kolonialismus, Rassismus oder globalen Machtverhältnissen betreibt, soll sich rechtfertigen müssen – das ist ein autoritärer Reflex.“
Angriff auf die Autonomie der Hochschulen
Die Wissenschaftsfreiheit ist in Deutschland grundgesetzlich geschützt. Dazu gehört nicht nur die Freiheit, Themen zu wählen, sondern auch, Forschung unabhängig von politischer Einflussnahme durchzuführen. Gerade postkoloniale Studien sind Teil einer internationalen Wissenschaftstradition, die sich mit den historischen und gegenwärtigen Folgen von Kolonialismus, strukturellem Rassismus und globalen Ungleichheiten auseinandersetzt.
Dass die AfD diese Themen ins Visier nimmt, ist kein Zufall. Sie passen nicht in das identitäre Weltbild der Partei, die sich regelmäßig gegen Gender Studies, Antirassismus und kritische Geschichtsschreibung positioniert. Die jüngste Anfrage kann somit als Teil einer umfassenderen Strategie verstanden werden, pluralistische Wissenschaft zu diskreditieren und durch ideologisch gesteuerte Inhalte zu ersetzen.
Hochschulrektorenkonferenz warnt vor politischem Druck
Deutlich wird auch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK). In einer Stellungnahme vom Januar 2024 erklärte sie angesichts wachsender Wissenschaftsfeindlichkeit und rechtsextremer Diskursverschiebungen:
„Die steigende Tendenz im öffentlichen und politischen Raum, den gesellschaftlichen Diskurs inhaltlich und tonal zu verändern, um Wissenschaftsfeindlichkeit, Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit, Rassismus, Intoleranz und auf Ausgrenzung fußende Ideen und Feindbilder zu normalisieren, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu zersetzen und das Vertrauen in die freiheitliche Demokratie zu untergraben, ist höchst alarmierend. Dem stellen wir uns als Präsidium der HRK klar entgegen. Jedes einzelne Mitglied unserer Hochschulen ist gefordert, für die Grundwerte unserer Verfassung einzutreten.“
(Quelle: HRK, 23. Januar 2024)
Diese Position unterstreicht: Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit bedrohen nicht nur einzelne Forschungsbereiche – sie gefährden die demokratische Grundordnung insgesamt.
Was auf dem Spiel steht
Der Schaden solcher Anfragen ist nicht sofort sichtbar – er zeigt sich langfristig. In Form von Selbstzensur, eingeschränkter Themenwahl oder sinkender Bereitschaft, öffentlich über sensible Inhalte zu sprechen. Besonders betroffen sind junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Die Angst, politisch ins Visier zu geraten, ist real.
https://hallespektrum.de/
2.5.5 Sicherheitsgefährdende Angriffe gegen die BRD ausgehend von der Neuen Rechten, wie u.a. aus der AFD
Innenpolitik
Keine Ermittlungen gegen Maier nach AfD-Anzeigen
dpa 20.01.2026 - 16:59 Uhr
Mit Anzeigen gegen den Innenminister hat die AfD vorerst nichts erreicht. Die Staatsanwaltschaft sieht keinen Anlass für Ermittlungen gegen Georg Maier.
Innenminister Georg Maier (SPD) setzt sich für ein Verbotsverfahren gegen die AfD ein. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa
Erfurt (dpa/th) - Nach Anzeigen der AfD und ihres Partei- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke ermittelt die Erfurter Staatsanwaltschaft nicht gegen Innenminister Georg Maier (SPD). Eine Prüfung habe keine zureichenden Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Handeln ergeben, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit.
Maier wirft AfD Missbrauch des Fragerechts vor
Die AfD und Höcke haben Maier mehrfach angezeigt. Hintergrund ist unter anderem, dass der Innenminister erklärt hatte, er erkenne bei der AfD Anhaltspunkte für einen Missbrauch des parlamentarischen Fragerechts, um kritische Infrastruktur im Sinne Russlands auszuforschen. Zudem setzt er sich für ein AfD-Verbotsverfahren ein. Die Partei, die die größte Landtagsfraktion stellt, wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.
In der vergangenen Woche war die AfD auch mit einem Entlassungsantrag gegen Maier im Landtag gescheitert. Bei einer Sondersitzung stellten sich die Abgeordneten mehrheitlich hinter den SPD-Politiker, Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) sprach ihm sein Vertrauen aus und kritisierte Vorwürfe gegen Maier.
https://www.kurier.de/
Spionagevorwürfe
Energie, Militär, Rüstung – AfD stellt Tausende Anfragen in Landtagen
Thüringens Innenminister warf der AfD vor, an Informationen im Sinne Russlands gelangen zu wollen. Eine SPIEGEL-Analyse zeigt: Die Partei reichte seit 2020 gut 7000 sicherheitsrelevante Anfragen ein.
Von Lukas Eberle und Patrick Stotz
20.11.2025, 16.34 Uhr • aus DER SPIEGEL 48/2025
- Bild vergrößern
Panzerhaubitze in Bayern: Verdächtiger Wissensdrang Foto: Armin Weigel / picture alliance
Die AfD-Fraktionen in den deutschen Landesparlamenten haben seit Anfang 2020 mehr als 7000 Kleine Anfragen mit sicherheitsrelevanten Bezügen gestellt – so viele wie keine andere Partei. Das ist das Ergebnis einer SPIEGEL-Analyse von mehr als 100.000 Drucksachen, die zentral vom Landtag in Düsseldorf auf der Webseite parlamentsspiegel.de katalogisiert werden.
Die AfD stellte in absoluten Zahlen die meisten Anfragen mit Schlagworten aus den Bereichen Militär, Rüstung oder Katastrophenschutz. In 503 Fällen ging es um medizinische Versorgung, in 379 um öffentliche Sicherheit und in 321 um Energieversorgung. Besonders viele Anfragen gab es in Thüringen, Bayern und Sachsen.
Parlamentarische Anfragen, vor allem ein Werkzeug von Oppositionsfraktionen, sollen der demokratischen Kontrolle von Regierungen dienen. Wegen ihrer teils detaillierten Fragen, etwa zu Routen von Militärtransporten in die Ukraine, steht die AfD jedoch in der Kritik. Georg Maier, SPD-Innenminister von Thüringen, verdächtigte die Partei kürzlich, mit ihrem Wissensdrang die kritische Infrastruktur im Interesse Russlands ausforschen zu wollen.
Der AfD-Abgeordnete Ringo Mühlmann geriet dabei besonders in den Fokus, seine Partei und er dementierten die Vorwürfe. Laut SPIEGEL-Analyse stellte Mühlmann seit 2020 mehr als 200 Anfragen zu sicherheitsrelevanten Themen.
Verdächtige Anfragen: Beschaffen AfD-Politiker Informationen für Russland? Von Fabian Hillebrand
Beschaffen AfD-Politiker Informationen für Russland?
Spionagevorwürfe gegen AfD: »Sehr detaillierte Anfragen zu Fähigkeitslücken der Bundeswehr« Von Matthias Gebauer, Paul-Anton Krüger und Wolf Wiedmann-Schmidt
»Sehr detaillierte Anfragen zu Fähigkeitslücken der Bundeswehr«
Auch unabhängig von der inhaltlichen Ausrichtung reichte die AfD die meisten Anfragen ein: bezogen auf alle Landtage waren es fast 40.000 seit 2020. Allein in Sachsen nutzte die Partei ihr Auskunftsrecht in mehr als 10.000 Fällen, was rund sieben Anfragen pro Werktag entspricht. In den vergangenen Jahren nahm das Thema Innere Sicherheit bei der AfD anteilig einen größeren Raum ein. Fast elf Prozent ihrer Anfragen gehören inzwischen zu diesem Bereich.
https://www.spiegel.de/
Spiegel-Analyse: AfD stellt über 7.000 Anfragen zu Militär und Infrastruktur
20.11.2025
Mehr als 7.000 sicherheitsnahe Anfragen hat die AfD seit 2020 in Landesparlamenten gestellt – keine Partei war aktiver in Bereichen wie Militär, Energie oder Katastrophenschutz. Die Partei steht deshalb erneut in der Kritik. Der Verdacht: gezielte Informationsbeschaffung im Interesse Russlands.
Berlin (red) – Die AfD hat seit Anfang 2020 in den Landesparlamenten offenbar mehr als 7.000 Anfragen mit sicherheitsrelevanten Bezügen gestellt – so viele wie keine andere Partei. Das ist das Ergebnis einer Analyse des “Spiegels” von mehr als 100.000 Drucksachen, die zentral vom Landtag in Düsseldorf katalogisiert wurden.
Die AfD stellte dem Nachrichtenmagazin zufolge in absoluten Zahlen die meisten Anfragen mit Schlagworten aus den Bereichen Militär, Rüstung oder Katastrophenschutz. In 503 Fällen ging es um medizinische Versorgung, in 379 um öffentliche Sicherheit und in 321 um Energieversorgung, hieß es. Besonders viele Anfragen gab es laut “Spiegel” in Thüringen, Bayern und Sachsen.
Parlamentarische Anfragen, vor allem ein Werkzeug der Opposition, sollen der Kontrolle von Regierungen dienen. Wegen ihrer teils detaillierten Fragen, etwa zu Routen von Militärtransporten in die Ukraine, steht die AfD jedoch in der Kritik. Georg Maier (SPD), Innenminister von Thüringen, verdächtigte die Partei kürzlich, mit ihrem Wissensdrang die kritische Infrastruktur im Interesse Russlands ausforschen zu wollen. Die Partei weist die Vorwürfe zurück.
https://www.ludwigsburg24.com/
Bericht: AfD stellte 7.000 Anfragen mit Sicherheits-Bezügen
Berlin - Die AfD hat seit Anfang 2020 in den Landesparlamenten offenbar mehr als 7.000 Anfragen mit sicherheitsrelevanten Bezügen gestellt - so viele wie keine andere Partei. Das ist das Ergebnis einer Analyse des "Spiegels" von mehr als 100.000 Drucksachen, die zentral vom Landtag in Düsseldorf katalogisiert wurden.
20.11.2025
Die AfD stellte dem Nachrichtenmagazin zufolge in absoluten Zahlen die meisten Anfragen mit Schlagworten aus den Bereichen Militär, Rüstung oder Katastrophenschutz. In 503 Fällen ging es um medizinische Versorgung, in 379 um öffentliche Sicherheit und in 321 um Energieversorgung, hieß es. Besonders viele Anfragen gab es laut "Spiegel" in Thüringen, Bayern und Sachsen.
Parlamentarische Anfragen, vor allem ein Werkzeug der Opposition, sollen der Kontrolle von Regierungen dienen. Wegen ihrer teils detaillierten Fragen, etwa zu Routen von Militärtransporten in die Ukraine, steht die AfD jedoch in der Kritik. Georg Maier (SPD), Innenminister von Thüringen, verdächtigte die Partei kürzlich, mit ihrem Wissensdrang die kritische Infrastruktur im Interesse Russlands ausforschen zu wollen. Die Partei weist die Vorwürfe zurück.
https://www.finanznachrichten.de/
Eine Anfrage auch aus SH
Liefert die AfD Russland sicherheitsrelevante Informationen auf dem Silbertablett?
Von Eckard Gehm | 19.11.2025, 17:52 Uhr 4 Leserkommentare
Beitrag hören:
06:09
ARCHIV - 30.11.2019, Niedersachsen, Braunschweig: Das Logo der AfD wird beim Bundesparteitag auf einen Vorhang projeziert. (zu dpa: «AfD will «Baby-Begrüßungsgeld» nur für Deutsche») Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
Da Logo der AfD: Politiker verschiedener Bundesländer kritisieren die Anfragen der Partei zu sicherheitspolitischen Themen.Foto: Sina Schuldt
In verschiedenen Bundesländern haben Politiker der AfD vorgeworfen, dass die Partei auffällig viele Anfragen zu sicherheitsrelevanten Themen stellt. Ein Beispiel gibt es auch aus Schleswig-Holstein.
https://www.shz.de/
Gehen Infos nach Moskau?
AfD-Anfragen zur Infrastruktur und Drohnenabwehr lösen Sorge um Spionage aus
Von afp | 06.11.2025, 16:01 Uhr
Beitrag hören:
04:28
HANDOUT - 20.04.2024, Russland, Moskau: Dieses vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums zur Verfügung gestellte Foto zeigt Drohnen am Himmel. (zu dpa: «Kiews Militär wirft Moskau gezielte Tötungen vor») Foto: Uncredited/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++
Politiker beobachten mit Argwohn, dass von der AfD viele Anfragen zur Drohnenabwehr kommen. Sie vermuten, dass sensible Informationen an Russland weitergegeben werden könnten. Symbolfoto: dpa
Die AfD stellt vermehrt parlamentarische Anfragen zur kritischen Infrastruktur. Politiker aus SPD und CSU warnen vor möglichem Missbrauch und fordern eine Beschränkung der öffentlichen Zugänglichkeit der Antworten.
https://www.noz.de/
Spionageverdacht:
Ein Landesverrat der AfD?
Ein Kommentar von Thomas Holl
22.10.2025, 16:41Lesezeit: 2 Min.
Interessiert an Informationen zu Polizei und Bundeswehr: Björn Höcke, Fraktionschef der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, und Wiebke Muhsal, Parlamentarische Geschäftsführerin der AfD-Fraktion
Es ist kein Geheimnis, dass bedeutende Teile der AfD Sympathien für Putins Regime zeigen. Dennoch wäre es falsch, die Nutzung eines der schärfsten parlamentarischen Schwerter infrage zu stellen.
Spionieren Abgeordnete der AfD im Thüringer Landtag, aber auch im Bundestag in Putins Auftrag gezielt die deutsche Sicherheitsarchitektur und kritische Infrastruktur aus? Diesen Verdacht äußert der Thüringer SPD-Innenminister Georg Maier auch mit Hinweis auf einen „landesverräterischen Aspekt“ für ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD. Ein Spionageverdacht, den auch der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums im Bundestag, Marc Henrichmann (CDU), teilt.
https://www.faz.net/
Bayerischer Landtag
Antwort bald geheim? Aigner reagiert auf AfD-Anfragen zu Sicherheitsthemen
09.09.2025, 11:06 Uhr|Lesezeit: 2 Min.
Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner will prüfen, ob parlamentarische Anfragen zu kritischer Infrastruktur als Verschlusssache deklariert werden müssen.
(Foto: Frank Hoermann/Imago)
Bayerns Landtagspräsidentin findet es „auffällig“, dass die AfD-Fraktion zunehmend Informationen zur kritischen Infrastruktur einfordert. Sie will eine Änderung des Fragerechts prüfen.
Von Thomas Balbierer
Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat sich beunruhigt über eine Zunahme parlamentarischer Anfragen der AfD-Fraktion zu sicherheitsrelevanten Themen geäußert. In einem Podcast von Politico sagte Aigner, es sei „auffällig, dass hier sehr viele Fragen zur kritischen Infrastruktur gestellt werden“. Sie nahm dabei Bezug auf Äußerungen des thüringischen Innenministers Georg Maier (SPD), der im Oktober den Verdacht geäußert hatte, „dass die AfD mit ihren Anfragen eine Auftragsliste des Kremls abarbeitet“. Die AfD hat den Vorwurf als falsch zurückgewiesen und geht juristisch gegen Maiers Behauptung vor.
Aigner sagte, sie habe keine Erkenntnisse dazu, ob am Spionage-Verdacht etwas dran sei. Allerdings habe sie festgestellt, „dass diese Fragen im bayerischen Landtag sehr wohl sehr intensiv gestellt wurden und wohl flächendeckend gestellt werden“. Die CSU-Politikerin warf deshalb die Frage auf, ob bestimmte Antworten auf schriftliche Anfragen im Parlament zukünftig der Geheimhaltung unterliegen sollten.
Grundsätzlich sind parlamentarische Anfragen und dazugehörige Antworten öffentlich zugänglich, jeder kann sie auf der Internetseite des Landtags abrufen. Wer aber eine Verschlusssache weitergebe, so Aigner, bewege sich in „Richtung Spionage“.
Auf SZ-Anfrage konkretisierte die Landtagspräsidentin ihren Vorstoß. Schon heute sei der Informationsanspruch von Abgeordneten durch das Geheimhaltungsinteresse der Regierung begrenzt – etwa dann, wenn eine Antwort das Staatswohl berühren könnte, teilte Aigners Sprecherin mit. „Nun muss geprüft werden, ob eine Veränderung der bestehenden Regeln notwendig ist. Für die Einstufung von Antworten auf schriftliche Anfragen als Verschlusssache ist aus Sicht der Präsidentin aber entscheidend, dass dies nur bei sicherheitsrelevanten Informationen zu rechtfertigen ist.“ Am Ende müsse nach Abwägung stets eine Einzelfallentscheidung stehen. Das Fragerecht sei zentral für den Parlamentarismus.
Die bayerische AfD-Fraktion wies eine mögliche Nähe zu Spionagetätigkeiten auf SZ-Anfrage als „infame Unterstellung“ zurück. In Zeiten multipler Krisen seien „die Themen Sicherheit, Zivilschutz und Gefahrenabwehr weit oben auf die Tagesordnung gerückt“, erklärte ein Sprecher die Häufung von Anfragen. Auch andere Fraktionen würden sich für diese Fragen interessieren. „Die Bürger in Bayern haben schließlich das Recht zu erfahren, ob die Staatsregierung alles Erforderliche zu ihrem Schutz tut.“ Eine Regeländerung hält die AfD für unnötig, da die Ministerien schon jetzt Auskünfte verweigern könnten. „Was Frau Aigner hier betreibt, ist Nebelkerzen-Weitwurf.“
CSU sieht „Dutzende Anfragen der AfD zu Anzahl, Art und Standorten von Polizeidrohnen, zu Zivilschutzeinrichtungen“
Unterstützung für Aigners Vorstoß kam aus der CSU-Fraktion. „Allein 2025 gab es im bayerischen Landtag Dutzende Anfragen der AfD zu Anzahl, Art und Standorten von Polizeidrohnen, zu Zivilschutzeinrichtungen oder zur Bewaffnung von Polizei und Spezialkräften“, teilte CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek mit. „Das ergibt ein klares Bild: Die AfD nutzt die Rechte der parlamentarischen Demokratie, um ihr Fundament zu untergraben.“ Wer gezielt nach Sicherheitslücken frage, dem gehe es nicht um Transparenz, sondern um Schwachstellen. „Gegen eine verantwortungsvolle und konsequente Anwendung von Verschlusssachen kann auch kein Parlamentarier etwas haben“, so Holetschek.
Auch Florian Streibl, Fraktionschef der Freien Wähler, sieht „die Gefahr, dass Antworten auf die Fragen der AfD zur kritischen Infrastruktur an fremde Dienste gelangen“. Er wies auf eine geplante Russlandreise von vier AfD-Abgeordneten hin, die sich Mitte November mit russischen Parlamentariern treffen wollen. Ein solches Treffen zeige, „dass die AfD weder eine national orientierte noch patriotische Partei ist, sondern mit feindlich gesinnten Mächten kooperiert“. Streibl sieht in der Einstufung von Antworten als Verschlusssache „eine Möglichkeit, der aufgezeigten Gefahr zu begegnen“.
Zurückhaltender äußerte sich die SPD. „Das Ganze hat zwei Seiten: Einerseits wollen auch wir, dass sensible Informationen geschützt bleiben und nicht nach Russland abwandern“, sagte Christiane Feichtmeier, innenpolitische Sprecherin der SPD. „Andererseits ist es Aufgabe des Parlaments, die Regierung zu kontrollieren – und dazu brauchen wir die nötigen und manchmal auch sensiblen Informationen.“ Sie warnte deshalb vor einem „Schnellschuss“.
https://www.sueddeutsche.de/
2.5.5.1 Strafanzeigen vom 30.11.2025 gegen die Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz wegen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung und Prozessbetrug, Begünstigung von Landesverrat- und Hochverrat-Bestrebungen, Unterschlagung und Unterdrückung von Beweismaterialien aus Verfahren beim Amtsgericht und in Verfahren beim Landgericht Mosbach der seit 2022 beantragten juristischen Aufarbeitungen (a =>) … von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933, (b =>) … von Reichsbürger- und AFD-Prozessen mit nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen nach 1945, (=> c) … zu Leugnung und Relativierung von deutschen Kolonialverbrechen, (=> d) …zu Leugnung und Relativierung von NS-Verbrechen, (=> e) … von sicherheitsgefährdenden Angriffen gegen die BRD ausgehend von der Neuen Rechten, wie u.a. aus der AFD, an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg
>>> 6F 9/22, 6F 202/21, etc. <<<
30.11.2025
AUS AKTUELLEN ANLÄSSEN:
>>> Mehrheitsbeschaffung der CDU für Bundestagsanträge
im Bundestagswahlkampf 2025 mit der AFD
unmittelbar beginnend nach der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag
für die Opfer des Nationalsozialismus
am 29.01.2025 <<<
>>> Öffentliche Benennung des 1108-seitigen Gutachtens
des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV)
durch das Bundesinnenministerium (BMI)
zur Hochstufung der AFD als gesichert erwiesen rechtsextremistisch
am 02.05.2025 <<<
>>> Zurückweisung am 22.07.2025 durch das Bundesverwaltungsgericht der AFD-Beschwerden gegen ihre Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Damit sind drei Entscheidungen des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) aus dem vergangenen Jahr rechtskräftig. Keine Zulassung der Revision gegen die Urteile des OVG Münster zur Einstufung der AfD als "Verdachtsfall",
der Beobachtung ihrer internen Sammlungsbewegung "Der Flügel" und ihrer
Jugendorganisation "Junge Alternative" durch das BfV <<<
>>> Strafanzeigen gegen die Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz
wegen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung und Prozessbetrug,
Begünstigung von Landesverrat- und Hochverrat-Bestrebungen,
Unterschlagung und Unterdrückung von Beweismaterialien
aus Verfahren beim Amtsgericht und in Verfahren beim Landgericht Mosbach
der seit 2022 beantragten juristischen Aufarbeitungen
(a =>) … von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten
Umsturzplänen bis 1933,
(b =>) … von Reichsbürger- und AFD-Prozessen mit nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen nach 1945,
(=> c) … zu Leugnung und Relativierung von deutschen Kolonialverbrechen,
(=> d) …zu Leugnung und Relativierung von NS-Verbrechen,
(=> e) … von sicherheitsgefährdenden Angriffen gegen die BRD ausgehend von
der Neuen Rechten, wie u.a. aus der AFD,
während ihrer amtsseitigen Verantwortung diesbzgl. problematischer
Verfahrungsführungen bei der Mosbacher Justiz
an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler,
Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)
der CDU Baden-Württemberg
§ 158
Strafanzeige; Strafantrag
Die Anzeige einer Straftat und der Strafantrag können bei den Staatsanwaltschaften und Amtsgerichten schriftlich angebracht werden. Dem Verletzten ist auf Antrag der Eingang seiner Anzeige schriftlich zu bestätigen. Die Bestätigung soll eine kurze Zusammenfassung der Angaben des Verletzten zu Tatzeit, Tatort und angezeigter Tat enthalten.
INSBESONDERE vor dem seit vielen Jahren zunehmenden Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Deutschland, u.a. in und aus der AFD, mit Thematisierungen von Geschichtsklitterung, Geschichtsrevisionismus, volksverhetzender Leugnung und Verharmlosung von NS-Verbrechen; Forderungen einer deutschen erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad bei der konkreten NS-Vergangenheitsbewältigung, bei der NS-Öffentlichkeits- und Gedenkstättenarbeit, bei der NS-Bildungsarbeit
... Die HIER o.g. beschuldigte und angezeigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert im zuvor genannten Kontext mehrfach wiederholt seit 2022 ausgehend von o.g. Verfahrenskomplex HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR die folgenden KONKRETEN HISTORISCHEN Sachverhalte, die seit vielen Jahren in politischen, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, juristischen und medienöffentlichen Wirklichkeitskontexten thematisiert werden, ihrerseits amtsseitig EXPLIZIT zu berücksichtigen und ihrerseits amtsseitig EXPLIZIT zu thematisieren während ihrer amtsseitigen Verantwortung für HIER dargelegte und belegte problematische Verfahrungsführungen seit 2022 in bei der Mosbacher Justiz bzgl. KONKRET beantragten Verfahren zu nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933 und seit 1945.
SIEHE AUCH: Die Material- und Zitatsammlung, Beweissammlung u.a. aus historischen, politischen, zivilgesellschaftlichen, juristischen, wissenschaftlichen Quellen und Medienberichten... benannt von der bereits mehrfach beantragt mit Dienstaufsicht beschwerten Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess selbst unter 6F 202/21 und 6F 9/22 am 17.08.2022 unter…
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/
>>> SIEHE AUCH: FACEBOOK-GRUPPE: Aufarbeitung von Nazi-Unrecht und Nazi-Verbrechen >>> https://www.facebook.com/groups/954312666630761
SIEHE AUCH IM FOLGENDEN…
+++ +++ +++
>>> >>> Die HIER angezeigte und o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert ihrerseits amtsseitig wie HIER dargelegt und belegt im o.g. Verfahrenskomplex seit 2022 ABER AUCH IM REICHSBÜRGERPROZESS BEIM LANDGERICHT MOSBACH im August 2025 EXPLIZIT zu benennen, dass die in ihrer eigenen Zuständigkeit mit Dienstaufsicht beschwerte Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess im o.g. Verfahrenskomplex die vom Beschwerdeführer beantragten juristischen Aufarbeitungen bzgl. nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierter Umsturzversuche vor 1933 (Hitler-Putsch-Prozess) und nach 1945 in Deutschland unter Beteiligungen von Reichsbürgern und AFD-Mitgliedern zu bearbeiten. UND DABEI HALTBAR NACHWEISBAR AKTENKUNDIG sowohl Eingang, Weiterbearbeitung und Zuständigkeitsverweisungen der diesbzgl. KONKRETEN Anträge verweigert, zu bestätigen und mitzuteilen (SIEHE Verfahrenslistungen weiter unten).
>>> >>> Die HIER angezeigte und o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert ihrerseits amtsseitig wie HIER dargelegt und belegt im o.g. Verfahrenskomplex seit 2022 ABER AUCH IM REICHSBÜRGERPROZESS BEIM LANDGERICHT MOSBACH im August 2025 EXPLIZIT zu benennen, dass die in ihrer eigenen Zuständigkeit mit Dienstaufsicht beschwerte Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess im o.g. Verfahrenskomplex versucht, HALTBAR NACHWEISBAR AKTENKUNDIG und WAHRHEITSWIDRIG den Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter als angeblich psychisch krank und erziehungsfähig im Kontext von Familenrechtsverfahren zu diskreditieren (Vgl. diesbzgl. Gutachten vom 23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 202/21), u.a. EBEN AUF GRUND seiner KONKRET beantragten juristischen Aufarbeitungen bzgl. nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierter Umsturzversuche vor 1933 (Hitler-Putsch-Prozess) und nach 1945 in Deutschland unter Beteiligungen von Reichsbürgern und AFD-Mitgliedern beim Amtsgericht Mosbach. UND DIES HIER ABER während das gerichtlich beauftrage Gutachten vom 23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 202/21 DANN die KONKRETEN „ANZEIGEN GEGEN ADOLF HITLER“ des begutachteten Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters EXPLIZIT benennt. UND diese als NICHT psychisch krank bewertet. (SIEHE erläuternde Darlegung weiter unten).
>>> >>> Die HIER angezeigte und o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert ihrerseits amtsseitig wie HIER dargelegt und belegt im o.g. Verfahrenskomplex seit 2022 ABER AUCH IM REICHSBÜRGERPROZESS BEIM LANDGERICHT MOSBACH im August 2025 EXPLIZIT zu benennen, dass die in ihrer eigenen Zuständigkeit mit Dienstaufsicht beschwerte Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess im o.g. Verfahrens-komplex HALTBAR NACHWEISBAR AKTENKUNDIG seit 2022 EXPLIZIT verweigert, u.a. folgende Sachverhalte zu Reichsbürger-Prozessen bzgl. rechtsextremistischer Umsturzversuche im Neckar-Odenwaldkreis, in benachbarten Landkreisen und in Baden-Württemberg, auf die der Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter ABER im o.g. Verfahrenskomplex explizit hingewiesen hatte, SOGAR AUCH selbst ENTGEGEN dem Amtsermittlungsgrundsatz ihrerseits EXPLIZIT zu benennen…:
… Der SEK Einsatz zur Beschlagnahmung von Waffen, bei dem von den angeklagten Reichsbürgern auf Polizisten geschossen wurde im April 2022 in Boxberg (Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts Mosbach). >>>
… Das Oberlandesgericht Stuttgart verurteilte Ingo K. im November 2023 zu einer Haftstrafe von 14 Jahren und sechs Monaten. Wegen Mordversuchs und auch, weil in seiner Erdg schosswohnung eine Kammer mit acht Schusswaffen und 5.116 Schuss Munition entdeckt worden war. >>>
… Baden-Württemberg: Sie wollten die Bundesregierung stürzen: Ein Jahr "Reichsbürger"-Prozess in Stuttgart-Stammheim. Am 29. April 2024 begann einer der drei "Reichsbürger"-Prozesse in Stuttgart. Es geht um Hochverrat und eine terroristische Vereinigung. Zwei Angeklagte kommen aus Ettlingen und Pforzheim, die laut Anklage unter anderem Teil einer terroristischen Vereinigung gewesen sein sollen. Gemeint ist die "Patriotische Union" oder "Gruppe Reuß" um ihren womöglichen Anführer Heinrich XIII. Prinz Reuß. In Stuttgart sind neun Personen angeklagt. Sie sollen der "militärische Arm" der Gruppe gewesen sein. Ihre Aufgabe laut Anklage: Vor allem die Machtübernahme mit Waffengewalt planen und durchsetzen. Laut der Anklage des Generalbundesanwalts wollten die Gruppe Reuß die "staatliche Ordnung in Deutschland [...] überwinden" und eine eigene Staatsform errichten - mit Prinz Reuß an der Spitze. Insgesamt vereine die Beschuldigten eine tiefe Ablehnung gegen die Bundesrepublik Deutschland und deren demokratische Grundordnung. Um ihre Ziele zu erreichen, plante die Gruppe offenbar den gewaltsamen Umsturz "durch den Einsatz militärischer Mittel und Gewalt gegen staatliche Repräsentanten", heißt es in der Anklage weiter. Dass das Vorhaben auch Menschenleben fordern werde, das sei den Angehörigen der Gruppe bewusst gewesen. Dazu soll die ehemalige Richterin und frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann, auch Teil der mutmaßlichen Terror-Vereinigung, anderen Mitgliedern Zugang zum Bundestagsgebäude ermöglicht haben. Diese sollen das Gebäude ausgespäht haben, um die Erstürmung besser zu planen.>>>
… Kalla Lebensquelle: Pseudomedizin fürs "Königreich". Anfang Mai 2025 hat das Bundesinnenministerium den "Reichsbürger"-Fake-Staat "Königreich Deutschland" verboten. Der hatte eigene Banken, eigenes Geld, eigene Versicherungen, eigene Betriebe. Einen davon im Taubertal. Offenbar wirtschaftete er im Verborgenen. Nach dem Verbot der Reichsbürger-Gruppe "Königreich Deutschland" wurden am 13. Mai zahlreiche Häuser u.a. in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg waren auch mehrere "Betriebe" des "Königreichs Deutschland" tätig. Nach Kontext-Recherchen war ein "Betrieb" mit dem Namen "Kalla Lebensquelle" in Bad Mergentheim ansässig. Die "Kalla Lebensquelle" bot – auf Basis der "Germanischen Neuen Medizin" nach Ryke Geerd Hamer (1935 bis 2017) – Gespräche, Seminare und Vorträge an. >>>
… Landgericht Mosbach: Angeklagte aus "Reichsbürger"-Szene fehlen zum Prozessstart Anfang Mai 2025 !!! Fünf Angeklagte sollen Waffen besessen und mit einem "Reichsbürger" zusammengewohnt haben. Der Mann schoss 2022 bei einem SEK-Einsatz auf Beamte. Der Prozess steht im Zusammenhang mit dem eskalierten Polizeieinsatz bei einem "Reichsbürger" im badischen Boxberg: Weil sie unerlaubt Waffen besessen haben sollen. Kammer prüft weiteres Vorgehen. Der Prozess hätte eigentlich bereits im Mai beginnen sollen. Doch die Angeklagten erschienen nicht vor Gericht. Sie wurden bald darauf festgenommen und blieben bis zum Prozessauftakt in Untersuchungshaft. >>>
… Terrorgruppe plante gewaltsamen Umsturz: Rechtsextreme "Vereinte Patrioten": Anklage gegen mutmaßliche Unterstützer aus BW ! Zwei Männer aus BW sollen 2022 der terroristischen Vereinigung bei Umsturzplänen geholfen haben. Laut Anklage sollen sie die Gruppe bei technischen Fragen unterstützt haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart hat Ende Juni 2025 zwei Männer wegen der Unterstützung einer rechtsextremen Terrororganisation angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, die "Kaiserreichsgruppe", die auch unter dem Namen "Vereinte Patrioten" bekannt ist, unterstützt zu ha-ben. Die im Frühjahr 2022 zerschlagene Gruppe aus dem Milieu der "Reichsbürger" plante laut Anklage einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland, die Entführung des damaligen Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) sowie weitreichende Anschläge auf die Stromversorgung. Ziel der Gruppe war die Errichtung einer autoritären Regierungsform nach dem Vorbild des 1918 untergegangenen Deut-schen Kaiserreichs. Die Männer stammen aus Rhein-Neckar-Kreis und Rems-Murr-Kreis.
... An fünf Tagen im Juli und August, wollte das Landgericht Mosbach klären, wem die Schusswaffen und die Cannabis-Plantage gehörten. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe beschuldigte die Familie A. Mit Fußfesseln saßen die drei Männer und zwei Frauen auf der Anklagebank. Eigentlich hätte die Verhandlung im Mai 2025 stattfinden sollen. Die Angeklagten blieben der im Mai 2025 angesetzten Verhandlung fern – und kamen daher zunächst per Haftbefehl in U-Haft. Im Reichsbürger-Folgeprozess vor dem Landgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) wurden drei Männer und zwei Frauen aus Boxberg (Main-Tauber-Kreis) im Alter von 25 bis 52 Jahren Mitte August 2025 verurteilt. >>>
Erst nach der konkreten Anzeige des Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters gegen die HIER angezeigte und o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz vom 17.05.2025…:
… Strafanzeigen vom 17.05.2025 gegen die Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz, we-gen Unregelmäßigkeiten in Reichsbürger- und AFD-Umsturz-Verfahren, wegen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung und Prozessbetrug durch amtsseitige Verantwortung problematischer Verfah-rungsführungen seit 2022 in Reichsbürger- und AFD-Prozessen mit nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen nach 1945 an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg >>>
… hat das Landgericht Mosbach unter der Führung und Verantwortung der HIER angezeigten und o.g. beschuldigten Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz mittels Haftbefehl und U-Haft sichergestellt, dass die Angeklagten im Reichsbürgerprozess beim Lansgericht Mosbach im August 2025 erscheinen.
>>> >>> Die HIER angezeigte und o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert ihrerseits amtsseitig wie HIER dargelegt und belegt im o.g. Verfahrenskomplex seit 2022 ABER AUCH IM REICHSBÜRGERPROZESS BEIM LANDGERICHT MOSBACH im August 2025 u.a. auch die bis in 2025 öffentlich, gesellschaftlich, wissenschaftlich, juristisch und politisch thematisierten deutschen NS-Verbrechen, auch im Kontext von Umsturzversuchen, EXPLIZIT EINDEUTIG zu benennen und ihrerseits selbst zu thematisieren.
>>> >>> Die HIER angezeigte und o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert ihrerseits amtsseitig wie HIER HALTBAR dargelegt und belegt im o.g. Verfahrenskomplex seit 2022 ABER AUCH IM REICHSBÜRGERPROZESS BEIM LANDGERICHT MOSBACH im August 2025 die Verweigerungen beim Amtsgericht Mosbach bzgl. KONKRET BEANTRAGER juristischer Aufarbeitungen von KONKRETEN TATBETEILIGUNGEN an NS-Verbrechen und NS-Unrecht im eigenen gerichtlichen Zuständigkeitsbereich Neckar-Odenwaldkreis zu thematisieren, wie auch deren bereits seit 1945 bestehenden mangelhaften juristischen Aufarbeitungen durch die Mosbacher Nachkriegsjustiz selbst.
>>> >>> Es ist HIER zu überprüfen, inwieweit die HIER angezeigte und o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz sich ihrerseits durch mögliche amtsseitige Unterdrückungen von HIER genannten Beweismaterialien in Kontexten von Strafvereitelung im Amt, Prozessbetrug etc. im o.g. Verfahrenskomplex seit 2022 ABER AUCH IM REICHSBÜRGERPROZESS BEIM LANDGERICHT MOSBACH im August 2025 ggf. u.U. engagieren könnte.
>>> >>> Die HIER o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert mehrfach wiederholt in ihren schriftlichen Ankündigungen ausgehend von o.g. Verfahrenskomplex HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR die Dienstaufsichtsbeschwerden gegen die o.g. Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess bzgl. o.g. Kontext von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933 (Hitler-Putsch-Prozess) und seit 1945 unter Beteiligung von Reichsbürgern und AFD-Mitgliedern ihrerseits amtsseitig zu benennen, zu erläutern und zu bearbeiten. UND DIES AUCH in amtsseitiger Verweigerung ihrer Landgerichtspräsidentinnen-Funktion bei der Ausübung einer ordnungsgemäßen transparenten Dienstaufsicht in der Mosbacher Justiz, bei der selbst seit 2022 Reichsbürgerprozesse stattfinden.
>>> >>> UND DIES INSBESONDERE auch bzgl. der HIER dargelegten und belegten Bearbeitungs-Beschwerden gegen die Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess bzgl. der o.g. beantragten Verfahren zu Geschichtsklitterung, Geschichtsrevisionismus; zu volksverhetzender Leugnung und Verharmlosung von NS-Verbrechen; zu öffentlichen Forderungen einer deutschen erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad bei der konkreten NS-Vergangenheitsbewältigung, bei der NS-Öffentlichkeits- und Gedenkstättenarbeit, bei der NS-Bildungsarbeit u.a. auch unter KONKRETER Beteiligung von AFD-Mitgliedern, und deren im o.g. Verfahrenskomplex beantragten juristischen Aufarbeitungen ausgehend vom Amtsgericht Mosbach. UND DIES AUCH in amtsseitiger Verweigerung ihrer Landgerichtspräsidentinnen-Funktion bei der Ausübung einer ordnungsgemäßen transparenten Dienstaufsicht in der Mosbacher Justiz.
>>> >>> Die HIER o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert ihrerseits mehrfach wiederholt seit 2022 ausgehend von o.g. Verfahrenskomplex ABER AUCH IM REICHSBÜRGERPROZESS BEIM LANDGERICHT MOSBACH im August 2025 HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR die folgenden KONKRETEN HISTORISCHEN Sachverhalte amtsseitig zu berücksichtigen und amtsseitig zu thematisieren, dass die mit Dienstaufsicht beschwerte o.g. Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess bzgl. o.g. Kontext von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933 (Hitler-Putsch-Prozess) und seit 1945 unter Beteiligung von Reichsbürgern und AFD-Mitgliedern NACH BISHERIGEM KENNTNISSTAND sich ihrerseits IM KONKRETEN GEGENSATZ zu anderen (Amts-)Richter*innen AUCH NICHT dem Offenen Brief vom 27.01.2025 von 619 Jurist*innen „Ein Verbotsverfahren gegen die AfD hat Aussicht auf Erfolg“ an Abgeordnete des Deutschen Bundestages sowie an Mitglieder der Bundesregierung angeschlossen hat.
>>> >>> Die HIER o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert ihrerseits mehrfach wiederholt seit 2022 ausgehend von o.g. Verfahrenskomplex ABER AUCH IM REICHSBÜRGERPROZESS BEIM LANDGERICHT MOSBACH im August 2025 HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR die folgenden KONKRETEN HISTORISCHEN Sachverhalte amtsseitig zu berücksichtigen und amtsseitig zu thematisieren…. durch ihre amtsseitige Verantwortung problematischer Verfahrungsführungen seit 2022 in bei der Mosbacher Justiz beantragten Verfahren zu nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933 und seit 1945. Die HIER o.g. angezeigte und beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz verweigert ihrerseits mehrfach wiederholt seit 2022 ausgehend von o.g. Verfahrenskomplex ABER AUCH IM REICHSBÜRGERPROZESS BEIM LANDGERICHT MOSBACH im August 2025 HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR die folgenden KONKRETEN HISTORISCHEN Sachverhalte amtsseitig zu berücksichtigen und amtsseitig zu thematisieren… UND ZWAR, dass der Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter bereits am 03.06. und 05.06.2022 beim Amtsgericht Mosbach die Wiederaufnahme des Hitler-Putsch-Prozesses aus 1924 unter 6F 9/22 beantragt hat. UND ZWAR gemäß und analog der Wiederaufnahmeverfahren zum Reichstagsbrandurteil des Reichsgerichts Leipzig aus 1933 (bzgl. nationalsozialistische Machtergreifung) und dessen Aufhebung durch die Generalbundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe aus 2007 über eine 75-jährige Zeitachse bis ins 21. Jahrhundert.
>>> >>> Die HIER o.g. beschuldigte Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz engagiert sich wie HIER AKTENKUNDIG NACHWEISBAR UND HALTBAR dargelegt und belegt ihrerseits mehrfach wiederholt seit 2022 ausgehend von o.g. Verfahrenskomplex beim Amtsgericht Mosbach (ihrem Dienstaufsichtszuständigkeitsbereich) und beim Landgericht Mosbach selbst in der Begünstigung von Landesverrats- und Hochverrat-Bestrebungen u.a. durch Unterschlagung und Unterdrückung von Beweismaterialien sowie durch explizite Nicht-Benennung beantragter Verfahrenssachverhalte der seit 2022 beantragten juristischen Aufarbeitungen: HIER von (a =>) … von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933 (Hochverrats-Kontext), (b =>) … von Reichsbürger- und AFD-Prozessen mit nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen nach 1945 (Hochverrats-Kontext), (=> c) … zu Leugnung und Relativierung von deutschen Kolonialverbrechen, (=> d) …zu Leugnung und Relativierung von NS-Verbrechen, (=> e) … von sicherheitsgefährdenden Angriffen gegen die BRD aus-gehend von der Neuen Rechten, wie u.a. aus der AFD. UND DIES während der amtsseitigen Verantwortung der HIER Beschuldigten und Angezeigten im Kontext diesbzgl. problematischer Verfahrungsführungen bei der Mosbacher Justiz.
Im HIER relevanten Zeitraum reichte die AFD von 2020 bis November 2025 laut sowie bei Kenntnis der HIER Beschuldigten Angezeigten Mosbacher Landgerichtspräsidentin über 7000 sicherheitsrelevante Anfragen in Landesparlamenten ein. Das ist das Ergebnis einer Analyse von mehr als 100.000 Drucksachen, die zentral vom Landtag in Düsseldorf auf der Webseite parlamentsspiegel.de katalogisiert werden. Die AfD stellte in absoluten Zahlen die meisten Anfragen mit Schlagworten aus den Bereichen Energie, Militär, Rüstung, Drohnenabwehr und/oder Katastrophenschutz. In 503 Fällen ging es um medizinische Versorgung, in 379 um öffentliche Sicherheit und in 321 um Energieversorgung. U.a. wegen ihrer teils detaillierten Fragen, etwa zu Routen von Militärtransporten in die Ukraine, steht die AfD jedoch damit in der Kritik der gezielten Informationsbeschaffung im Interesse Russlands im Kontext von Landesverrat gegen die äußere Sicherheit der BRD sowie im Kontext von Hochverrat bei Beteiligung von AFD-Mitgliedern an NS-rechtsextremistisch orientierten Umsturzplänen gegen die innere Sicherheit der BRD. Laut Analyse stellte der AfD-Abgeordnete Ringo Mühlmann seit 2020 mehr als 200 Anfragen zu sicherheitsrelevanten Themen.
Die HIER vorliegende Strafanzeige richtet sich gegen die Begünstigung von Landesverrats-Bestrebungen, Staatsgeheimnisse einer fremden Macht oder ihren Mittelsmännern mitzuteilen und/oder öffentlich bekannt zu machen, um die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen und/oder eine fremde Macht zu begünstigen, und um dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeizuführen. HIER INSBESONDERE im AFD-Verhältnis zu und im AFD-Agieren mit und gegenüber Russland.
Die HIER vorliegende Strafanzeige richtet sich gegen die Begünstigung von Hochverrats-Bestrebungen, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland auch unter Einsatz von Gewalt zu beeinträchtigen und/oder die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland be-ruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern. HIER INSBESONDERE im AFD-Verhältnis zu und im AFD-Agieren im Kontext der Leugnung, Relativierung und Verharmlosung von NS-Verbrechen EINERSEITS sowie im Kontext von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen nach 1945 aus der Neuen Rechten, wie aus Reichsbürger- und AFD-Szene ANDERERSEITS.
SIEHE AUCH: Die Material- und Zitatsammlung, Beweissammlung u.a. aus historischen, politischen, zivilgesellschaftlichen, juristischen, wissenschaftlichen Quellen und Medienberichten...benannt von der mehrfach mit Dienstaufsicht beschwerten Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess selbst unter 6F 202/21 und 6F 9/22 am 17.08.2022 unter…http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/
SIEHE AUCH: HISTORISCHES & AKTUELLES: GERICHTLICHE VERFAHREN: AUSWEISUNG VON ADOLF HITLER AUS DEUTSCHLAND bzw. AUSSCHLUSS VOM ZUGANG ZU ALLEN ÖFFENTLICHEN ÄMTERN IN DEUTSCHLAND - u.a. in juristischen Aufarbeitungen ausgehend vom Amtsgericht Mosbach >>>
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Hitler-Ausweisung/
SIEHE AUCH: HISTORISCHES & AKTUELLES: GERICHTLICHE VERFAHREN: Wiederaufnahmeverfahren Hitler-Putsch-Hochverrats-Prozess aus 1924: ausgehend vom Amtsgericht Mosbach und Verfahren zu Aktuellen nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturz- und Putschplänen u.a. seit 2022 >>>
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/AKTUELLES/Gerichtliche-Verfahren/Wiederaufnahmeverfahren-Hitler-Putsch-Prozess-sowie-Rechtsextremistische-Putsch-und-Umsturzversuche/
SIEHE AUCH IM FOLGENDEN…
DIENSTAUFSICHTSBESCHWERDEN gegen die
die Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess
wegen intransparenter nicht-nachvollziehbarer Bearbeitungsverweigerungen
von KONKRETEN Eingaben zu NS-Verbrechen und NS-Unrecht,
HIER INSBESONDERE durch amtsseitige Missachtung
beantragter juristischer Aufarbeitungen
>> bzgl. (a…) wegen volksverhetzender Leugnung, Verharmlosung und Verherrlichung von deutschen Kriegsverbrechen und Völkermorden
sowohl bzgl. der deutschen Kolonialverbrechen und
der Verbrechen des Nazi-Terror-Verfolgungs- und Vernichtungsregimes
- u.a. aus der Neuen Rechten, wie in und aus der AFD,
>> bzgl. (b…) wegen volksverhetzendem Leugnen, Relativieren und Verharmlosen
nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierter Umsturzpläne
bis 1933 und seit 1945,
>> bzgl. (c…) wegen amtsseitiger Missachtung von
Diskriminierung und Rassismus sowie von
nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten,
demokratie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und
rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD
INSBESONDERE vor, im und nach dem Bundestagswahlkampf 2025
an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler,
Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)
der CDU Baden-Württemberg
ANTRÄGE auf KONKRETE gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und
Zuständigkeitsverweisungen beim Amtsgericht Mosbach bzgl.
nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und
verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen
in und aus der AFD
INSBESONDERE vor, im und nach dem Bundestagswahlkampf 2025
sowie ANTRAG auf Pressemitteilungen zu juristischen Aufarbeitungen von
deutschen Kolonialverbrechen in Afrika als auch von Kontinuitäten in der
staatlichen, personellen und strukturellen
nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung bis 1945
als auch zu personellen und thematischen NS-Kontinuitäten nach 1945,
HIER insbesondere KONKRET in Mosbach und im heutigen Neckar-Odenwaldkreis,
an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler,
Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)
der CDU Baden-Württemberg
Die o.g. fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert im o.g. Verfahrenskomplex HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR die amtsrichterlichen ordnungsgemäßen jeweiligen KONKRETEN Eingangsbestätigungen, Sachverhaltsbenennungen und Sachverhaltserläuterungen SOWOHL von eingereichten Strafanzeigen ENTGEGEN § StPO 158 ALS AUCH von Anträgen auf Wiederaufnahme-, Aufhebungs- und Entschädigungsverfahren, auf gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen SOWOHL bzgl. der beantragten juristischen Aufarbeitung ausgehend vom Amtsgericht Mosbach zu deutschen Kolonialverbrechen in Afrika als auch von Kontinuitäten in der staatlichen und strukturellen nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung ALS AUCH bzgl. der beantragten juristischen Aufarbeitung ausgehend vom Amtsgericht Mosbach zu nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD. HIER u.a. AUCH INSBESONDERE zu nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten Umsturzversuchen vor 1933 und nach 1945 in Deutschland, u.a. unter der Beteiligung von AFD-Mitgliedern (s.o.), im o.g. Verfahrenskomplex HINREICHEND dargelegt und belegt.
Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) missachtet die Strafprozessordnung unter § 158 bei der diesbzgl. KONKRET gesetzlich geregelten Entgegennahme und Weiterbearbeitung HIER ABER EXPLIZIT in deren Anwendung … (a) mit der amtsseitigen NICHT-Benennung der einzeleingabenbezogenen konkreten Kolonial-NS-Sachverhalte, … (b) mit der NICHT-Ausstellung der jeweiligen konkreten Kolonial-NS-Eingangsbestätigungen, … und (c) mit der NICHT-Mitteilung von jeweiligen konkreten Kolo-nial-NS-Weiterbearbeitungen bzw. von NICHT-Mitteilungen offizieller Kolonial-NS-Zuständigkeitsweiterverweisungen in den o.g. jeweiligen einzelnen KONKRETEN Kolonial-NS-Eingaben-Sachen. Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess verweigert HIER EXPLIZIT amtsseitig Kolonial-NS-Eingangs- und –Weiterbearbeitungsbestätigungen, Kolonial-NS-Sachverhaltsbenennungen und -Zuständigkeitsverweisungen … (a) bei beantragten Kolonial-NS-Wiederaufnahme- und Aufhebungsverfahren, … (b) bei beantragten Kolonial-NS-Wiedergutmachungs- und Entschädigungsverfahren, … (c) bei beantragten gerichtlichen Prüfungen einzeleingabenbezogener KONKRETER Kolonial-NS-Sachverhalte.
ZU DEN beim Amtsgericht Mosbach unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) bisher diesbzgl. initiierten Verfahren im o.g. Verfahrenskomplex seit 2022…
SIEHE AUCH: Die Material- und Zitatsammlung, Beweissammlung u.a. aus historischen, politischen, zivilgesellschaftlichen, juristischen, wissenschaftlichen Quellen und Medienberichten... benannt von der bereits mehrfach mit Dienstaufsicht beschwerten Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess selbst unter 6F 202/21 und 6F 9/22 am 17.08.2022 unter…
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/
>>> SIEHE AUCH: FACEBOOK-GRUPPE: Aufarbeitung von Nazi-Unrecht und Nazi-Verbrechen >>> https://www.facebook.com/groups/954312666630761
Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert HIERBEI, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR HINREICHEND dargelegt und belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex sowohl diesbzgl. o.g. Hinweisen aus der Zivilgesellschaft nachzugehen als auch diesbzgl. o.g. eigene Ermittlungen nach dem Amtsermitlungsgrundsatz. UND DIES HIER SOWOHL bzgl. der beantragten juristischen Aufarbeitung ausgehend vom Amtsgericht Mosbach zu Deutschen Kolonialverbrechen in Afrika und zu nationalsozialistischen Verbrechenskontexten bis 1945, zu rassistischen Diskriminierungen seit 1945 (s.o.). Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert HIERBEI, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR dargelegt und belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex die u.a. dargelegten und belegten diesbzgl. KONKRETEN historischen Sachverhalte zu benennen. UND DIES HIER INSBESONDERE ENT-GEGEN den Aussagen von BRD-Verfassungsorganen wie Bundestag, Bundesregierung, Bundespräsidenten, etc. HIER INSBESONDERE bzgl. Relativierung und Verharmlosung von DEUTSCHEN Kriegsverbrechen und Völkermorden.
Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert HIERBEI, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR HINREICHEND dargelegt und belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex EXPLIZIT KONKRETE Sachverhalte und Tatsachengrundlagen bei einer sachgerechten Expertisen-Beweismittel-Erhebung zu Deutschen Kolonialverbrechen in Afrika und zu nationalsozialistischen Verbrechenskontexten bis 1945, zu rassistischen Diskriminierungen seit 1945, zu rechtsextremistischen Bestrebungen der Neuen Rechten in der BRD, wie u.a. in und aus der AFD, und zu deren juristischen Aufarbeitungen gerichtlich verfügt erheben zu lassen mit einer ordnungsgemäßen und sachgerechten gerichtlichen Sachverständigen-Begutachtung durch Experten*innen aus rechts-, geschichts-, politikwissenschaftlicher NS-Forschung und aus psychologischer bzw. -soziologischer NS-Opferforschung als auch NS-Täter-Forschung sowie aus der Kolonialismus-Forschung als auch aus der Rechtsextremismus- und Rassismus-Forschung seit 1945. Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) verweigert HIERBEI, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR HINREICHEND dargelegt und belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex EXPLIZIT KONKRETE diesbzgl. gerichtliche Verfügungen zu erlassen.
STATTDESSEN hat die fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) unter Missbrauch ihres Amtes versucht, wie HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR dargelegt und belegt, gezielt im o.g. Verfahrenskomplex am 17.08.2022, dem Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter in seinen o.g. privaten Sorge- und Umgangsrechtsverfahren gutachterlich belegt WAHRHEITSWIDRIG zu unterstellen, er sei ANGEBLICH psychisch krank und erziehungsunfähig (Vgl. diesbzgl. Gutachten vom 23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 202/21). UND DIES HIER u.a. begründet in ihrer diesbzgl. gerichtlichen Verfügung einer psychiatrischen Begutachtung vom 17.08.2022 auf seinen o.g. beim Amtsgericht Mosbach eingereichten Beantragungen zu juristischen Aufarbeitungen von KONKRETEN NS-Verbrechen, insbesondere im Neckar-Odenwaldkreis, und deren mangelhaften juristischen Aufarbeitung seit 1945 durch die Mosbacher Justiz selbst. UND DIES HIER u.a. begründet in ihrer diesbzgl. gerichtlichen Verfügung einer psychiatrischen Begutachtung vom 17.08.2022 seiner beim Amtsgericht Mosbach beantragten juristischen Aufarbeitungen bzgl. nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten Umsturzversuchen vor 1933 und nach 1945 in Deutschland. UND DIES HIER ABER während das gerichtlich beauftrage Gutachten vom 23.08.2023 unter 6F 9/22 und 6F 202/21 DANN die KONKRETEN „ANZEIGEN GEGEN ADOLF HITLER“ des begutachteten Beschwerdeführers und Anzeigeerstatters EXPLIZIT benennt. UND diese als NICHT psychisch krank bewertet. Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) hat seit dem 23.08.2023 bis zum heutigen Tage (30.11.2025) verweigert, eine diesbzgl. ordnungsgemäße amtsseitige Entschuldigung gegenüber dem HIER geschädigten Beschwerdeführer und Anzeigeerstatter EXPLIZIT offiziell auszusprechen.
Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) hat NACH BISHERIGEM KENNTNISSTAND sich ihrerseits IM KONKRETEN GEGENSATZ zu anderen (Amts-)Richter*innen AUCH NICHT dem Offenen Brief vom 27.01.2025 von 619 Jurist*innen „Ein Verbotsverfahren gegen die AfD hat Aussicht auf Erfolg“ an Abgeordnete des Deutschen Bundestages sowie an Mitglieder der Bundesregierung angeschlossen bzgl. o.g. Kontext von beim Amtsgericht Mosbach beantragten juristischen Aufarbeitungen nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933 (Hitler-Putsch-Prozess) und seit 1945 unter Beteiligung von Reichsbürgern und AFD-Mitgliedern.
Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) missachtet HIER auch im o.g. Verfahrenskomplex die darin beantragten juristischen Aufarbeitungen. UND ZWAR indem die Mosbacher Amtsrichterin Hess, diese NS-Sachverhalte und NS-Verbrechenskontexte HALTBAR NACHWEISBAR im o.g. Verfahrenskomplex wie HIER dar-gelegt und belegt EXPLZIT NICHT benennt und NICHT HINREICHEND thematisiert. UND ZWAR entgegen den diesbzgl. beim Amtsgericht Mosbach im o.g. Verfahrenskomplex initiierten und beantragen juristischen Aufarbeitungen (s.o.). Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess verweigert HIER EXPLIZIT amtsseitig NS-Eingangs- und –Weiterbearbeitungsbestätigungen, Kolonial-NS-Sachverhaltsbenennungen und Zuständigkeitsverweisungen … (a) bei beantragten NS-Wiederaufnahme- und Aufhebungsverfahren, … (b) bei beantragten Kolonial-NS-Wiedergutmachungs- und Entschädigungsverfahren, … (c) bei beantragten gerichtlichen Prüfungen einzeleingabenbezogener KONKRETER NS-Sachverhalte. ZU diesen HIER o.g. vom Beschwerdeführer beantragten juristischen Aufarbeitungen bzgl. nationalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierter Umsturzversuche vor 1933 und nach 1945 in Deutschland zählen u.a. auch … :
… Antrag auf Wiederaufnahmeverfahren (Hitler-Putsch-Prozess) beim Amtsgericht Mosbach vom 03.06.2022 unter 6F 9/22 bezüglich der symbolpolitischen posthumen juristischen AUSWEISUNG VON ADOLF HITLER AUS DEUTSCHLAND bzw. dem AUSSCHLUSS VON ADOLF HITLER VOM ZUGANG ZU ALLEN ÖFFENTLICHEN ÄMTER IN DEUTSCHLAND auf Grund nationalsozialistisch-rechtsextremistischer Umsturzversuche in 1924 >>>
… Antrag an das Amtsgericht Mosbach vom 05.06.2022 auf STRAFANZEIGE GEGEN >>
A D O L F H I T L E R << WEGEN HOCHVERRATS GEGEN DEUTSCHLAND in 1924 im WIEDER-AUFNAHMEVERFAHREN (Hitler-Putsch-Prozess) am AG MOS auf Grund nationalsozialistisch-rechts-extremistischer Umsturzversuche in 1924 >>>
… Anträge an das Amtsgericht Mosbach vom 24.03.2023 auf STRAFANZEIGEN wegen direkter Tatbeteiligungen an bzw. Beihilfe zum "Hochverrat" in 2022 und 2023 mit der Planung und Vorbereitung gewaltsamer Umsturzversuche, u.a. aus rechtsextremistischer Motivation >>>
… Anträge an das Amtsgericht Mosbach vom 13.04.2023 auf STRAFANZEIGEN wegen Hochverrats § 81–83a StGB auf Grund von rechtsextremistisch motivierten Putschversuchen, u.a. in 2022 und 2023 als Ergänzung zum Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Mosbach in Boxberg, als Ergänzung zur Anklage des versuchten Mordes vor dem OLG Stuttgart (u.a. Reichsbürgergruppe auch unter Beteiligung der AFD-Richterin und AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann) >>>
… Anträge an das Amtsgericht Mosbach vom 28.05.2023 auf STRAFANZEIGEN wegen Hochverrats § 81–83a StGB auf Grund von rechtsextremistisch motivierten Umsturzversuchen, u.a. in 2022 und 2023, als Ergänzung zum Terrorprozess gegen die Reichsbürgergruppe militanter Rechter "Vereinte Patrioten" vor dem OLG Koblenz >>>
… Beantragung von WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN vom 17.11.2024 beim Amtsgericht Mosbach wegen rechtsextremistischen Umsturzversuchen unter Beteiligung von AFD-Mitgliedern ... auf Grund Amtsseitiger Expertisen-Beweismittelunterdrückung durch die Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter 6F 9/22 und 6F 202/21 bei der gerichtlichen Beauftragung von Sachverständigen-Gutachten bzgl. möglichem Verschweigen, Verleugnen und Verharmlosen nationalsozialistisch-rechtsextremistischer Umsturzversuche in Deutschland vor 1933 und nach 1945 und deren juristischen Aufarbeitungen. >> AUS AKTUELLEM ANLASS der Festnahmen von Mitgliedern der militanten rechtsterroristischen Gruppierung "Sächsische Separatisten", darunter AfD-Mitglieder, im November 2024 wegen deren Umsturzplänen für ein vom Nationalsozialismus ausgerichtetes Staats- und Gesellschaftswesen >>>
… Strafanzeigen vom 17.05.2025 gegen die Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz, wegen Unregelmäßigkeiten in Reichsbürger- und AFD-Umsturz-Verfahren, wegen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung und Prozessbetrug durch amtsseitige Verantwortung problematischer Verfahrungsführungen seit 2022 in Reichsbürger- und AFD-Prozessen mit nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen nach 1945 an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg >>>
… Strafanzeigen vom 19.10.2025 gegen die Präsidentin des Landgerichts Mosbach Jutta Kretz we-gen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung und Prozessbetrug, Unterschlagung und Unterdrückung von Beweismaterialien aus Verfahren beim Amtsgericht und in Verfahren beim Landgericht Mosbach seit 2022 zu (a =>) … juristischen Aufarbeitungen von nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen bis 1933 (b =>) … juristischen Aufarbeitungen von Reichsbürger- und AFD-Prozessen mit nationalsozialistisch-rechtsextremistisch-orientierten Umsturzplänen nach 1945 während ihrer amtsseitigen Verantwortung diesbzgl. problematischer Verfahrungsführungen bei der Mosbacher Justiz an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesar-beitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg >>>
Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess unter der Verantwortung und Führung des Direktors des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler (CDU) hat im o.g. Verfahrenskomplex AKTENKUNDIG HALTBAR NACHWEISBAR seit 2022 verweigert, gerichtliche Verfügungen zu erlassen…
… bzgl. Aktenvernichtungsstopp der Verfahrensakten der Mosbacher Nazi-Justiz 1933 bis 1945,
… bzgl. Aktenvernichtungsstopp der Personalakten der Mosbacher Nazi-Justiz 1933 bis 1945,
… bzgl. Aktenvernichtungsstopp der Personalakten der Mosbacher Nachkriegsjustiz nach 1945 zur Überprüfung von möglichen personellen Kontinuitäten von Mosbacher Nazi-Juristen vor 1945 dann bei der Mosbacher Justiz seit 1945 im Neckar-Odenwaldkreis,
… bzgl. Aktenvernichtungsstopp der Verfahrensakten der Mosbacher Justiz seit 1945 bzgl. NS-Verfahren,
… bzgl. der Zuständigkeiten, Verantwortungen und Beteiligungen von Mosbacher Juristen vor 1945 und seit 1945 bei der juristischen Aufarbeitung von Nazi-Verbrechen im Neckar-Odenwaldkreis.
Der CDU-nahe Jurist und Amtsgerichtsdirektor, Dr. Lars Niesler wird HIER gebeten, zu überprüfen und mitzuteilen (ggf. auch per Pressemitteilung), ob es sich angesichts der HIER o.g. HALTBAR dargelegten und belegten Vorgänge beim Amtsgericht Mosbach sowohl bzgl. Rassismus-Kolonial-NS-Verbrechen als auch bzgl. nationalsozialistisch-orientiert rechtsextremistischen Bestrebungen aus der Neuen Rechten, wie in und aus der AFD … ggf. u.U. um einen amtsseitig beabsichtigen Erinnerungspolitischen Klimawandel, eine Erinnerungspolitische Wende um 180 Grad evtl. handeln könnte ? … ggf. u.U. um eine amtsseitig beabsichtige Erschwerungs- und Verhinderungskultur einer diesbzgl. juristischen Aufarbeitung beim Amtsgericht Mosbach und bei der Mosbacher Justiz evtl. handeln könnte ? … ggf. u.U. um eine amtsintern thematisierte Verharmlosung und Normalisierung der Bestrebungen aus der Neuen Rechten, u.a. in und aus der AFD, evtl. handeln könnte ? … ggf. u.U. um eine amtsintern thematisierte amtsseitig gezielte Benachteiligungen von Rassismus-Kolonial-NS-Opfern als auch von Opfern rechtsextremistischer Anschläge und Angriffe evtl. handeln könnte ? … ggf. u.U. um amtsinterne "Verleitung von Untergebenen zu einer Straftat, etc." evtl. handeln könnte ?
Der CDU-nahe Jurist und Amtsgerichtsdirektor, Dr. Lars Niesler wird HIER gebeten, zu überprüfen und öffentlich mitzuteilen (ggf. auch per Pressemitteilung), ob, wann und wie angesichts aktueller gesellschaftlicher Rechtsruck-Entwicklungen und der o.g. dargelegten und belegten Ereignisse und Vorgänge beim Amtsgericht Mosbach, Neckar-Odenwaldkreis, TRANSPARENT UND NACHVOLLZIEHBAR überprüft wird, dass angehende und amtierende Juristen und Gerichtsmitarbeiter*innen beim Amtsgericht Mosbach verfassungstreu sind? UND DIES mit Verweisen auf Veröffentlichungen des Bundesverfassungsschutzes und des Landesverfassungsschutzamtes Baden-Württemberg (LfV BW), wonach es eine Zunahme von in rechtsextremistischen und anderen extremistischen Bereichen aktiven Personen u.a. auch in Institutionen gibt. Wird beim Amtsgericht Mosbach unter Führung und Verantwortung des CDU-Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler, eine Erklärung zur Verfassungstreue bei der Bewerbung für Stellenangebote beim Amtsgericht Mosbach ausdrücklich verlangt und auch bei laufenden Dienst- bzw. Anstellungsverhältnissen regelmäßig überprüft, um den Rechtsstaat resilient zu machen gegen Angriffe von außen, aber auch von innen ? Wie wird unter Führung und Verantwortung des CDU-Juristen und Amtsgerichtsdirektors Dr. Lars Niesler beim Amtsgericht Mosbach der Mitarbeiter*innen-Demokratiebildung ein größerer Raum gegeben als bisher gegeben ? Und wie wird dabei am Amtsgericht Mosbach auch die Rolle und Bedeutung von Richtern im Nationalsozialismus und Nazi-Juristen sowie deren personelle Kontinuitäten nach 1945 in amtsinterner Fort- und Weiterbildung verstärkt thematisiert ? Wie wird beim Amtsgericht Mosbach Haltung und Einstellung von Mitarbeiter*innen des Amtsgerichts Mosbach zum NS-Terror- und Vernichtungsregime, insbesondere unter Verantwortung und Wirken der NS-Justiz vor und nach 1945 überprüft ??? Insbesondere vor dem zunehmenden Rechtspopulismus und Rechtsextremismus ist HIER zu überprüfen, in-wieweit HIER die Verweigerung einer eigenen berufsethischen Rückbesinnung und Verortung bzgl. der Nazi-Justiz-Verbrechen 1933-1945 und der personellen Kontinuität von Nazi-Juristen in Mosbach, im Neckar-Odenwaldkreis und in Baden-Württemberg, seit 1945 thematisiert wird beim Amtsgericht Mosbach unter der KONKRETEN Verantwortung von Direktor Dr. Lars Niesler (CDU).
BEISPIEL STUTTGART: 28. August 1951: Wie viele Nazi-Täter nach dem Krieg Karriere gemacht haben, zeigt dieses Beispiel aus Stuttgart: Am 28.08.1951 wird der ehemalige, im Jahr 1950 rehabilitierte SS-Hauptscharführer Viktor Hallmayer bei der Verfassungsschutz-Dienststelle D8 in Stuttgart mit “Sonderaufträgen” betraut, die nicht detailliert definiert werden. Sein Aufgabenfeld umfasst die Überwachung von politischen Veranstaltungen sowie den Personenschutz “führender Persönlichkeiten”. Während des Krieges hatte er in Paris beim Gestapo-Kommando Gutgesell Résistance-Mitglieder aufgespürt. Dieses “Fachkenntnisse” für die Jagd auf Kommunisten war wohl Hauptkriterium für seine Beauftragung, obwohl er zu diesem Zeitpunkt auf amerikanischen Kriegsverbrecher-Listen geführt und in Frankreich wegen Mord und Folter gesucht wurde. Seine Arbeit wurde von Vorgesetzten – seine Biographie ignorierend – anscheinend geschätzt, weshalb er bereits 1952 zum Kriminalpolizeimeister und 1954 zum Beamten auf Lebenszeit ernannt wurde. 1955 folgt dann die Beförderung zum Kriminalobersekretär. Während der französische Staat weiterhin in Sachen “Totschlag, vorsätzlicher Körperverletzung (Schläge und Verwundungen), Requirierung, Wegnahme von Sachen” ermittelt, ist die Polizei Baden-Württemberg der Auffassung, er habe in Paris nur “hoheitliche Abwehraufgaben” übernommen. Aufgrund der anhaltenden Anschuldigungen gegen Hallmeyer wird dieser 1958 für ein Jahr in den Wirtschaftskontrolldienst versetzt, nur um danach wieder in den Dienst des Verfassungsschutzes zurückzukehren. Offensichtlich ein Schritt, um den liebgewordenen Mitarbeiter zu schützen. 1968 wird er Kriminalobermeister und geht 1970 in den Ruhestand. Er erhält eine Dankesurkunde des damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten und Ex-Nazi-Militärrichters Hans Filbinger (CDU). Bis zu seinem Tod wenige Jahre später bekommt er eine Pension, die alle Dienstansprüche bis ins Jahr 1932 zurückreichend voll vergütet.
INWIEWEIT hat das Amtsgericht Mosbach unter der KONKRETEN Führung und Verantwortung von Direktor Dr. Lars Niesler, ebenfalls CDU-nah wie Hans Filbinger, bisher bis 2025 amtsseitig überprüfen lassen, wie viele und welche Personalkontinuitäten von NS-Funktionseliten nach 1945 im eigenen zuständigen Gerichtsbezirk Neckar-Odenwaldkreis vorgelegen haben ? Und welche Pensionsansprüche und Kriegsopferrentenzahlungen in welchen Summen seit 1945 im Neckar-Odenwaldkreis vorgenommen wurden für Personen, die dem NS-Täterschema zuzuordnen sind ?
Wann und wie hat das Amtsgericht Mosbach unter der KONKRETEN Führung und Verantwortung von Direktor Dr. Lars Niesler, ebenfalls Jurist und CDU-nah wie Hans Filbinger, bereits in Zusammenarbeit mit dem Landgericht Mosbach und der Staatsanwaltschaft Mosbach, als die zentralen Institutionen der Mosbacher Justiz im Neckar-Odenwaldkreis, beschlossen und organisiert, die eigenen Aktenbestände sowie eigene (Personal-)Ressourcen für Forschungsprojekte zur NS-Justiz im Neckar-Odenwaldkreis zur Verfügung zu stellen? UND DIES zur Auseinandersetzung mit der Rolle der Justiz in der NS-Zeit, ihren handelnden Personen und den Folgen ihrer Entscheidungen, mit der Gesetzgebung und Rechtsprechung während der NS-Herrschaft, mit der aktiven Beteiligung der Justiz am NS-System, mit der fehlenden Aufarbeitung von Justizunrecht nach dem Zweiten Weltkrieg ? UND DIES zur Benennung, Anerkennung von…; zum Erinnern, Gedenken und Ehren von Opfern der NS-Justiz ? UND DIES u.a. nach dem Vorbild des Forschungsprojekts am Landgericht Bayreuth aus 2025, u.a. als Beitrag zur Schärfung des historischen Bewusstseins.
WIE ZUVOR AUSGEFÜHRT: Es wird HIER, u.a. auch gemäß § 158 StPO, um die persönliche und ordnungsgemäße jeweilige KONKRETE Eingangsbestätigung, Sachverhaltsbenennung und Sachverhaltserläuterung sowie um die persönliche ordnungsgemäße und sachgerechte Bearbeitung und Zuständigkeitsverweisung der HIER o.g. Strafanzeigen, der HIER o.g. Dienstaufsichtsbeschwerden und der o.g. Anträge auf ordnungsgemäße gerichtliche Prüfungen und auf Pressemitteilungen beim Amtsgericht Mosbach gebeten bzgl. juristischer Aufarbeitung von o.g. NS-Verbrechen und NS-Unrecht sowie bzgl. transparenten und nachvollziehbaren Bearbeitungen und Zuständigkeitsverweisungen bei national-sozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und verfassungsfeindlichen, behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD, seitens des Direktors beim Amtsgericht Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg.
Mit freundlichen Grüßen, Bernd Michael Uhl
2.6 Online-Artikel zum angestrebten NSDAP-Verbotsverfahren in 1930
Der Mann, der Hitlers Aufstieg verhindern wollte: Was wir von Robert Kempner über das AfD-Verbot lernen können
Der Staatsanwalt Robert Kempner versuchte einst, die NSDAP zu verbieten – und scheiterte am Zögern von Justiz und Politik. Sein Fall zeigt, was heute gegen die Feinde der Demokratie helfen könnte...
Von Andreas Austilat
15.07.2025, 20:39 Uhr
https://www.tagesspiegel.de/
Robert Kempner
Dieser Jurist kämpfte 1930 für ein NSDAP-Verbot. Die Geschichte eines Scheiterns
Robert Kempner am Schreibtisch im Februar 1951
Der Jurist Robert Kempner (1899–1993) warnte eindringlich vor den Nationalsozialisten und ist einer der Verfasser der Schrift "Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei als staats- und republikfeindliche hochverräterische Verbindung" von 1930
© dpa / picture alliance
Manuel Opitz
1930 trugen preußische Beamte Beweise für "staatsfeindliche" Absichten der NSDAP zusammen und drangen auf ein Verbot der Partei. Warum sie kein Gehör fanden
Die Schrift, die die Weimarer Republik retten soll, ist 97 Seiten lang. Sie enthält reihenweise Zitatschnipsel, Ausschnitte aus Zeitungsartikeln, Verweise auf Gesetze und Rechtsbrüche. Ihr Titel: "Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei als staats- und republikfeindliche hochverräterische Verbindung". Ihr Zweck: Den Beweis erbringen, dass Hitler und seine NSDAP mit der Errichtung eines "Dritten Reichs" darauf abzielen, die Demokratie zu zerstören – und ein Verbot der Partei erreichen.
Das Werk aus dem Jahr 1930 stammt aus der Feder preußischer Beamter: Polizeivizepräsident Bernhard Weiß, Regierungsassessor Hans Schoch, Kriminalkommissar Johannes Stumm sowie Robert Kempner, Jurist. Er soll herleiten, wie die NSDAP und ihre Köpfe gemäß Gesetzeslage habhaft gemacht werden können – und welche Vorwürfe sich konkret gegen die Partei vor Gericht ins Feld führen lassen. Es ist ein Kampf um Paragrafen und Formulierungen, den die Beamten um Kempner nicht nur gegen die Nazis führen, sondern auch gegen die eigene Reichsregierung.
Beamte wühlten sich durch die Hetzpropaganda der NSDAP
Robert Kempner wurde 1899 als Sohn eines Berliner Wissenschaftlerehepaares mit jüdischen Wurzeln geboren. Niemand Geringeres als Robert Koch war sein Taufpate. Liberal erzogen, machte Kempner in der jungen Weimarer Republik nach dem Studium schnell Karriere, erst als Justiziar, dann als Staatsanwalt in Berlin. 1928 wechselte er ins preußische Innenministerium.
Dort verfolgte man den Aufstieg der NSDAP – und den Terror der SA mit ihren Schlägertrupps – zunehmend beunruhigt. Deshalb beauftragte das Ministerium 1929 die politische Abteilung des Polizeipräsidiums Berlins mit einer Untersuchung der staatsfeindlichen Handlungen und Absichten der NSDAP.
Kempner und sein Team trugen Material zusammen, wühlten sich durch Bücher wie Hitlers "Mein Kampf", nahmen sich Hetzpropaganda aus "Völkischem Beobachter" und "Angriff" vor, werteten Reden von NSDAP-Abgeordneten und Gauleitern aus.
Deutschland 1945 – ein Podcast-Special von "Verbrechen der Vergangenheit"
Podcast
"Verbrechen der Vergangenheit"-Special
Deutschland 1945 – eine dramatische Zeitreise in acht Folgen
von GEO EPOCHE
Seitenlang beschrieben die Beamten die Staatsauffassung der NSDAP, deren "Grundprinzip in der völligen Ablehnung des parlamentarischen Systems liegt", und führten an, wie deren Politiker die Weimarer Verfassung bekämpften.
Zitat Wilhelm Frick 1927: "Unsere Beteiligung am Parlament bedeutet nicht Stärkung, sondern Unterhöhlung des parlamentarischen Systems, nicht Verzicht auf unsere antiparlamentarische Einstellung, sondern Bekämpfung des Gegners mit seinen eigenen Waffen und Kampf für unsere nationalsozialistischen Ziele auch von der Parlamentstribüne aus. Unser nächstes Ziel bleibt immer die Eroberung der politischen Macht im Staat."
Hauptaufgabe der NSDAP: "Unruhe in die Massen hineinzutragen und diese aufzurütteln"
Im Jahr 1930, so stellten Kempner und seine Leute fest, versuche die NSDAP-Führung, "im Interesse der Vermeidung behördlicher Hindernisse sich vorläufig den Mantel der Gesetzlichkeit umzuhängen". Von ihrem eigentlichen Ziel aber, die Weimarer Republik abzuschaffen, sei sie keinesfalls abgerückt. Die Partei setze alles daran, "eine revolutionäre Massenbewegung zu entfachen und das Volk durch entsprechende Propaganda aufzuwühlen", konstatierten die Beamten.
Zitat des Hessischen Polizeiamts zu einer Rede des NS-Abgeordneten Werner Studentkowski in Worms 1929: "Ruhe und Ordnung, wie sie der Spießer beanspruche, lehne die Partei entschieden ab, da sie ihre Hauptaufgabe darin sehe, Unruhe in die Massen hineinzutragen und diese aufzurütteln!"
Auch legten Kempner und seine Mitstreiter dar, wie Nationalsozialisten Zellen innerhalb der Reichswehr und Schutzpolizei aufbauten und dort neue Mitglieder rekrutierten, warnten vor einer "Zersetzungstätigkeit". Die Aktivitäten von SA und SS fassten die Beamten ebenfalls zusammen. Bei den Verbänden handele es sich um eine "revolutionäre Armee", die den geplanten Umsturz der NSDAP militärisch absichern solle.
Portrait von Dr. Otto Braun
Der preußische Ministerpräsident Otto Braun (SPD) drang bei der Reichsregierung auf ein Verbot der NSDAP, vergeblich. Mit dem "Preußenschlag" am 20. Juli 1932 wurde er von der Reichsregierung entmachtet
© TT / imago images
Das Fazit der Denkschrift lautete, "dass die NSDAP auf eine Revolution mit gewaltsamen Mitteln hinarbeitet, deren Ziel über die nationalsozialistische Diktatur die Errichtung des nationalsozialistischen Dritten Reichs ist."
Die Beamten sahen den Tatbestand des Paragrafen 129 des Strafgesetzbuches als gegeben an. Dieser bestrafte die Bildung einer "staatsfeindlichen Vereinigung" mit bis zu zwei Jahren Gefängnis. Zugleich falle die Tätigkeit der NSDAP und ihres Führungskreises unter den Paragrafen 4 des Republikschutzgesetzes: Dieser sah Strafen gegen Personen vor, die die republikanische Verfassung untergraben.
"Zu den wichtigsten Staatsaufgaben gehört die Gewährleistung der Sicherheit des Staates und der verfassungsmäßigen Ordnung und die vorbeugende und abwehrende Verhinderung ihrer Störung", schließt die Denkschrift.
Brüning wollte die NSDAP nicht auf juristischem Weg stellen
Sie erreichte nicht nur den preußischen Regierungsapparat, sondern gelangte bis zum Reichsinnenministerium und zu Reichskanzler Brüning. Zu einem Verbot der NSDAP rang sich die Regierung jedoch nicht durch. Das Reichskabinett könne "jetzt noch nicht zu der Frage der Legalität oder Illegalität der NSDAP endgültig Stellung nehmen", heißt es in dem Protokoll der Sitzung. "Auf jeden Fall müsste die Reichsregierung sich davor hüten, dieselben falschen Methoden gegen die Nationalsozialisten anzuwenden, welche in der Vorkriegszeit gegen die Sozialdemokraten angewendet worden seien."
Bismarcks "Sozialistengesetz" hatte 1878 den Weg frei gemacht für die Verfolgung von Sozialdemokraten und Gewerkschaftsverbänden – und sozialistische Ideen nicht, wie von der Regierung beabsichtigt, unterdrückt, sondern das Klassenbewusstsein der Arbeiter noch gestärkt. Offensichtlich wollte Brüning die NSDAP nicht mit juristischen Repressionen stellen, sondern auf dem Feld der Politik schlagen.
Nationalsozialismus Frauen gegen Hitler: Diese Kämpferinnen riskierten ihr Leben im Widerstand
1 von 9
Weiter
Weiter
Lilian Harvey steht auf einem Boot
© picture alliance
Lilian Harvey: Filmstar im Widerstand
Viele Kunstschaffende dienten sich nach 1933 den Nationalsozialisten an, nicht so Lilian Harvey: Als einer der großen Stars der Unterhaltungsfilme (hier "Nie wieder Liebe", 1931) drehte sie zwar zunächst weiter, ging aber gleichzeitig auf Distanz zum NS-Regime. In ihrer Villa in Potsdam empfing sie jüdische Freunde; 1937 verhalf sie einem wegen Homosexualität verfolgten Tänzer zur Flucht. Auf ihrem Gut in Ungarn nahm sie NS-Flüchtlinge auf, bis sie 1939 nach Frankreich emigrierte, dort vor französischen Truppen auftrat und schließlich nach Hollywood übersiedelte. Nach dem Kriegseintritt der USA arbeitete sie als Rot-Kreuz-Schwester. Die Kunsthistorikerin Christiane Kruse porträtiert in ihrem Buch "Frauen gegen Hitler" Persönlichkeiten wie Lilian Harvey und zeigt auf, wie vielschichtig weiblicher Widerstand war.
Mehr
Weiter
Anna Beyer lächelt in Kamera
© Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, HHStAW, Best. 1213 Nr. 249
Anna Beyer: "Weg mit Hitler"
Die Frauen im Widerstand stammten aus vielen gesellschaftlichen Schichten – und setzten auf unterschiedlichste Aktionen. Die Frankfurter Büroangestellte Anna Beyer und ihr Weggefährte Ludwig Gehm etwa präparierten die Unterseite eines Koffers mit Schaumstoffbuchstaben und einer Silbernitratlösung. Nachts zogen sie durch die Stadt – wenn sie den Koffer auf dem Gehweg abstellten, hinterließ dieser die Parole "Weg mit Hitler". 1935 eröffnete Beyer das Restaurant "Vega", in dem sie auch jüdischen Menschen Mahlzeiten anbot. Zudem entwickelte sich die Gaststätte zur Anlaufstelle für den "Internationalen Sozialistischen Kampfbund" (ISK). "Die Tische waren mit ausgehöhlten Beinen versehen, in denen Flugblätter versteckt werden konnten", erklärt die Kunsthistorikerin Christiane Kruse. Beyer flüchtete schließlich ins französische Exil und ließ sich vom US-amerikanischen Militärnachrichtendienst "Office of Strategic Services" (OSS) als Nachrichtenagentin ausbilden.
Mehr
Weiter
Ruth Andreas-Friedrich
© Privatbesitz / Reproduktion Gedenkstätte Deutscher Widerstand
Ruth Andreas-Friedrich: Hoffnung für die Hoffnungslosen
Sie rief die Widerstandsgruppe "Onkel Emil" ins Leben: Nach der Reichspogromnacht am 9. November 1938 boten die Berliner Journalistin Ruth Andreas-Friedrich und ihr Lebensgefährte Leo Borchard ihre Wohnung als zentralen Treffpunkt für einen Helferkreis aus etwa 20 Frauen und Männern an. Während des Krieges verschaffte "Onkel Emil" Untergetauchten etwa Wohnraum und Lebensmittel. So halfen Andreas-Friedrich und ihre Mitstreiter jüdischen Menschen in Berlin, der Deportation in Konzentrationslager zu entgehen. "Für die vielen Emigranten, die alles hatten zurücklassen müssen, schmuggelte Andreas-Friedrich Wertsachen und Geld außer Landes", so Christiane Kruse. Noch im April 1945, als die Rote Armee Berlin erreichte, rief die Gruppe "Onkel Emil" auf Flugblättern zum Widerstand auf: "Berliner! Ihr kennt den Befehl des Wahnsinnigen Hitler und seines Bluthunds Himmler, jede Stadt bis zum äußersten zu verteidigen. Schreibt überall euer Nein an! Bildet Widerstandszellen in Kasernen, Betrieben, Schutzräumen!"
Mehr
Weiter
Helene Jacobs Porträtfoto
© Privatbesitz / Reproduktion Gedenkstätte Deutscher Widerstand
Helene Jacobs: Illegale Hilfe
Die Sekretärin Helene Jacobs arbeitete in Berlin für einen jüdischen Patentanwalt. 1939 verhalf sie ihm und seiner Frau zur Flucht. Jacobs war eine gläubige Christin und engagierte sich fortan in der Bekennenden Kirche, die den nationalsozialistischen Rassenwahn ablehnte. In ihrer Wohnung versteckte sie einen jüdischen Grafiker, der Dokumente fälschte, und betätigte sich als Kurierin jener Papiere. 1943 kam die Gestapo ihr auf die Spur; sie wurde zu einer Zuchthausstrafe verurteilt und kam kurz vor Kriegsende wieder frei.
Mehr
Weiter
Maria Gräfin von Maltzan
© Library of Congress
Gräfin von Maltzan: Die "Löwin von Berlin"
Maria von Maltzan, wohlbehütet aufgewachsen als Spross einer vermögenden Adelsfamilie in Schlesien, stand den Nationalsozialisten von Anfang an kritisch gegenüber. Sie beteiligte sich an mehreren Rettungsmaßnahmen, etwa bei der "Aktion Schwedenmöbel", bei der rund 20 Verfolgte in Möbelkisten versteckt im Zug nach Schweden gebracht werden sollten. In ihrer Wohnung bot sie immer wieder Juden Zuflucht und ließ zu diesem Zweck etwa ihre Couch präparieren: Bei Hausdurchsuchungen konnten sich Personen in dem Möbelstück verstecken – in dem auch Wasser und Hustenmittel bereitlagen. Rund 60 Personen soll Maltzan insgesamt gerettet haben. Beeindruckt von ihrem Temperament, ihrem Mut und ihrer Unerschrockenheit, nannte ein Pfarrer sie die "Löwin von Berlin".
Mehr
Weiter
Sophie Scholl
© dpa / picture alliance
Sophie Scholl: Ikone des Widerstands
"Man muß etwas machen, um selbst keine Schuld zu haben", meinte Sophie Scholl. Knapp 22 Jahre alt war sie, als sie sich in München der studentischen Widerstandsgruppe "Weiße Rose" anschloss, in der bereits ihr Bruder Hans Scholl aktiv war. Beide Geschwister stammten aus einer protestantisch geprägten Familie. Ab Januar 1943 beteiligte sich Sophie Scholl an der Herstellung und Verteilung von Flugblättern, beschaffte etwa Papier, Umschläge und Briefmarken. Als die Geschwister am 18. Februar 1943 stapelweise Flugblätter in der Münchner Universität verteilten, um zum Sturz des NS-Regimes aufzurufen, wurden sie von der Gestapo verhaftet, und vier Tage später wie auch der Medizinstudent Christoph Probst wegen "hochverräterischer Flugpropaganda" zum Tod verurteilt und hingerichtet. Statt sich vor Gericht herauszureden, bekannte Sophie Scholl: "Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen."
Mehr
Weiter
Libertas Schulze-Boysen beim Segeln
© Gedenkstätte Deutscher Widerstand
Libertas Schulze-Boysen: Heimliche Bilder von SS-Verbrechen
In Paris geboren, in der Schweiz zur Schule gegangen, in England gelebt: Libertas Schulze-Boysen, Tochter eines Kunstprofessors, stammte aus besten Verhältnissen. Sie selbst machte Karriere als Filmkritikerin, arbeitete schließlich in der Kulturfilmzentrale des Propagandaministeriums. 1936 heiratete sie Harro Schulze-Boysen, einen entschiedenen Gegner Hitlers. Durch ihn wurde sie Teil eines Widerstandsnetzwerks, das die Gestapo später "Rote Kapelle" nannte. Das Ehepaar veranstaltete in seiner Berliner Wohnung Treffen mit Regimegegnern, bei denen auch Flugschriften verfasst wurden, die zum Widerstand aufriefen. Zudem kopierte Libertas Schulze-Boysen "im Propagandaministerium heimlich von der Front eingehendes Bildmaterial über die Gräueltaten von SS und Wehrmacht, unter anderem über die Massenmorde an der jüdischen Bevölkerung im Osten", schreibt die Kunsthistorikerin Christiane Kruse. 1942 wurde das Ehepaar verhaftet und mit weiteren Angeklagten wegen "Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung und Spionage" zum Tod verurteilt.
Mehr
Weiter
Margarethe von Oven lächelt in Kamera
© Privatbesitz / Reproduktion Gedenkstätte Deutscher Widerstand
Margarethe von Oven: Operation "Walküre"
Als Claus Schenk Graf von Stauffenberg am 20. Juli 1944 das Attentat auf Hitler verübte, war sie die einzige Frau, die komplett in die Verschwörungspläne oppositioneller Militärs eingeweiht war: Margarethe von Oven arbeitete als Sekretärin für Oberst Henning von Tresckow, der zum engen Kreis der Hitler-Verschwörer um Stauffenberg gehörte. Sie nahm an den geheimen Treffen von Tresckow und Stauffenberg teil – und tippte auf der Schreibmaschine die Entwürfe zur Operation "Walküre" ab, die nach dem Attentat auf Hitler starten sollte. Nach dem gescheiterten Vorhaben sprengte sich von Tresckow mit einer Handgranate in die Luft; Margarethe von Oven wurde zeitweilig zwar verhaftet, aber wieder freigelassen.
Mehr
Weiter
Buchcover Frauen gegen Hitler
© Bebra Verlag
Noch mehr Frauen im Widerstand
In ihrem Buch porträtiert die Autorin Christiane Kruse mehrere Dutzend mutige Frauen, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt und Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben. "Frauen gegen Hitler" ist im Bebra Verlag erschienen.
Kempner überreichte die Denkschrift auch dem Oberreichsanwalt Karl August Werner und forderte ihn auf, Hitler und die führenden NSDAP-Funktionäre anzuklagen. Dieser war allerdings selbst ein Nazi – und stellte die Ermittlungen ein.
Selbst die "Boxheimer Dokumente", die 1931 an die Öffentlichkeit gelangten, bewegten die Reichsregierung nicht zum Handeln: In den "Blutplänen von Hessen" hatte ein hessischer NSDAP-Politiker einen Staatsstreich durchgespielt, der die Festnahme und Ermordung politischer Gegner vorsah.
Noch 1932 brachte Kempner unter einem Pseudonym seine Schrift "Justiz-Dämmerung: Auftakt zum Dritten Reich" heraus, warnte vor einer "Zertrümmerung der deutschen Justiz" und zeigte auf, wie Nationalsozialisten Richter einschüchterten und bedrohten.
Im gleichen Jahr unternahm die preußische Regierung einen letzten Versuch, Reichskanzler Brüning zu einem NSDAP-Verbot zu bewegen und legte in einer Materialsammlung dar, wie SA und SS einen Putsch vorbereiteten. Brüning jedoch, so wurde später bekannt, ordnete an, das preußische Schreiben nicht zu beantworten. Fortan war es zu spät für ein juristisches Vorgehen gegen die NSDAP.
Kempner und die anderen Autoren der Denkschrift verloren ihre Posten
Kaum hatten die Nationalsozialisten 1933 die Macht in Deutschland übernommen, wurde Kempner "wegen politischer Unzuverlässigkeit in Tateinheit mit fortgesetztem Judentum" aus dem Staatsdienst entlassen. Zwei Jahre später wurde er festgenommen, kam nach internationalen Protesten jedoch frei. Er ging erst nach Italien, dann in die USA.
Auch die anderen Autoren der Denkschrift verloren ihre Posten. Der Polizeivizepräsident Bernhard Weiß flüchtete nach London, Regierungsassessor Hans Schoch wurde als Homosexueller verhaftet und emigrierte nach Brasilien. Kriminalkommissar Johannes Stumm wurde nach dem Krieg Polizeipräsident in Westberlin.
Wannsee-Konferenz: In einer Villa am Wannsee: Wie die Nazis den Völkermord planten – und dabei Cognac tranken
Wannsee-Konferenz
In einer Villa am Wannsee: Wie die Nazis den Völkermord planten – und dabei Cognac tranken
von GEO EPOCHE
Am 20. Januar 1942 kommen in einer Berliner Villa 15 hohe Beamte des NS-Regimes zusammen. Sie organisieren ein Jahrtausendverbrechen: die Ermordung von mehr als elf Millionen Juden
Auch Kempner kehrte nach Deutschland zurück: als Stellvertreter des US-amerikanischen Chefanklägers Robert H. Jackson bei den Nürnberger Prozessen. Einer seiner Mitarbeiter war es, der 1947 in einem Aktenstapel in Berlin das letzte erhaltene Protokoll der "Wannsee-Konferenz" mit dem Beschluss der "Endlösung der Judenfrage" aufspürte.
Sein Leben lang blieb Kempner überzeugt: Hätte die Reichsregierung die NSDAP verboten, "so wäre Hitler am 30. Januar 1933 nicht Reichskanzler geworden und der Zweite Weltkrieg hätte nicht stattgefunden." Allerdings: Selbst ein Parteiverbot hätte wohl nicht zwangsläufig das Überleben der Weimarer Republik bedeutet. Schließlich hätte die NSDAP, gestützt auf SA und SS, die Demokratie auch aus der Illegalität erschüttern oder einen Bürgerkrieg auslösen können.
Nur eine Erkenntnis bleibt: Die Reichsregierung um Brüning hatte die Chance, juristisch gegen die Nationalsozialisten vorzugehen – und ließ sie verstreichen.
#Themen
https://www.geo.de/
2.6.1 Online-Artikel zum Parteienverbot der NS-Regierung vom 14.07.1933
Buchenwald Memorial | Gedenkstätte Buchenwald
15.07.2025·
Am 14. Juli 1933 verabschiedete die NS-Regierung das „Gesetz gegen die Neubildung von Parteien“.
Damit wurden alle Parteien außer der NSDAP verboten.
Zwei Tage später trat das Gesetz in Kraft – und Deutschland war ein Einparteienstaat.
Politische Gegner wurden verfolgt, verhaftet oder ermordet.
Viele flohen ins Exil oder arbeiteten im Untergrund.
Andere landeten in Gefängnissen oder Konzentrationslagern – wie im späteren KZ Buchenwald.
Bereits 1933 kamen erste politische Häftlinge in die frühen Lager.
Viele von ihnen wurden später nach Buchenwald verschleppt – Kommunist:innen, Sozialdemokrat:innen, Gewerkschafter:innen.
👉 Die Gleichschaltung war kein schleichender Prozess.
Sie vollzog sich rasch – per Gesetz und Gewalt.
📍 Buchenwald steht für die Folgen dieser Politik.
Die Entrechtung begann auf dem Papier – und endete in Zellen, Lagern und Morden.
🕯️ Erinnern heißt warnen.
📌 #Buchenwald #GedenkstätteBuchenwald #14Juli1933 #Einparteienstaat #NSDAP #Gleichschaltung #NieWieder #DemokratieSchützen #Erinnerungskultur
https://www.facebook.com/buchenwaldmemorial
Gedenkstätte KZ Osthofen
14.07.2025
Am 14. Juli 1933 wurde mit dem „Gesetz gegen die Neubildung von Parteien“ der letzte Schritt zur Ausschaltung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland vollzogen. Von nun an war die NSDAP die einzige legal existierende Partei – ein zentrales Element des nationalsozialistischen Einparteienstaates. 🏛️
📜 Das Gesetz bestand nur aus zwei Paragraphen – aber ihre Wirkung war verheerend: Wer versuchte, eine neue Partei zu gründen oder bestehende Strukturen politischer Organisation zu erhalten, musste mit Haft- oder Zuchthausstrafen rechnen. Damit wurden zahllose Gegner*innen des NS-Regimes kriminalisiert und verfolgt.
🚫 Es war ein klares Signal: Politischer Widerspruch war nicht mehr erlaubt. Das Gesetz schuf die juristische Grundlage für die totale Kontrolle des öffentlichen Lebens durch das NS-Regime – ein zentraler Schritt in den autoritären Umbau des Staates.
⚖️ Erst 1998, also mehr als 50 Jahre nach Kriegsende, wurden die unter diesem Gesetz ausgesprochenen Urteile durch das sogenannte NS-Aufhebungsgesetz offiziell aufgehoben.
📌 Der 14. Juli 1933 ist ein historischer Wendepunkt – ein Tag, an dem ein demokratischer Staat endgültig in eine Diktatur überging. Erinnern wir daran, was passiert, wenn Macht nicht begrenzt und politische Vielfalt unterdrückt wird.
#politische_bildung #bildung #history #geschichte #rlp #rheinlandpfalz #nsgeschichte #lpb_rlp #ns #nationalsozialismus #demokratie #niewieder
https://www.facebook.com/GedenkstaetteKZOsthofen
Siehe auch:
Besuchen Sie diese Internet-Präseenz bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!